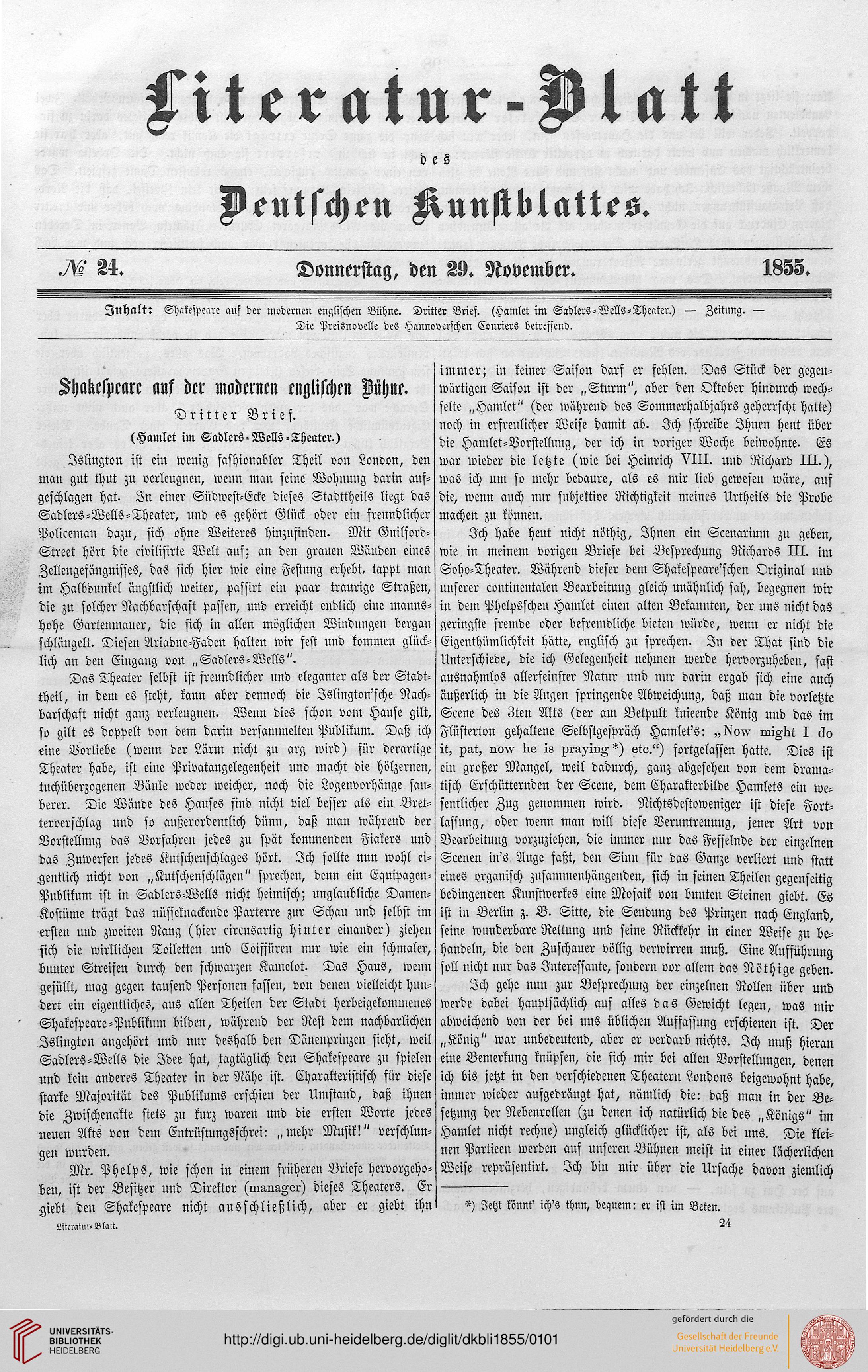M 24. Donnerstag, den 29. November. 1833.
Inhalt: Shakespeare aus der modernen englischen Bühne. Dritter Brief. (Hamlet im Sadlers-Wells-Theater.) — Zeitung. —
Die Preisnovelle des Hannoverschen Couriers betreffend.
Shakespeare aus der modernen englischen Aühne.
Dritter Brief.
(Hamlet im Sudlers-Wells-Theater.)
Jslington ist ein wenig fashionabler Theil von London, den
man gut thnt zu verleugnen, wenn man seine Wohnung darin auf-
geschlagen hat. In einer Südwest-Ecke dieses Stadttheils liegt das
Sadlers- Wells -Theater, und cs gehört Glück oder ein freundlicher
Policeman dazu, sich ohne Weiteres hinzufinden. Mit Guilford-
Street hört die civilisirte Welt auf; an den grauen Wänden eines
Zeüengejängnisses, das sich hier wie eine Festung erhebt, tappt man
im Halbdunkel ängstlich weiter, passirt ein paar traurige Straßen,
die zu solcher Nachbarschaft passen, und erreicht endlich eine manns-
hohe Gartenmauer, die sich in allen möglichen Windungen bergan
schlängelt. Diesen Ariadne-Faden halten wir fest und kommen glück-
lich an den Eingang von „Sadlers-Wells".
Das Theater selbst ist freundlicher und eleganter als der Stadt-
theil, in dem es steht, kann aber dennoch die Jslington'sche Nach-
barschaft nicht ganz verleugnen. Wenn dies schon vom Hause gilt,
so gilt es doppelt von dem darin versammelten Publikum. Daß ich
eine Vorliebe (wenn der Lärm nicht zu arg wird) für derartige
Theater habe, ist eine Privatangelegenheit und macht die hölzernen,
tuchüberzogenen Bänke weder weicher, noch die Logenvorhänge sau-
berer. Die Wände des Hauses sind nicht viel besser als ein Bret-
terverschlag und so außerordentlich dünn, daß man während der
Vorstellung das Vorfahren jedes zu spät kommenden Fiakers und
das Zuwerfen jedes Kutschenschlages hört. Ich sollte nun wohl ei-
gentlich nicht von „Kutschenschlägen" sprechen, denn ein Equipagen-
Publikum ist in Sadlers-Wells nicht heimisch; unglaubliche Damen-
Kostüme trägt das nüsseknackende Parterre zur Schau und selbst im
ersten und zweiten Rang (hier circusartig hinter einander) ziehen
sich die wirklichen Toiletten und Coiffüren nur wie ein schmaler,
bunter Streifen durch den schwarzen Kamelot. Das Haus, wenn
gesüllt, mag gegen tausend Personen fassen, von denen vielleicht hun-
dert ein eigentliches, aus allen Theilen der Stadt herbeigekommenes
Shakespeare-Publikum bilden, während der Rest dem nachbarlichen
Jslington angehört und nur deshalb den Dänenprinzen sieht, weil
Sadlers-Wells die Idee hat, tagtäglich den Shakespeare zu spielen
und kein anderes Theater in der Nähe ist. Charakteristisch für diese
starke Majorität des Publikums erschien der Umstand, daß ihnen
die Zwischenakte stets zu kurz waren und die ersten Worte jedes
neuen Akts von dem Entrüstungsschrei: „mehr Musik!" verschlun-
gen wurden.
Mr. Phelps, wie schon in einem früheren Briefe hervorgeho-
ben, ist der Besitzer und Direktor (manager) dieses Theaters. Er
giebt den Shakespeare nicht ausschließlich, aber er giebt ihn
Literatur-Blatt.
immer; in keiner Saison darf er fehlen. Das Stück der gegen-
wärtigen Saison ist der „Sturm", aber den Oktober hindurch wech-
selte „Hamlet" (der während des Sommerhalbjahrs geherrscht hatte)
noch in erfreulicher Weise damit ab. Ich schreibe Ihnen heut über
die Hamlet-Vorstellung, der ich in voriger Woche beiwohnte. Es
war wieder die letzte (wie bei Heinrich VIII. und Richard 1H.),
was ich um so mehr bedaure, als es mir lieb gewesen wäre, auf
die, wenn auch nur subjektive Richtigkeit meines Urtheils die Probe
machen zu können.
Ich habe heut nicht nöthig, Ihnen ein Scenarinm zu geben,
wie in meinem vorigen Briefe bei Besprechung Richards III. im
Soho-Theater. Während dieser dem Shakespeare'schen Original und
unserer continentalen Bearbeitung gleich unähnlich sah, begegnen wir
in dem Phelpsschen Hamlet einen alten Bekannten, der uns nicht das
geringste fremde oder befremdliche bieten würde, wenn er nicht die
Eigentümlichkeit hätte, englisch zu sprechen. In der That sind die
Unterschiede, die ich Gelegenheit nehmen werde hervorzuheben, fast
ausnahmlos allerfeinster Natur und nur darin ergab sich eine auch
äußerlich in die Augen springende Abweichung, daß man die vorletzte
Scene des 3ten Akts (der am Betpult knieende König und das im
Flüsterton gehaltene Selbstgespräch Hamlet's: „Now might I do
it, pat, now he is praying *) etc.“) fortgelassen hatte. Dies ist
ein großer Mangel, weil dadurch, ganz abgesehen von dem drama-
tisch Erschütternden der Scene, dem Charakterbilde Hamlets ein we-
sentlicher Zug genommen wird. Nichtsdestoweniger ist diese Fort-
lassung, oder wenn man will diese Veruntreuung, jener Art von
Bearbeitung vorzuziehen, die immer nur das Fesselnde der einzelnen
Scenen in's Auge faßt, den Sinn für das Ganze verliert und statt
eines organisch zusammenhängenden, sich in seinen Theilen gegenseitig
bedingenden Kunstwerkes eine Mosaik von bunten Steinen giebt. Es
ist in Berlin z. B. Sitte, die Sendung des Prinzen nach England,
seine wunderbare Rettung und seine Rückkehr in einer Weise zu be-
handeln, die den Zuschauer völlig verwirren muß. Eine Aufführung
soll nicht nur das Interessante, sondern vor allem das Nöthige geben.
Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen Rollen über und
werde dabei hauptsächlich auf alles das Gewicht legen, was mir
abweichend von der bei uns üblichen Auffassung erschienen ist. Der
„König" war unbedeutend, aber er verdarb nichts. Ich muß hieran
eine Bemerkung knüpfen, die sich mir bei allen Vorstellungen, denen
ich bis jetzt in den verschiedenen Theatern Londons beigewohnt habe,
immer wieder aufgedrängt hat, nämlich die: daß man in der Be-
setzung der Nebenrollen (zu denen ich natürlich die des „Königs" im
Hamlet nicht rechne) ungleich glücklicher ist, als bei uns. Die klei-
nen Partieen werden auf unseren Bühnen meist in einer lächerlichen
Weise repräsentirt. Ich bin mir über die Ursache davon ziemlich
*) Jetzt könnt' ich's thun, bequem: er ist im Beten.
24
Inhalt: Shakespeare aus der modernen englischen Bühne. Dritter Brief. (Hamlet im Sadlers-Wells-Theater.) — Zeitung. —
Die Preisnovelle des Hannoverschen Couriers betreffend.
Shakespeare aus der modernen englischen Aühne.
Dritter Brief.
(Hamlet im Sudlers-Wells-Theater.)
Jslington ist ein wenig fashionabler Theil von London, den
man gut thnt zu verleugnen, wenn man seine Wohnung darin auf-
geschlagen hat. In einer Südwest-Ecke dieses Stadttheils liegt das
Sadlers- Wells -Theater, und cs gehört Glück oder ein freundlicher
Policeman dazu, sich ohne Weiteres hinzufinden. Mit Guilford-
Street hört die civilisirte Welt auf; an den grauen Wänden eines
Zeüengejängnisses, das sich hier wie eine Festung erhebt, tappt man
im Halbdunkel ängstlich weiter, passirt ein paar traurige Straßen,
die zu solcher Nachbarschaft passen, und erreicht endlich eine manns-
hohe Gartenmauer, die sich in allen möglichen Windungen bergan
schlängelt. Diesen Ariadne-Faden halten wir fest und kommen glück-
lich an den Eingang von „Sadlers-Wells".
Das Theater selbst ist freundlicher und eleganter als der Stadt-
theil, in dem es steht, kann aber dennoch die Jslington'sche Nach-
barschaft nicht ganz verleugnen. Wenn dies schon vom Hause gilt,
so gilt es doppelt von dem darin versammelten Publikum. Daß ich
eine Vorliebe (wenn der Lärm nicht zu arg wird) für derartige
Theater habe, ist eine Privatangelegenheit und macht die hölzernen,
tuchüberzogenen Bänke weder weicher, noch die Logenvorhänge sau-
berer. Die Wände des Hauses sind nicht viel besser als ein Bret-
terverschlag und so außerordentlich dünn, daß man während der
Vorstellung das Vorfahren jedes zu spät kommenden Fiakers und
das Zuwerfen jedes Kutschenschlages hört. Ich sollte nun wohl ei-
gentlich nicht von „Kutschenschlägen" sprechen, denn ein Equipagen-
Publikum ist in Sadlers-Wells nicht heimisch; unglaubliche Damen-
Kostüme trägt das nüsseknackende Parterre zur Schau und selbst im
ersten und zweiten Rang (hier circusartig hinter einander) ziehen
sich die wirklichen Toiletten und Coiffüren nur wie ein schmaler,
bunter Streifen durch den schwarzen Kamelot. Das Haus, wenn
gesüllt, mag gegen tausend Personen fassen, von denen vielleicht hun-
dert ein eigentliches, aus allen Theilen der Stadt herbeigekommenes
Shakespeare-Publikum bilden, während der Rest dem nachbarlichen
Jslington angehört und nur deshalb den Dänenprinzen sieht, weil
Sadlers-Wells die Idee hat, tagtäglich den Shakespeare zu spielen
und kein anderes Theater in der Nähe ist. Charakteristisch für diese
starke Majorität des Publikums erschien der Umstand, daß ihnen
die Zwischenakte stets zu kurz waren und die ersten Worte jedes
neuen Akts von dem Entrüstungsschrei: „mehr Musik!" verschlun-
gen wurden.
Mr. Phelps, wie schon in einem früheren Briefe hervorgeho-
ben, ist der Besitzer und Direktor (manager) dieses Theaters. Er
giebt den Shakespeare nicht ausschließlich, aber er giebt ihn
Literatur-Blatt.
immer; in keiner Saison darf er fehlen. Das Stück der gegen-
wärtigen Saison ist der „Sturm", aber den Oktober hindurch wech-
selte „Hamlet" (der während des Sommerhalbjahrs geherrscht hatte)
noch in erfreulicher Weise damit ab. Ich schreibe Ihnen heut über
die Hamlet-Vorstellung, der ich in voriger Woche beiwohnte. Es
war wieder die letzte (wie bei Heinrich VIII. und Richard 1H.),
was ich um so mehr bedaure, als es mir lieb gewesen wäre, auf
die, wenn auch nur subjektive Richtigkeit meines Urtheils die Probe
machen zu können.
Ich habe heut nicht nöthig, Ihnen ein Scenarinm zu geben,
wie in meinem vorigen Briefe bei Besprechung Richards III. im
Soho-Theater. Während dieser dem Shakespeare'schen Original und
unserer continentalen Bearbeitung gleich unähnlich sah, begegnen wir
in dem Phelpsschen Hamlet einen alten Bekannten, der uns nicht das
geringste fremde oder befremdliche bieten würde, wenn er nicht die
Eigentümlichkeit hätte, englisch zu sprechen. In der That sind die
Unterschiede, die ich Gelegenheit nehmen werde hervorzuheben, fast
ausnahmlos allerfeinster Natur und nur darin ergab sich eine auch
äußerlich in die Augen springende Abweichung, daß man die vorletzte
Scene des 3ten Akts (der am Betpult knieende König und das im
Flüsterton gehaltene Selbstgespräch Hamlet's: „Now might I do
it, pat, now he is praying *) etc.“) fortgelassen hatte. Dies ist
ein großer Mangel, weil dadurch, ganz abgesehen von dem drama-
tisch Erschütternden der Scene, dem Charakterbilde Hamlets ein we-
sentlicher Zug genommen wird. Nichtsdestoweniger ist diese Fort-
lassung, oder wenn man will diese Veruntreuung, jener Art von
Bearbeitung vorzuziehen, die immer nur das Fesselnde der einzelnen
Scenen in's Auge faßt, den Sinn für das Ganze verliert und statt
eines organisch zusammenhängenden, sich in seinen Theilen gegenseitig
bedingenden Kunstwerkes eine Mosaik von bunten Steinen giebt. Es
ist in Berlin z. B. Sitte, die Sendung des Prinzen nach England,
seine wunderbare Rettung und seine Rückkehr in einer Weise zu be-
handeln, die den Zuschauer völlig verwirren muß. Eine Aufführung
soll nicht nur das Interessante, sondern vor allem das Nöthige geben.
Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen Rollen über und
werde dabei hauptsächlich auf alles das Gewicht legen, was mir
abweichend von der bei uns üblichen Auffassung erschienen ist. Der
„König" war unbedeutend, aber er verdarb nichts. Ich muß hieran
eine Bemerkung knüpfen, die sich mir bei allen Vorstellungen, denen
ich bis jetzt in den verschiedenen Theatern Londons beigewohnt habe,
immer wieder aufgedrängt hat, nämlich die: daß man in der Be-
setzung der Nebenrollen (zu denen ich natürlich die des „Königs" im
Hamlet nicht rechne) ungleich glücklicher ist, als bei uns. Die klei-
nen Partieen werden auf unseren Bühnen meist in einer lächerlichen
Weise repräsentirt. Ich bin mir über die Ursache davon ziemlich
*) Jetzt könnt' ich's thun, bequem: er ist im Beten.
24