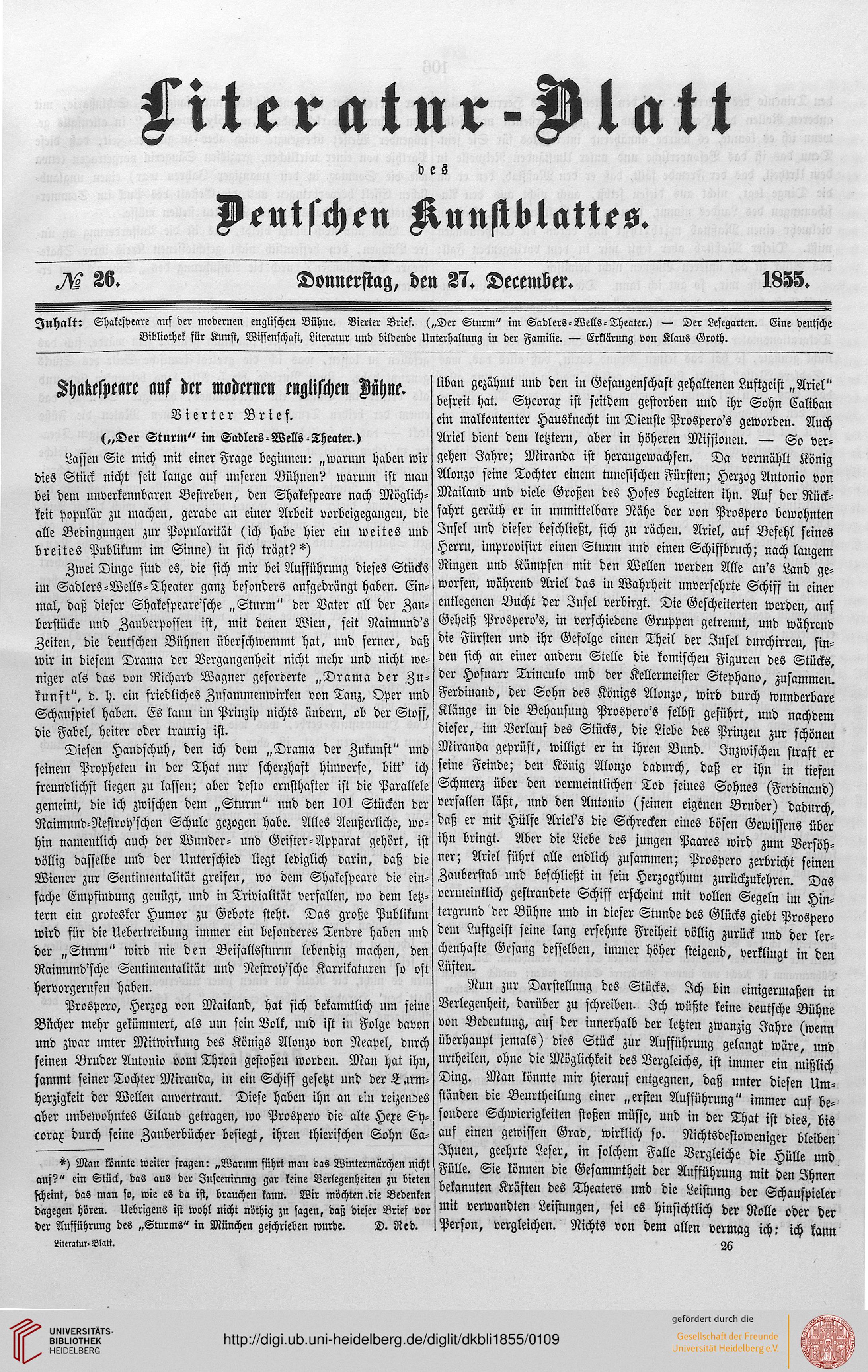des
JG 26. Donnerstag, den 27. December. 1838.
Inhalt: Shakespeare auf der modernen englischen Bühne. Vierter Brief. („Der Sturm" im Sadlers-Wells-Theater.) — Der Lesegarten. Eine deutsche
Bibliothek für Kunst, Wissenschaft, Literatur und bildende Unterhaltung in der Familie. — Erklärung von Klaus Groth.
Shakespeare auf der modernen englischen Dohne.
Vierter Brief.
(„Der Sturm" im Sadlers-Wells-Theater.)
Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen: „warum haben wir
dies Stück nicht seit lange auf unseren Bühnen? warum ist man
bei dem unverkennbaren Bestreben, den Shakespeare nach Möglich-
keit populär zu machen, gerade an einer Arbeit vorbeigegangen, die
alle Bedingungen zur Popularität (ich habe hier ein weites und
breites Publikum im Sinne) in sich trägt?*)
Zwei Dinge sind es, die sich mir bei Aufführung dieses Stücks
im Sadlers-Wells-Theater ganz besonders aufgedrängt haben. Ein-
mal, daß dieser Shakespeare'sche „Sturm" der Vater all der Zau-
berstücke und Zauberpossen ist, mit denen Wien, seit Raimund's
Zeiten, die deutschen Bühnen überschwemmt hat, und ferner, daß
wir in diesem Drama der Vergangenheit nicht mehr und nicht we-
niger als das von Richard Wagner geforderte „Drama der Zu-
kunft", d. h. ein friedliches Zusammenwirken von Tanz, Oper und
Schauspiel haben. Es kann im Prinzip nichts ändern, ob der Stoff,
die Fabel, heiter oder traurig ist.
Diesen Handschuh, den ich dem „Drama der Zukunft" und
seinem Propheten in der That nur scherzhaft hinwerfe, bitt' ich
freundlichst liegen zu lassen; aber desto ernsthafter ist die Parallele
gemeint, die ich zwischen dem „Sturm" und den 101 Stücken der
Raimund-Nestroy'schen Schule gezogen habe. Alles Aeußerliche, wo-
hin namentlich auch der Wunder- und Geister-Apparat gehört, ist
völlig dasselbe und der Unterschied liegt lediglich darin, daß die
Wiener zur Sentimentalität greifen, wo dem Shakespeare die ein-
fache Empfindung genügt, und in Trivialität verfallen, wo dem letz-
tem ein grotesker Humor zu Gebote steht. Das große Publikum
wird für die Uebertreibuug immer ein besonderes Tendre haben und
der „Sturm" wird nie den Beifallssturm lebendig machen, den
Raimund'sche Sentimentalität und Nestroh'sche Karrikaturen so oft
hervorgerufen haben.
Prospero, Herzog von Mailand, hat sich bekanntlich um seine
Bücher mehr gekümmert, als um sein Volk, und ist i:. Folge davon
und zwar unter Mitwirkung des Königs Alonzo von Neapel, durch
seinen Bruder Antonio vom Thron gestoßen worden. Man hat ihn,
sammt seiner Tochter Miranda, in ein Schiff gesetzt und der & arm-
herzigkeit der Wellen anvertraut. Diese haben ihn an ein reizendes
aber unbewohntes Eiland getragen, wo Prospero die alte Hexe Sy-
corax durch seine Zauberbücher besiegt, ihren thierischen Sohn Ca-
*) Man könnte weiter fragen: „Warum führt man das Wintermärchen nicht
aus?" ein Stück, das aus der Jnscenirung gar keine Verlegenheiten zu bieten
scheint, bas man so, wie es da ist, brauchen kann. Wir möchten.die Bedenken
dagegen hören. Uebrigens ist wohl nicht nöthig zu sagen, daß dieser Brief vor
der Aufführung des „Sturms" in München geschrieben wurde. D. Red.
Literatur- Blatt.
liban gezähmt und den in Gefangenschaft gehaltenen Luftgeist „Ariel"
befreit hat. Sycorax ist seitdem gestorben und ihr Sohn Caliban
ein malkontenter Hausknecht im Dienste Prospero's geworden. Auch
Ariel dient dem letztem, aber in höheren Missionen. — So ver-
gehen Jahre; Miranda ist herangewachsen. Da vermählt König
Alonzo seine Tochter einem tunesischen Fürsten; Herzog Antonio von
Mailand und viele Großen des Hofes begleiten ihn. Auf der Rück-
fahrt geräth er in unmittelbare Nähe der von Prospero bewohnten
Insel und dieser beschließt, sich zu rächen. Ariel, auf Befehl seines
Herrn, improvisirt einen Sturm und einen Schiffbruch; nach langem
Ringen und Kämpfen mit den Wellen werden Alle an's Land ge-
worfen, während Ariel das in Wahrheit unversehrte Schiff in einer
entlegenen Bucht der Insel verbirgt. Die Gescheiterten werden, auf
Geheiß Prospero's, in verschiedene Gruppen getrennt, und während
die Fürsten und ihr Gefolge einen Theil der Insel durchirren, fin-
den sich an einer andern Stelle die komischen Figuren des Stücks,
der Hofnarr Trinculo und der Kellermeister Stephano, zusammen.
Ferdinand, der Sohn des Königs Alonzo, wird durch wunderbare
Klänge in die Behausung Prospero's selbst geführt, und nachdem
dieser, im Verlauf des Stücks, die Liebe des Prinzen zur schönen
Miranda geprüft, willigt er in ihren Bund. Inzwischen straft er
seine Feinde; den König Alonzo dadurch, daß er ihn in tiefen
Schmerz über den vermeintlichen Tod seines Sohnes (Ferdinand)
verfallen läßt, und den Antonio (seinen eigenen Bruder) dadurch,
daß er mit Hülfe Ariel's die Schrecken eines bösen Gewissens über
ihn bringt. Aber die Liebe des jungen Paares wird zum Versöh-
ner; Ariel führt alle endlich zusammen; Prospero zerbricht seinen
Zauberstab und beschließt in sein Herzogthum zurückzukehren. Das
vermeintlich gestrandete Schiff erscheint mit vollen Segeln im Hin-
tergrund der Bühne und in dieser Stunde des Glücks giebt Prospero
dem Lustgeist seine lang ersehnte Freiheit völlig zurück und der ler-
chenhafte Gesang desselben, immer höher steigend, verklingt in den
Lüsten.
Nun zur Darstellung des Stücks. Ich bin einigermaßen in
Verlegenheit, darüber zu schreiben. Ich wüßte keine deutsche Bühne
von Bedeutung, aus der innerhalb der letzten zwanzig Jahre (wenn
überhaupt jemals) dies Stück zur Ausführung gelangt wäre, und
urtheilen, ohne die Möglichkeit des Vergleichs, ist immer ein mißlich
Ding. Man könnte mir hierauf entgegnen, daß unter diesen Um-
ständen die Beurtheilung einer „ersten Aufführung" immer auf be-
sondere Schwierigkeiten stoßen müsse, und in der That ist dies, bis
auf einen gewissen Grad, wirklich so. Nichtsdestoweniger bleiben
Ihnen, geehrte Leser, in solchem Falle Vergleiche die Hülle und
Fülle. Sie können die Gesammtheit der Ausführung mit den Ihnen
bekannten Kräften des Theaters und die Leistung der Schauspieler
mit verwandten Leistungen, sei es hinsichtlich der Rolle oder der
Person, vergleichen. Nichts von dem allen vermag ich: ich kann
26
JG 26. Donnerstag, den 27. December. 1838.
Inhalt: Shakespeare auf der modernen englischen Bühne. Vierter Brief. („Der Sturm" im Sadlers-Wells-Theater.) — Der Lesegarten. Eine deutsche
Bibliothek für Kunst, Wissenschaft, Literatur und bildende Unterhaltung in der Familie. — Erklärung von Klaus Groth.
Shakespeare auf der modernen englischen Dohne.
Vierter Brief.
(„Der Sturm" im Sadlers-Wells-Theater.)
Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen: „warum haben wir
dies Stück nicht seit lange auf unseren Bühnen? warum ist man
bei dem unverkennbaren Bestreben, den Shakespeare nach Möglich-
keit populär zu machen, gerade an einer Arbeit vorbeigegangen, die
alle Bedingungen zur Popularität (ich habe hier ein weites und
breites Publikum im Sinne) in sich trägt?*)
Zwei Dinge sind es, die sich mir bei Aufführung dieses Stücks
im Sadlers-Wells-Theater ganz besonders aufgedrängt haben. Ein-
mal, daß dieser Shakespeare'sche „Sturm" der Vater all der Zau-
berstücke und Zauberpossen ist, mit denen Wien, seit Raimund's
Zeiten, die deutschen Bühnen überschwemmt hat, und ferner, daß
wir in diesem Drama der Vergangenheit nicht mehr und nicht we-
niger als das von Richard Wagner geforderte „Drama der Zu-
kunft", d. h. ein friedliches Zusammenwirken von Tanz, Oper und
Schauspiel haben. Es kann im Prinzip nichts ändern, ob der Stoff,
die Fabel, heiter oder traurig ist.
Diesen Handschuh, den ich dem „Drama der Zukunft" und
seinem Propheten in der That nur scherzhaft hinwerfe, bitt' ich
freundlichst liegen zu lassen; aber desto ernsthafter ist die Parallele
gemeint, die ich zwischen dem „Sturm" und den 101 Stücken der
Raimund-Nestroy'schen Schule gezogen habe. Alles Aeußerliche, wo-
hin namentlich auch der Wunder- und Geister-Apparat gehört, ist
völlig dasselbe und der Unterschied liegt lediglich darin, daß die
Wiener zur Sentimentalität greifen, wo dem Shakespeare die ein-
fache Empfindung genügt, und in Trivialität verfallen, wo dem letz-
tem ein grotesker Humor zu Gebote steht. Das große Publikum
wird für die Uebertreibuug immer ein besonderes Tendre haben und
der „Sturm" wird nie den Beifallssturm lebendig machen, den
Raimund'sche Sentimentalität und Nestroh'sche Karrikaturen so oft
hervorgerufen haben.
Prospero, Herzog von Mailand, hat sich bekanntlich um seine
Bücher mehr gekümmert, als um sein Volk, und ist i:. Folge davon
und zwar unter Mitwirkung des Königs Alonzo von Neapel, durch
seinen Bruder Antonio vom Thron gestoßen worden. Man hat ihn,
sammt seiner Tochter Miranda, in ein Schiff gesetzt und der & arm-
herzigkeit der Wellen anvertraut. Diese haben ihn an ein reizendes
aber unbewohntes Eiland getragen, wo Prospero die alte Hexe Sy-
corax durch seine Zauberbücher besiegt, ihren thierischen Sohn Ca-
*) Man könnte weiter fragen: „Warum führt man das Wintermärchen nicht
aus?" ein Stück, das aus der Jnscenirung gar keine Verlegenheiten zu bieten
scheint, bas man so, wie es da ist, brauchen kann. Wir möchten.die Bedenken
dagegen hören. Uebrigens ist wohl nicht nöthig zu sagen, daß dieser Brief vor
der Aufführung des „Sturms" in München geschrieben wurde. D. Red.
Literatur- Blatt.
liban gezähmt und den in Gefangenschaft gehaltenen Luftgeist „Ariel"
befreit hat. Sycorax ist seitdem gestorben und ihr Sohn Caliban
ein malkontenter Hausknecht im Dienste Prospero's geworden. Auch
Ariel dient dem letztem, aber in höheren Missionen. — So ver-
gehen Jahre; Miranda ist herangewachsen. Da vermählt König
Alonzo seine Tochter einem tunesischen Fürsten; Herzog Antonio von
Mailand und viele Großen des Hofes begleiten ihn. Auf der Rück-
fahrt geräth er in unmittelbare Nähe der von Prospero bewohnten
Insel und dieser beschließt, sich zu rächen. Ariel, auf Befehl seines
Herrn, improvisirt einen Sturm und einen Schiffbruch; nach langem
Ringen und Kämpfen mit den Wellen werden Alle an's Land ge-
worfen, während Ariel das in Wahrheit unversehrte Schiff in einer
entlegenen Bucht der Insel verbirgt. Die Gescheiterten werden, auf
Geheiß Prospero's, in verschiedene Gruppen getrennt, und während
die Fürsten und ihr Gefolge einen Theil der Insel durchirren, fin-
den sich an einer andern Stelle die komischen Figuren des Stücks,
der Hofnarr Trinculo und der Kellermeister Stephano, zusammen.
Ferdinand, der Sohn des Königs Alonzo, wird durch wunderbare
Klänge in die Behausung Prospero's selbst geführt, und nachdem
dieser, im Verlauf des Stücks, die Liebe des Prinzen zur schönen
Miranda geprüft, willigt er in ihren Bund. Inzwischen straft er
seine Feinde; den König Alonzo dadurch, daß er ihn in tiefen
Schmerz über den vermeintlichen Tod seines Sohnes (Ferdinand)
verfallen läßt, und den Antonio (seinen eigenen Bruder) dadurch,
daß er mit Hülfe Ariel's die Schrecken eines bösen Gewissens über
ihn bringt. Aber die Liebe des jungen Paares wird zum Versöh-
ner; Ariel führt alle endlich zusammen; Prospero zerbricht seinen
Zauberstab und beschließt in sein Herzogthum zurückzukehren. Das
vermeintlich gestrandete Schiff erscheint mit vollen Segeln im Hin-
tergrund der Bühne und in dieser Stunde des Glücks giebt Prospero
dem Lustgeist seine lang ersehnte Freiheit völlig zurück und der ler-
chenhafte Gesang desselben, immer höher steigend, verklingt in den
Lüsten.
Nun zur Darstellung des Stücks. Ich bin einigermaßen in
Verlegenheit, darüber zu schreiben. Ich wüßte keine deutsche Bühne
von Bedeutung, aus der innerhalb der letzten zwanzig Jahre (wenn
überhaupt jemals) dies Stück zur Ausführung gelangt wäre, und
urtheilen, ohne die Möglichkeit des Vergleichs, ist immer ein mißlich
Ding. Man könnte mir hierauf entgegnen, daß unter diesen Um-
ständen die Beurtheilung einer „ersten Aufführung" immer auf be-
sondere Schwierigkeiten stoßen müsse, und in der That ist dies, bis
auf einen gewissen Grad, wirklich so. Nichtsdestoweniger bleiben
Ihnen, geehrte Leser, in solchem Falle Vergleiche die Hülle und
Fülle. Sie können die Gesammtheit der Ausführung mit den Ihnen
bekannten Kräften des Theaters und die Leistung der Schauspieler
mit verwandten Leistungen, sei es hinsichtlich der Rolle oder der
Person, vergleichen. Nichts von dem allen vermag ich: ich kann
26