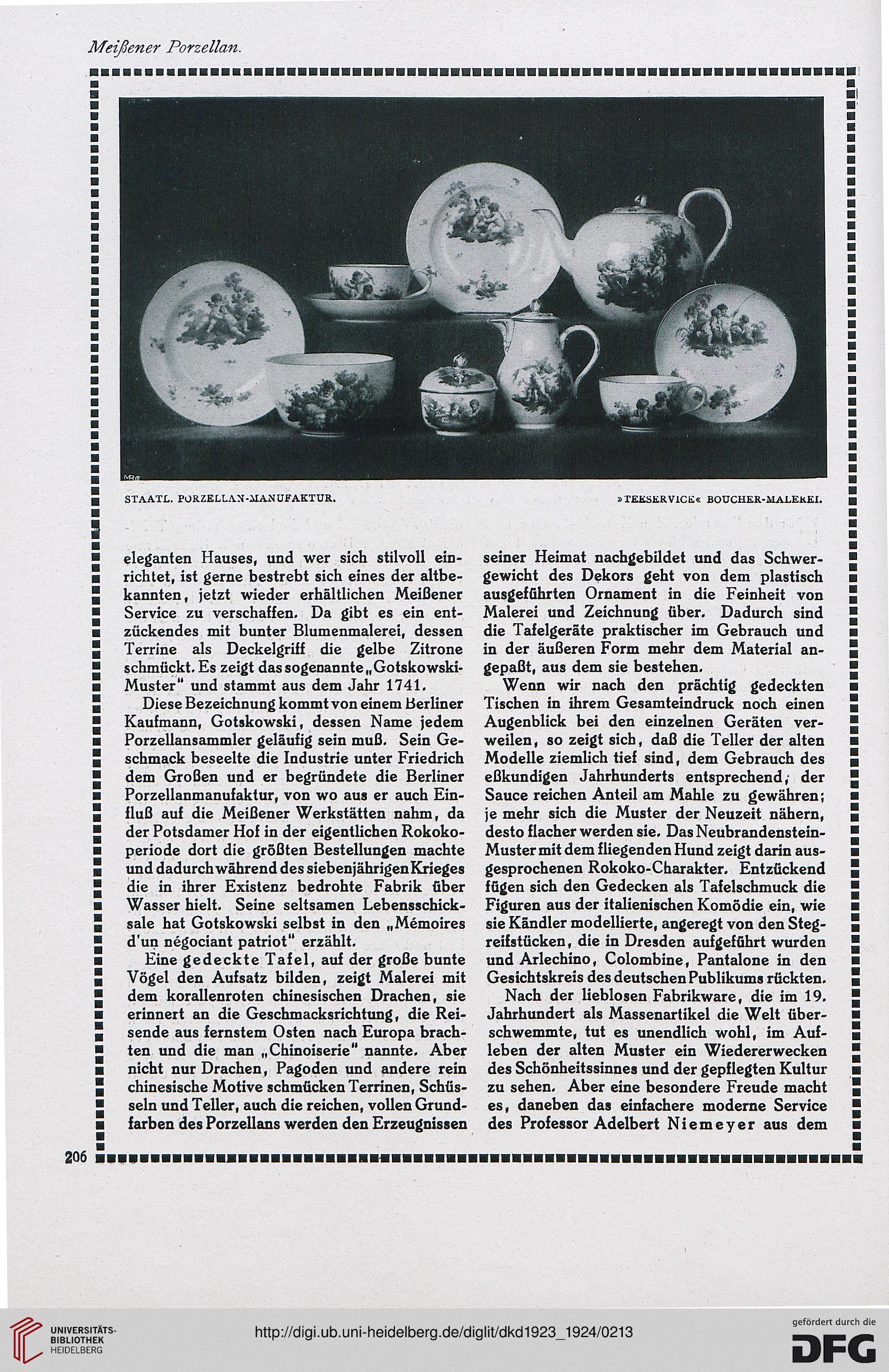Meißener Porzellan.
STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR. »TEKSERVlCü« BOUCHER-MALEREI.
eleganten Hauses, und wer sich stilvoll ein-
richtet, ist gerne bestrebt sich eines der altbe-
kannten, jetzt wieder erhältlichen Meißener
Service zu verschaffen. Da gibt es ein ent-
zückendes mit bunter Blumenmalerei, dessen
Terrine als Deckelgriff die gelbe Zitrone
schmückt. Es zeigt das sogenannte „Gotskowski-
Muster" und stammt aus dem Jahr 1741.
Diese Bezeichnung kommt von einem Berliner
Kaufmann, Gotskowski, dessen Name jedem
Porzellansammler geläufig sein muß. Sein Ge-
schmack beseelte die Industrie unter Friedrich
dem Großen und er begründete die Berliner
Porzellanmanufaktur, von wo aus er auch Ein-
fluß auf die Meißener Werkstätten nahm, da
der Potsdamer Hof in der eigentlichen Rokoko-
periode dort die größten Bestellungen machte
und dadurchwährend des siebenjährigen Krieges
die in ihrer Existenz bedrohte Fabrik über
Wasser hielt. Seine seltsamen Lebensschick-
sale hat Gotskowski selbst in den „Memoires
d'un negociant patriot" erzählt.
Eine gedeckte Tafel, auf der große bunte
Vögel den Aufsatz bilden, zeigt Malerei mit
dem korallenroten chinesischen Drachen, sie
erinnert an die Geschmacksrichtung, die Rei-
sende aus fernstem Osten nach Europa brach-
ten und die man „Chinoiserie" nannte. Aber
nicht nur Drachen, Pagoden und andere rein
chinesische Motive schmücken Terrinen, Schüs-
seln und Teller, auch die reichen, vollen Grund-
farben des Porzellans werden den Erzeugnissen
seiner Heimat nachgebildet und das Schwer-
gewicht des Dekors geht von dem plastisch
ausgeführten Ornament in die Feinheit von
Malerei und Zeichnung über. Dadurch sind
die Tafelgeräte praktischer im Gebrauch und
in der äußeren Form mehr dem Material an-
gepaßt, aus dem sie bestehen.
Wenn wir nach den prächtig gedeckten
Tischen in ihrem Gesamteindruck noch einen
Augenblick bei den einzelnen Geräten ver-
weilen , so zeigt sich, daß die Teller der alten
Modelle ziemlich tief sind, dem Gebrauch des
eßkundigen Jahrhunderts entsprechend, der
Sauce reichen Anteil am Mahle zu gewähren;
je mehr sich die Muster der Neuzeit nähern,
desto flacher werden sie. Das Neubrandenstein-
Muster mit dem fliegenden Hund zeigt darin aus-
gesprochenen Rokoko-Charakter. Entzückend
fügen sich den Gedecken als Tafelschmuck die
Figuren aus der italienischen Komödie ein, wie
sie Kändler modellierte, angeregt von den Steg-
reifstücken, die in Dresden aufgeführt wurden
und Arlechino, Colombine, Pantalone in den
Gesichtskreis des deutschen Publikums rückten.
Nach der lieblosen Fabrikware, die im 19.
Jahrhundert als Massenartikel die Welt über-
schwemmte, tut es unendlich wohl, im Auf-
leben der alten Muster ein Wiedererwecken
des Schönheitssinnes und der gepflegten Kultur
zu sehen. Aber eine besondere Freude macht
es, daneben das einfachere moderne Service
des Professor Adelbert Niemeyer aus dem
206
STAATL. PORZELLAN-MANUFAKTUR. »TEKSERVlCü« BOUCHER-MALEREI.
eleganten Hauses, und wer sich stilvoll ein-
richtet, ist gerne bestrebt sich eines der altbe-
kannten, jetzt wieder erhältlichen Meißener
Service zu verschaffen. Da gibt es ein ent-
zückendes mit bunter Blumenmalerei, dessen
Terrine als Deckelgriff die gelbe Zitrone
schmückt. Es zeigt das sogenannte „Gotskowski-
Muster" und stammt aus dem Jahr 1741.
Diese Bezeichnung kommt von einem Berliner
Kaufmann, Gotskowski, dessen Name jedem
Porzellansammler geläufig sein muß. Sein Ge-
schmack beseelte die Industrie unter Friedrich
dem Großen und er begründete die Berliner
Porzellanmanufaktur, von wo aus er auch Ein-
fluß auf die Meißener Werkstätten nahm, da
der Potsdamer Hof in der eigentlichen Rokoko-
periode dort die größten Bestellungen machte
und dadurchwährend des siebenjährigen Krieges
die in ihrer Existenz bedrohte Fabrik über
Wasser hielt. Seine seltsamen Lebensschick-
sale hat Gotskowski selbst in den „Memoires
d'un negociant patriot" erzählt.
Eine gedeckte Tafel, auf der große bunte
Vögel den Aufsatz bilden, zeigt Malerei mit
dem korallenroten chinesischen Drachen, sie
erinnert an die Geschmacksrichtung, die Rei-
sende aus fernstem Osten nach Europa brach-
ten und die man „Chinoiserie" nannte. Aber
nicht nur Drachen, Pagoden und andere rein
chinesische Motive schmücken Terrinen, Schüs-
seln und Teller, auch die reichen, vollen Grund-
farben des Porzellans werden den Erzeugnissen
seiner Heimat nachgebildet und das Schwer-
gewicht des Dekors geht von dem plastisch
ausgeführten Ornament in die Feinheit von
Malerei und Zeichnung über. Dadurch sind
die Tafelgeräte praktischer im Gebrauch und
in der äußeren Form mehr dem Material an-
gepaßt, aus dem sie bestehen.
Wenn wir nach den prächtig gedeckten
Tischen in ihrem Gesamteindruck noch einen
Augenblick bei den einzelnen Geräten ver-
weilen , so zeigt sich, daß die Teller der alten
Modelle ziemlich tief sind, dem Gebrauch des
eßkundigen Jahrhunderts entsprechend, der
Sauce reichen Anteil am Mahle zu gewähren;
je mehr sich die Muster der Neuzeit nähern,
desto flacher werden sie. Das Neubrandenstein-
Muster mit dem fliegenden Hund zeigt darin aus-
gesprochenen Rokoko-Charakter. Entzückend
fügen sich den Gedecken als Tafelschmuck die
Figuren aus der italienischen Komödie ein, wie
sie Kändler modellierte, angeregt von den Steg-
reifstücken, die in Dresden aufgeführt wurden
und Arlechino, Colombine, Pantalone in den
Gesichtskreis des deutschen Publikums rückten.
Nach der lieblosen Fabrikware, die im 19.
Jahrhundert als Massenartikel die Welt über-
schwemmte, tut es unendlich wohl, im Auf-
leben der alten Muster ein Wiedererwecken
des Schönheitssinnes und der gepflegten Kultur
zu sehen. Aber eine besondere Freude macht
es, daneben das einfachere moderne Service
des Professor Adelbert Niemeyer aus dem
206