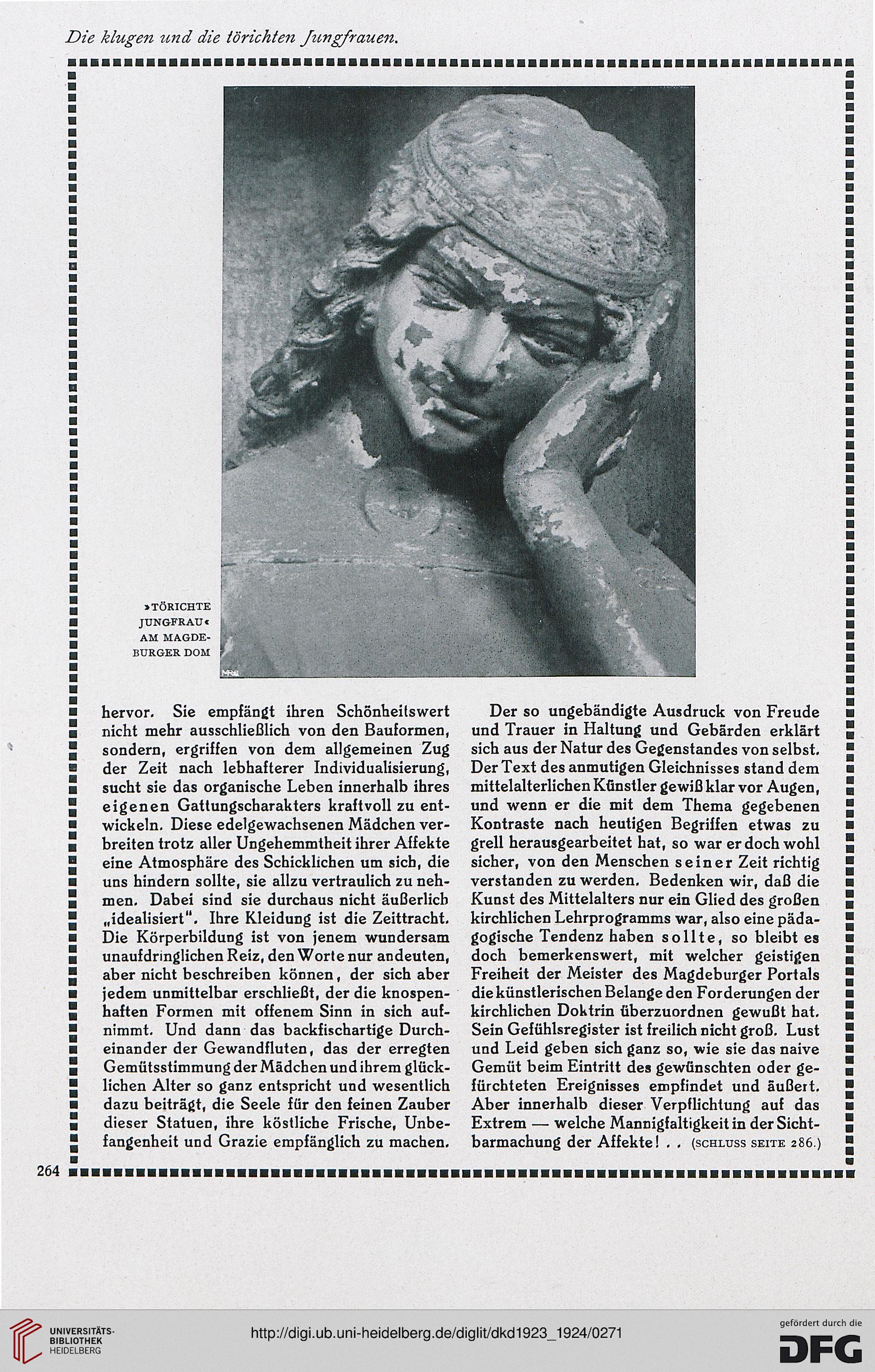Die klugen und die törichten Jungfrauen.
am magde-
burger dom
hervor. Sie empfängt ihren Schönheitswert
nicht mehr ausschließlich von den Bauformen,
sondern, ergriffen von dem allgemeinen Zug
der Zeit nach lebhafterer Individualisierung,
sucht sie das organische Leben innerhalb ihres
eigenen Gattungscharakters kraftvoll zu ent-
wickeln. Diese edelgewachsenen Mädchen ver-
breiten trotz aller Ungehemmtheit ihrer Affekte
eine Atmosphäre des Schicklichen um sich, die
uns hindern sollte, sie allzu vertraulich zu neh-
men. Dabei sind sie durchaus nicht äußerlich
„idealisiert". Ihre Kleidung ist die Zeittracht.
Die Körperbildung ist von jenem wundersam
unaufdringlichen Reiz, den Worte nur andeuten,
aber nicht beschreiben können, der sich aber
jedem unmittelbar erschließt, der die knospen-
haften Formen mit offenem Sinn in sich auf-
nimmt. Und dann das backfischartige Durch-
einander der Gewandfluten, das der erregten
Gemütsstimmung der Mädchen und ihrem glück-
lichen Alter so ganz entspricht und wesentlich
dazu beiträgt, die Seele für den feinen Zauber
dieser Statuen, ihre köstliche Frische, Unbe-
fangenheit und Grazie empfänglich zu machen.
Der so ungebändigte Ausdruck von Freude
und Trauer in Haltung und Gebärden erklärt
sich aus der Natur des Gegenstandes von selbst.
Der Text des anmutigen Gleichnisses stand dem
mittelalterlichen Künstler gewiß klar vor Augen,
und wenn er die mit dem Thema gegebenen
Kontraste nach heutigen Begriffen etwas zu
grell herausgearbeitet hat, so war er doch wohl
sicher, von den Menschen seiner Zeit richtig
verstanden zu werden. Bedenken wir, daß die
Kunst des Mittelalters nur ein Glied des großen
kirchlichen Lehrprogramms war, also eine päda-
gogische Tendenz haben sollte, so bleibt es
doch bemerkenswert, mit welcher geistigen
Freiheit der Meister des Magdeburger Portals
die künstlerischen Belange den Forderungen der
kirchlichen Doktrin überzuordnen gewußt hat.
Sein Gefühlsregister ist freilich nicht groß. Lust
und Leid geben sich ganz so, wie sie das naive
Gemüt beim Eintritt des gewünschten oder ge-
fürchteten Ereignisses empfindet und äußert.
Aber innerhalb dieser Verpflichtung auf das
Extrem —• welche Mannigfaltigkeit in der Sicht-
barmachung der Affekte! . . (schluss seite 286.)
am magde-
burger dom
hervor. Sie empfängt ihren Schönheitswert
nicht mehr ausschließlich von den Bauformen,
sondern, ergriffen von dem allgemeinen Zug
der Zeit nach lebhafterer Individualisierung,
sucht sie das organische Leben innerhalb ihres
eigenen Gattungscharakters kraftvoll zu ent-
wickeln. Diese edelgewachsenen Mädchen ver-
breiten trotz aller Ungehemmtheit ihrer Affekte
eine Atmosphäre des Schicklichen um sich, die
uns hindern sollte, sie allzu vertraulich zu neh-
men. Dabei sind sie durchaus nicht äußerlich
„idealisiert". Ihre Kleidung ist die Zeittracht.
Die Körperbildung ist von jenem wundersam
unaufdringlichen Reiz, den Worte nur andeuten,
aber nicht beschreiben können, der sich aber
jedem unmittelbar erschließt, der die knospen-
haften Formen mit offenem Sinn in sich auf-
nimmt. Und dann das backfischartige Durch-
einander der Gewandfluten, das der erregten
Gemütsstimmung der Mädchen und ihrem glück-
lichen Alter so ganz entspricht und wesentlich
dazu beiträgt, die Seele für den feinen Zauber
dieser Statuen, ihre köstliche Frische, Unbe-
fangenheit und Grazie empfänglich zu machen.
Der so ungebändigte Ausdruck von Freude
und Trauer in Haltung und Gebärden erklärt
sich aus der Natur des Gegenstandes von selbst.
Der Text des anmutigen Gleichnisses stand dem
mittelalterlichen Künstler gewiß klar vor Augen,
und wenn er die mit dem Thema gegebenen
Kontraste nach heutigen Begriffen etwas zu
grell herausgearbeitet hat, so war er doch wohl
sicher, von den Menschen seiner Zeit richtig
verstanden zu werden. Bedenken wir, daß die
Kunst des Mittelalters nur ein Glied des großen
kirchlichen Lehrprogramms war, also eine päda-
gogische Tendenz haben sollte, so bleibt es
doch bemerkenswert, mit welcher geistigen
Freiheit der Meister des Magdeburger Portals
die künstlerischen Belange den Forderungen der
kirchlichen Doktrin überzuordnen gewußt hat.
Sein Gefühlsregister ist freilich nicht groß. Lust
und Leid geben sich ganz so, wie sie das naive
Gemüt beim Eintritt des gewünschten oder ge-
fürchteten Ereignisses empfindet und äußert.
Aber innerhalb dieser Verpflichtung auf das
Extrem —• welche Mannigfaltigkeit in der Sicht-
barmachung der Affekte! . . (schluss seite 286.)