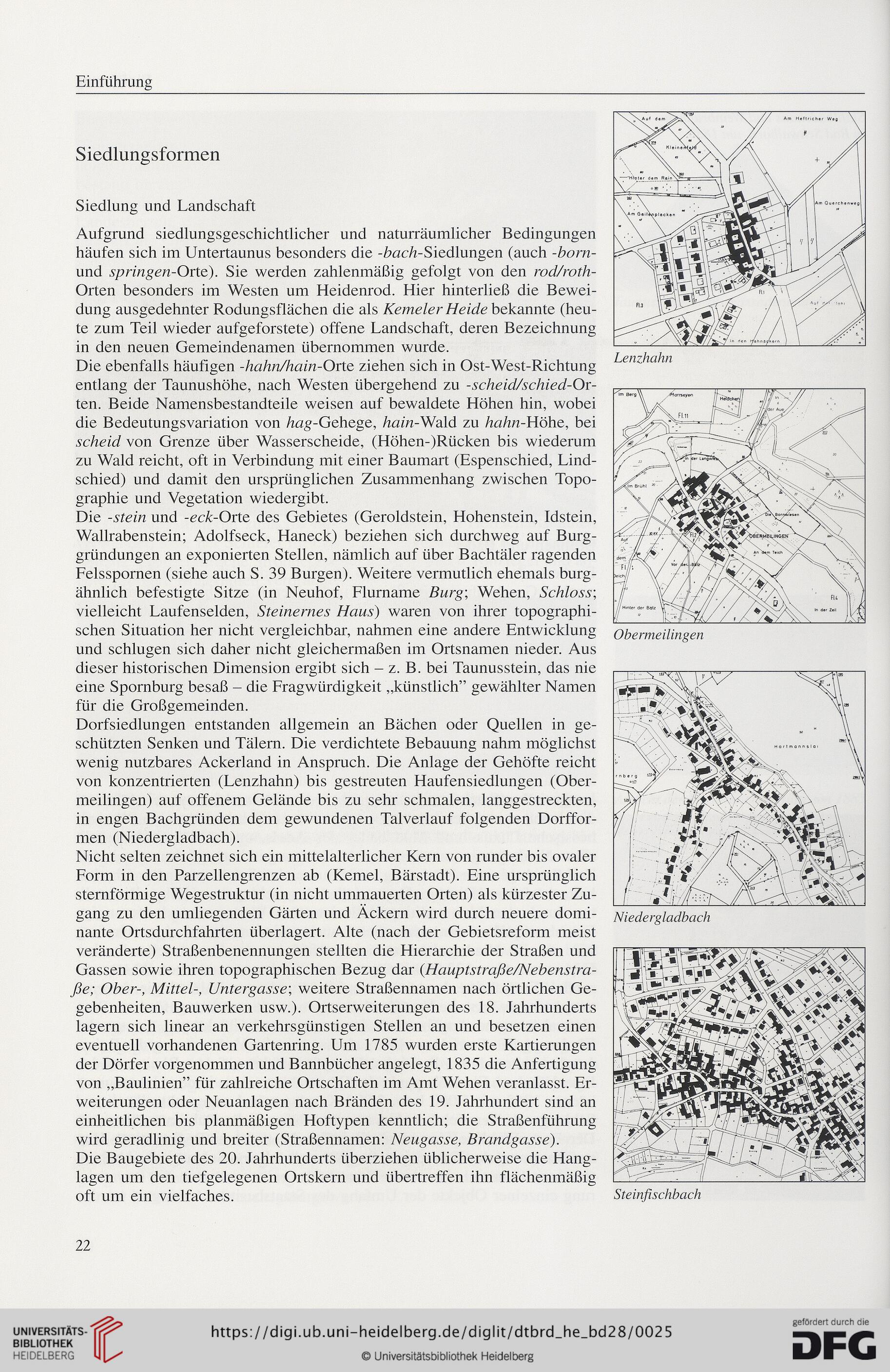Einführung
Siedlungsformen
Siedlung und Landschaft
Aufgrund siedlungsgeschichtlicher und naturräumlicher Bedingungen
häufen sich im Untertaunus besonders die -£>ac/z-Siedlungen (auch -born-
und springen-Orte). Sie werden zahlenmäßig gefolgt von den rod/roth-
Orten besonders im Westen um Heidenrod. Hier hinterließ die Bewei-
dung ausgedehnter Rodungsflächen die als Kemeler Heide bekannte (heu-
te zum Teil wieder aufgeforstete) offene Landschaft, deren Bezeichnung
in den neuen Gemeindenamen übernommen wurde.
Die ebenfalls häufigen -hahn/hain-Oxte ziehen sich in Ost-West-Richtung
entlang der Taunushöhe, nach Westen übergehend zu -scheid/schied-Qx-
ten. Beide Namensbestandteile weisen auf bewaldete Höhen hin, wobei
die Bedeutungsvariation von /zag-Gehege, /zam-Wald zu Tza/zn-Höhe, bei
scheid von Grenze über Wasserscheide, (Höhen-)Rücken bis wiederum
zu Wald reicht, oft in Verbindung mit einer Baumart (Espenschied, Lind-
schied) und damit den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Topo-
graphie und Vegetation wiedergibt.
Die -stein und -eck-Orte des Gebietes (Geroldstein, Hohenstein, Idstein,
Wallrabenstein; Adolfseck, Haneck) beziehen sich durchweg auf Burg-
gründungen an exponierten Stellen, nämlich auf über Bachtäler ragenden
Felsspornen (siehe auch S. 39 Burgen). Weitere vermutlich ehemals burg-
ähnlich befestigte Sitze (in Neuhof, Flurname Burg-, Wehen, Schloss-,
vielleicht Laufenselden, Steinernes Haus) waren von ihrer topographi-
schen Situation her nicht vergleichbar, nahmen eine andere Entwicklung
und schlugen sich daher nicht gleichermaßen im Ortsnamen nieder. Aus
dieser historischen Dimension ergibt sich - z. B. bei Taunusstein, das nie
eine Spornburg besaß - die Fragwürdigkeit „künstlich” gewählter Namen
für die Großgemeinden.
Dorfsiedlungen entstanden allgemein an Bächen oder Quellen in ge-
schützten Senken und Tälern. Die verdichtete Bebauung nahm möglichst
wenig nutzbares Ackerland in Anspruch. Die Anlage der Gehöfte reicht
von konzentrierten (Lenzhahn) bis gestreuten Haufensiedlungen (Ober-
meitingen) auf offenem Gelände bis zu sehr schmalen, langgestreckten,
in engen Bachgründen dem gewundenen Tal verlauf folgenden Dorffor-
men (Niedergladbach).
Nicht selten zeichnet sich ein mittelalterlicher Kern von runder bis ovaler
Form in den Parzellengrenzen ab (Kemel, Bärstadt). Eine ursprünglich
sternförmige Wegestruktur (in nicht ummauerten Orten) als kürzester Zu-
gang zu den umliegenden Gärten und Äckern wird durch neuere domi-
nante Ortsdurchfahrten überlagert. Alte (nach der Gebietsreform meist
veränderte) Straßenbenennungen stellten die Hierarchie der Straßen und
Gassen sowie ihren topographischen Bezug dar fiHauptstraße/Nebenstra-
ße; Ober-, Mittel-, Untergasse-, weitere Straßennamen nach örtlichen Ge-
gebenheiten, Bauwerken usw.). Ortserweiterungen des 18. Jahrhunderts
lagern sich linear an verkehrsgünstigen Stellen an und besetzen einen
eventuell vorhandenen Gartenring. Um 1785 wurden erste Kartierungen
der Dörfer vorgenommen und Bannbücher angelegt, 1835 die Anfertigung
von „Baulinien” für zahlreiche Ortschaften im Amt Wehen veranlasst. Er-
weiterungen oder Neuanlagen nach Bränden des 19. Jahrhundert sind an
einheitlichen bis planmäßigen Hoftypen kenntlich; die Straßenführung
wird geradlinig und breiter (Straßennamen: Neugasse, Brandgasse).
Die Baugebiete des 20. Jahrhunderts überziehen üblicherweise die Hang-
lagen um den tiefgelegenen Ortskern und übertreffen ihn flächenmäßig
oft um ein vielfaches.
Lenzhahn
Obermeitingen
Niedergladbach
Steinfischbach
22
Siedlungsformen
Siedlung und Landschaft
Aufgrund siedlungsgeschichtlicher und naturräumlicher Bedingungen
häufen sich im Untertaunus besonders die -£>ac/z-Siedlungen (auch -born-
und springen-Orte). Sie werden zahlenmäßig gefolgt von den rod/roth-
Orten besonders im Westen um Heidenrod. Hier hinterließ die Bewei-
dung ausgedehnter Rodungsflächen die als Kemeler Heide bekannte (heu-
te zum Teil wieder aufgeforstete) offene Landschaft, deren Bezeichnung
in den neuen Gemeindenamen übernommen wurde.
Die ebenfalls häufigen -hahn/hain-Oxte ziehen sich in Ost-West-Richtung
entlang der Taunushöhe, nach Westen übergehend zu -scheid/schied-Qx-
ten. Beide Namensbestandteile weisen auf bewaldete Höhen hin, wobei
die Bedeutungsvariation von /zag-Gehege, /zam-Wald zu Tza/zn-Höhe, bei
scheid von Grenze über Wasserscheide, (Höhen-)Rücken bis wiederum
zu Wald reicht, oft in Verbindung mit einer Baumart (Espenschied, Lind-
schied) und damit den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Topo-
graphie und Vegetation wiedergibt.
Die -stein und -eck-Orte des Gebietes (Geroldstein, Hohenstein, Idstein,
Wallrabenstein; Adolfseck, Haneck) beziehen sich durchweg auf Burg-
gründungen an exponierten Stellen, nämlich auf über Bachtäler ragenden
Felsspornen (siehe auch S. 39 Burgen). Weitere vermutlich ehemals burg-
ähnlich befestigte Sitze (in Neuhof, Flurname Burg-, Wehen, Schloss-,
vielleicht Laufenselden, Steinernes Haus) waren von ihrer topographi-
schen Situation her nicht vergleichbar, nahmen eine andere Entwicklung
und schlugen sich daher nicht gleichermaßen im Ortsnamen nieder. Aus
dieser historischen Dimension ergibt sich - z. B. bei Taunusstein, das nie
eine Spornburg besaß - die Fragwürdigkeit „künstlich” gewählter Namen
für die Großgemeinden.
Dorfsiedlungen entstanden allgemein an Bächen oder Quellen in ge-
schützten Senken und Tälern. Die verdichtete Bebauung nahm möglichst
wenig nutzbares Ackerland in Anspruch. Die Anlage der Gehöfte reicht
von konzentrierten (Lenzhahn) bis gestreuten Haufensiedlungen (Ober-
meitingen) auf offenem Gelände bis zu sehr schmalen, langgestreckten,
in engen Bachgründen dem gewundenen Tal verlauf folgenden Dorffor-
men (Niedergladbach).
Nicht selten zeichnet sich ein mittelalterlicher Kern von runder bis ovaler
Form in den Parzellengrenzen ab (Kemel, Bärstadt). Eine ursprünglich
sternförmige Wegestruktur (in nicht ummauerten Orten) als kürzester Zu-
gang zu den umliegenden Gärten und Äckern wird durch neuere domi-
nante Ortsdurchfahrten überlagert. Alte (nach der Gebietsreform meist
veränderte) Straßenbenennungen stellten die Hierarchie der Straßen und
Gassen sowie ihren topographischen Bezug dar fiHauptstraße/Nebenstra-
ße; Ober-, Mittel-, Untergasse-, weitere Straßennamen nach örtlichen Ge-
gebenheiten, Bauwerken usw.). Ortserweiterungen des 18. Jahrhunderts
lagern sich linear an verkehrsgünstigen Stellen an und besetzen einen
eventuell vorhandenen Gartenring. Um 1785 wurden erste Kartierungen
der Dörfer vorgenommen und Bannbücher angelegt, 1835 die Anfertigung
von „Baulinien” für zahlreiche Ortschaften im Amt Wehen veranlasst. Er-
weiterungen oder Neuanlagen nach Bränden des 19. Jahrhundert sind an
einheitlichen bis planmäßigen Hoftypen kenntlich; die Straßenführung
wird geradlinig und breiter (Straßennamen: Neugasse, Brandgasse).
Die Baugebiete des 20. Jahrhunderts überziehen üblicherweise die Hang-
lagen um den tiefgelegenen Ortskern und übertreffen ihn flächenmäßig
oft um ein vielfaches.
Lenzhahn
Obermeitingen
Niedergladbach
Steinfischbach
22