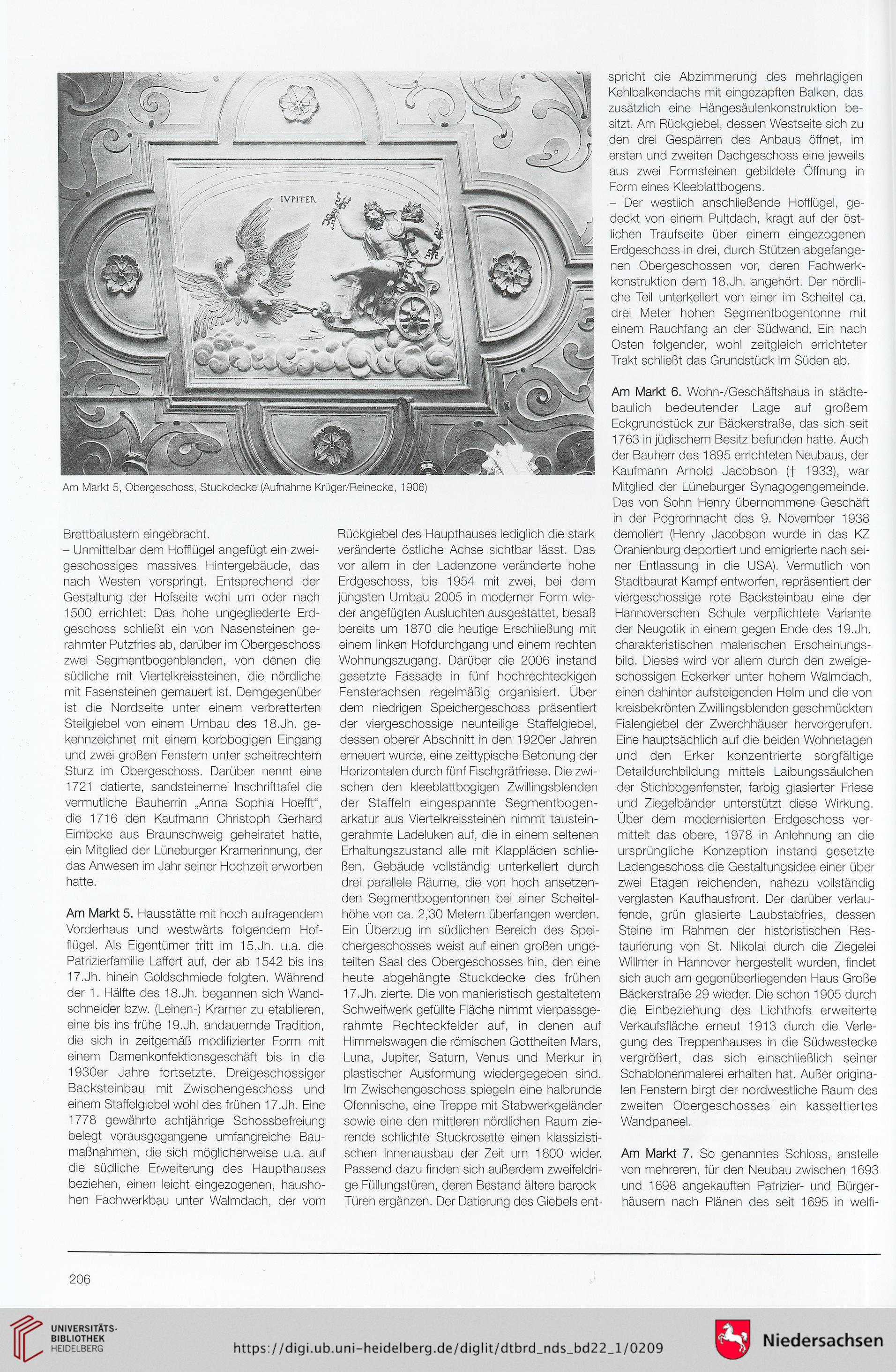Am Markt 5, Obergeschoss, Stuckdecke (Aufnahme Krüger/Reinecke, 1906)
Brettbalustern eingebracht.
- Unmittelbar dem Hofflügel angefügt ein zwei-
geschossiges massives Hintergebäude, das
nach Westen vorspringt. Entsprechend der
Gestaltung der Hofseite wohl um oder nach
1500 errichtet: Das hohe ungegliederte Erd-
geschoss schließt ein von Nasensteinen ge-
rahmter Putzfries ab, darüber im Obergeschoss
zwei Segmentbogenblenden, von denen die
südliche mit Viertelkreissteinen, die nördliche
mit Fasensteinen gemauert ist. Demgegenüber
ist die Nordseite unter einem verbreiterten
Steilgiebel von einem Umbau des 18.Jh. ge-
kennzeichnet mit einem korbbogigen Eingang
und zwei großen Fenstern unter scheitrechtem
Sturz im Obergeschoss. Darüber nennt eine
1721 datierte, sandsteinerne' Inschrifttafel die
vermutliche Bauherrin „Anna Sophia Hoefft“,
die 1716 den Kaufmann Christoph Gerhard
Eimbcke aus Braunschweig geheiratet hatte,
ein Mitglied der Lüneburger Kramerinnung, der
das Anwesen im Jahr seiner Hochzeit erworben
hatte.
Am Markt 5. Hausstätte mit hoch aufragendem
Vorderhaus und westwärts folgendem Hof-
flügel. Als Eigentümer tritt im 15.Jh. u.a. die
Patrizierfamilie Laffert auf, der ab 1542 bis ins
17.Jh. hinein Goldschmiede folgten. Während
der 1. Hälfte des 18.Jh. begannen sich Wand-
schneider bzw. (Leinen-) Kramer zu etablieren,
eine bis ins frühe 19.Jh. andauernde Tradition,
die sich in zeitgemäß modifizierter Form mit
einem Damenkonfektionsgeschäft bis in die
1930er Jahre fortsetzte. Dreigeschossiger
Backsteinbau mit Zwischengeschoss und
einem Staffelgiebel wohl des frühen 17. Jh. Eine
1778 gewährte achtjährige Schossbefreiung
belegt vorausgegangene umfangreiche Bau-
maßnahmen, die sich möglicherweise u.a. auf
die südliche Erweiterung des Haupthauses
beziehen, einen leicht eingezogenen, hausho-
hen Fachwerkbau unter Walmdach, der vom
Rückgiebel des Haupthauses lediglich die stark
veränderte östliche Achse sichtbar lässt. Das
vor allem in der Ladenzone veränderte hohe
Erdgeschoss, bis 1954 mit zwei, bei dem
jüngsten Umbau 2005 in moderner Form wie-
der angefügten Ausluchten ausgestattet, besaß
bereits um 1870 die heutige Erschließung mit
einem linken Hofdurchgang und einem rechten
Wohnungszugang. Darüber die 2006 instand
gesetzte Fassade in fünf hochrechteckigen
Fensterachsen regelmäßig organisiert. Über
dem niedrigen Speichergeschoss präsentiert
der viergeschossige neunteilige Staffelgiebel,
dessen oberer Abschnitt in den 1920er Jahren
erneuert wurde, eine zeittypische Betonung der
Horizontalen durch fünf Fischgrätfriese. Die zwi-
schen den kleeblattbogigen Zwillingsblenden
der Staffeln eingespannte Segmentbogen-
arkatur aus Viertelkreissteinen nimmt taustein-
gerahmte Ladeluken auf, die in einem seltenen
Erhaltungszustand alle mit Klappläden schlie-
ßen. Gebäude vollständig unterkellert durch
drei parallele Räume, die von hoch ansetzen-
den Segmentbogentonnen bei einer Scheitel-
höhe von ca. 2,30 Metern überfangen werden.
Ein Überzug im südlichen Bereich des Spei-
chergeschosses weist auf einen großen unge-
teilten Saal des Obergeschosses hin, den eine
heute abgehängte Stuckdecke des frühen
17. Jh. zierte. Die von manieristisch gestaltetem
Schweifwerk gefüllte Fläche nimmt vierpassge-
rahmte Rechteckfelder auf, in denen auf
Himmelswagen die römischen Gottheiten Mars,
Luna, Jupiter, Saturn, Venus und Merkur in
plastischer Ausformung wiedergegeben sind.
Im Zwischengeschoss spiegeln eine halbrunde
Ofennische, eine Treppe mit Stabwerkgeländer
sowie eine den mittleren nördlichen Raum zie-
rende schlichte Stuckrosette einen klassizisti-
schen Innenausbau der Zeit um 1800 wider.
Passend dazu finden sich außerdem zweifeldri-
ge Füllungstüren, deren Bestand ältere barock
Türen ergänzen. Der Datierung des Giebels ent-
spricht die Abzimmerung des mehrlagigen
Kehlbalkendachs mit eingezapften Balken, das
zusätzlich eine Hängesäulenkonstruktion be-
sitzt. Am Rückgiebel, dessen Westseite sich zu
den drei Gespärren des Anbaus öffnet, im
ersten und zweiten Dachgeschoss eine jeweils
aus zwei Formsteinen gebildete Öffnung in
Form eines Kleeblattbogens.
- Der westlich anschließende Hofflügel, ge-
deckt von einem Pultdach, kragt auf der öst-
lichen Traufseite über einem eingezogenen
Erdgeschoss in drei, durch Stützen abgefange-
nen Obergeschossen vor, deren Fachwerk-
konstruktion dem 18.Jh. angehört. Der nördli-
che Teil unterkellert von einer im Scheitel ca.
drei Meter hohen Segmentbogentonne mit
einem Rauchfang an der Südwand. Ein nach
Osten folgender, wohl zeitgleich errichteter
Trakt schließt das Grundstück im Süden ab.
Am Markt 6. Wohn-/Geschäftshaus in städte-
baulich bedeutender Lage auf großem
Eckgrundstück zur Bäckerstraße, das sich seit
1763 in jüdischem Besitz befunden hatte. Auch
der Bauherr des 1895 errichteten Neubaus, der
Kaufmann Arnold Jacobson (t 1933), war
Mitglied der Lüneburger Synagogengemeinde.
Das von Sohn Henry übernommene Geschäft
in der Pogromnacht des 9. November 1938
demoliert (Henry Jacobson wurde in das KZ
Oranienburg deportiert und emigrierte nach sei-
ner Entlassung in die USA). Vermutlich von
Stadtbaurat Kampf entworfen, repräsentiert der
viergeschossige rote Backsteinbau eine der
Hannoverschen Schule verpflichtete Variante
der Neugotik in einem gegen Ende des 19.Jh.
charakteristischen malerischen Erscheinungs-
bild. Dieses wird vor allem durch den zweige-
schossigen Eckerker unter hohem Walmdach,
einen dahinter aufsteigenden Helm und die von
kreisbekrönten Zwillingsblenden geschmückten
Fialengiebel der Zwerchhäuser hervorgerufen.
Eine hauptsächlich auf die beiden Wohnetagen
und den Erker konzentrierte sorgfältige
Detaildurchbildung mittels Laibungssäulchen
der Stichbogenfenster, farbig glasierter Friese
und Ziegelbänder unterstützt diese Wirkung.
Über dem modernisierten Erdgeschoss ver-
mittelt das obere, 1978 in Anlehnung an die
ursprüngliche Konzeption instand gesetzte
Ladengeschoss die Gestaltungsidee einer über
zwei Etagen reichenden, nahezu vollständig
verglasten Kaufhausfront. Der darüber verlau-
fende, grün glasierte Laubstabfries, dessen
Steine im Rahmen der historistischen Res-
taurierung von St. Nikolai durch die Ziegelei
Willmer in Hannover hergestellt wurden, findet
sich auch am gegenüberliegenden Haus Große
Bäckerstraße 29 wieder. Die schon 1905 durch
die Einbeziehung des Lichthofs erweiterte
Verkaufsfläche erneut 1913 durch die Verle-
gung des Treppenhauses in die Südwestecke
vergrößert, das sich einschließlich seiner
Schablonenmalerei erhalten hat. Außer origina-
len Fenstern birgt der nordwestliche Raum des
zweiten Obergeschosses ein kassettiertes
Wandpaneel.
Am Markt 7. So genanntes Schloss, anstelle
von mehreren, für den Neubau zwischen 1693
und 1698 angekauften Patrizier- und Bürger-
häusern nach Plänen des seit 1695 in welfi-
206