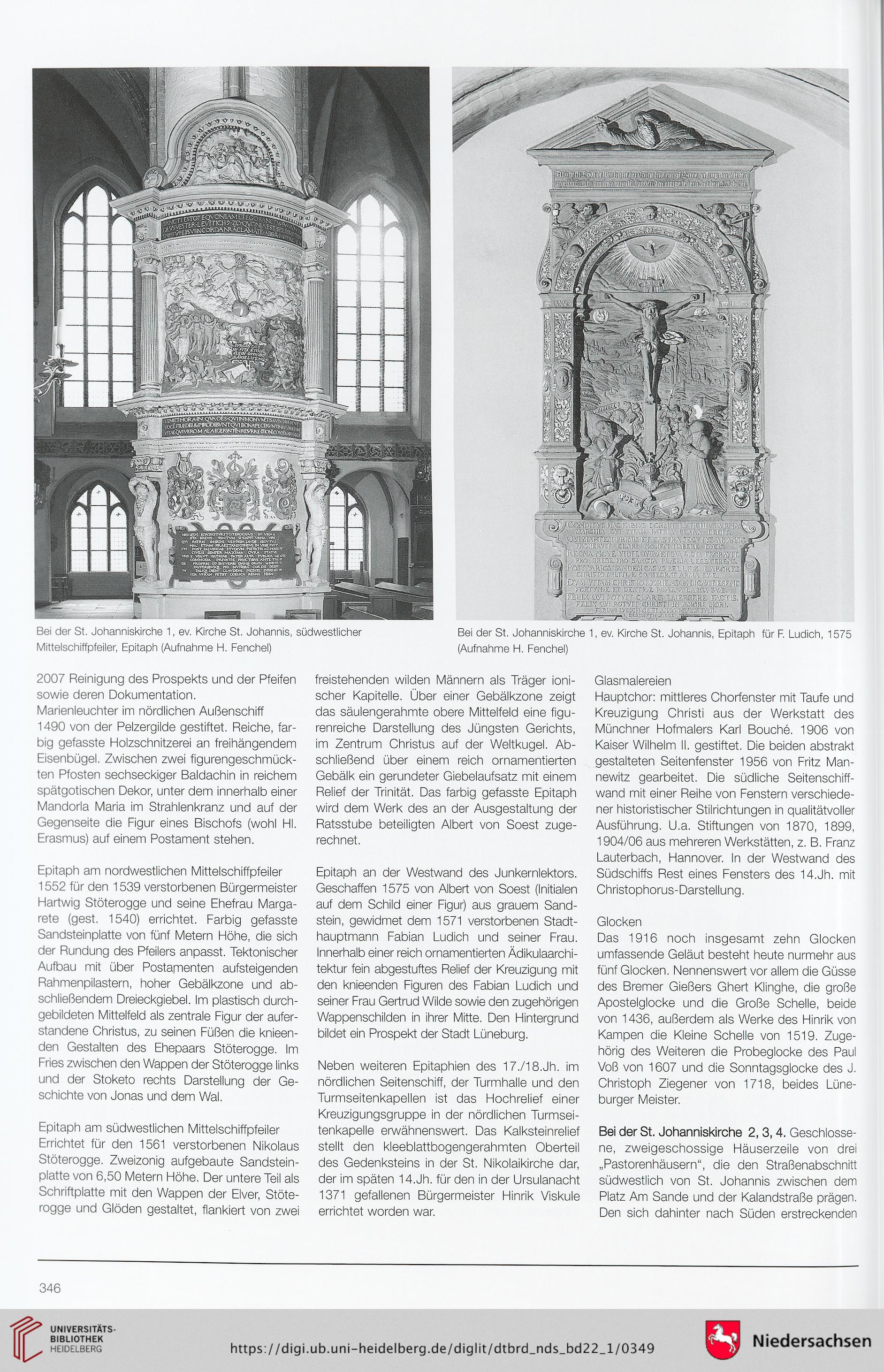Bei der St. Johanniskirche 1, ev. Kirche St. Johannis, südwestlicher
Mittelschiffpfeiler, Epitaph (Aufnahme H. Fenchel)
(A'Kxwrrv:: m?.arr wccfiiv; «fljjKj
OyjBAXiX.'.! I'MMIS r.T . ILLA 5£»fR Aß Ad ■'X
- - T-RO.'.T.RVIT Cl.AKI NöMfM HA’BE.KX CiVCl'.l. JT1
~ RT.CNA McAE. ymO!®8> £i '?A i’R<5BA'/lT.lm
ifSi w» oßfc'x :-ko sancta r:;.£i.i? i. xcr.iffAi;;. | ,y
• ‘i : -A •-JirULI' LAR.’■» ?C l'-4
• ifl CJnrWr.llU7IXC0NS£T.RAr A?.r.b\ JV/L. ■: 1
J 'D'/ .i os christo toiiENs® djcavitssem i I
« ."Ei' 71". ;■> i-? A . . ■ I.
' -I IX oy: iT'-yi'f CL ARIS SiiIARGRH!. KaCTS.
fxJJA (.:.'/l POT'/IT CHRISTI JM AMOR:'. MORI. I
7Ä2TAR1 L'/DICH 0877 A.'I.IO r/l:!. . I
Bei der St. Johanniskirche 1, ev. Kirche St. Johannis, Epitaph für F. Ludich, 1575
(Aufnahme H. Fenchel)
2007 Reinigung des Prospekts und der Pfeifen
sowie deren Dokumentation.
Marienleuchter im nördlichen Außenschiff
1490 von der Pelzergilde gestiftet. Reiche, far-
big gefasste Holzschnitzerei an freihängendem
Eisenbügel. Zwischen zwei figurengeschmück-
ten Pfosten sechseckiger Baldachin in reichem
spätgotischen Dekor, unter dem innerhalb einer
Mandorla Maria im Strahlenkranz und auf der
Gegenseite die Figur eines Bischofs (wohl Hl.
Erasmus) auf einem Postament stehen.
Epitaph am nordwestlichen Mittelschiffpfeiler
1552 für den 1539 verstorbenen Bürgermeister
Hartwig Stöterogge und seine Ehefrau Marga-
rete (gest. 1540) errichtet. Farbig gefasste
Sandsteinplatte von fünf Metern Höhe, die sich
der Rundung des Pfeilers anpasst. Tektonischer
Aufbau mit über Postamenten aufsteigenden
Rahmenpilastern, hoher Gebälkzone und ab-
schließendem Dreieckgiebel. Im plastisch durch-
gebildeten Mittelfeld als zentrale Figur der aufer-
standene Christus, zu seinen Füßen die knieen-
den Gestalten des Ehepaars Stöterogge. Im
Fries zwischen den Wappen der Stöterogge links
und der Stoketo rechts Darstellung der Ge-
schichte von Jonas und dem Wal.
Epitaph am südwestlichen Mittelschiffpfeiler
Errichtet für den 1561 verstorbenen Nikolaus
Stöterogge. Zweizonig aufgebaute Sandstein-
platte von 6,50 Metern Höhe. Der untere Teil als
Schriftplatte mit den Wappen der Elver, Stöte-
rogge und Glöden gestaltet, flankiert von zwei
freistehenden wilden Männern als Träger ioni-
scher Kapitelle. Über einer Gebälkzone zeigt
das säulengerahmte obere Mittelfeld eine figu-
renreiche Darstellung des Jüngsten Gerichts,
im Zentrum Christus auf der Weltkugel. Ab-
schließend über einem reich ornamentierten
Gebälk ein gerundeter Giebelaufsatz mit einem
Relief der Trinität. Das farbig gefasste Epitaph
wird dem Werk des an der Ausgestaltung der
Ratsstube beteiligten Albert von Soest zuge-
rechnet.
Epitaph an der Westwand des Junkernlektors.
Geschaffen 1575 von Albert von Soest (Initialen
auf dem Schild einer Figur) aus grauem Sand-
stein, gewidmet dem 1571 verstorbenen Stadt-
hauptmann Fabian Ludich und seiner Frau,
innerhalb einer reich ornamentierten Ädikulaarchi-
tektur fein abgestuftes Relief der Kreuzigung mit
den knieenden Figuren des Fabian Ludich und
seiner Frau Gertrud Wilde sowie den zugehörigen
Wappenschilden in ihrer Mitte. Den Hintergrund
bildet ein Prospekt der Stadt Lüneburg.
Neben weiteren Epitaphien des 17./18.Jh. im
nördlichen Seitenschiff, der Turmhalle und den
Turmseitenkapellen ist das Hochrelief einer
Kreuzigungsgruppe in der nördlichen Turmsei-
tenkapelle erwähnenswert. Das Kalksteinrelief
stellt den kleeblattbogengerahmten Oberteil
des Gedenksteins in der St. Nikolaikirche dar,
der im späten 14.Jh. für den in der Ursulanacht
1371 gefallenen Bürgermeister Hinrik Viskule
errichtet worden war.
Glasmalereien
Hauptchor: mittleres Chorfenster mit Taufe und
Kreuzigung Christi aus der Werkstatt des
Münchner Hofmalers Karl Bouche. 1906 von
Kaiser Wilhelm II. gestiftet. Die beiden abstrakt
gestalteten Seitenfenster 1956 von Fritz Man-
newitz gearbeitet. Die südliche Seitenschiff-
wand mit einer Reihe von Fenstern verschiede-
ner historistischer Stilrichtungen in qualitätvoller
Ausführung. U.a. Stiftungen von 1870, 1899,
1904/06 aus mehreren Werkstätten, z. B. Franz
Lauterbach, Hannover. In der Westwand des
Südschiffs Rest eines Fensters des 14.Jh. mit
Christophorus-Darstellung.
Glocken
Das 1916 noch insgesamt zehn Glocken
umfassende Geläut besteht heute nurmehr aus
fünf Glocken. Nennenswert vor allem die Güsse
des Bremer Gießers Ghert Klinghe, die große
Apostelglocke und die Große Schelle, beide
von 1436, außerdem als Werke des Hinrik von
Kämpen die Kleine Schelle von 1519. Zuge-
hörig des Weiteren die Probeglocke des Paul
Voß von 1607 und die Sonntagsglocke des J.
Christoph Ziegener von 1718, beides Lüne-
burger Meister.
Bei der St. Johanniskirche 2, 3, 4. Geschlosse-
ne, zweigeschossige Häuserzeile von drei
„Pastorenhäusern“, die den Straßenabschnitt
südwestlich von St. Johannis zwischen dem
Platz Am Sande und der Kalandstraße prägen.
Den sich dahinter nach Süden erstreckenden
346