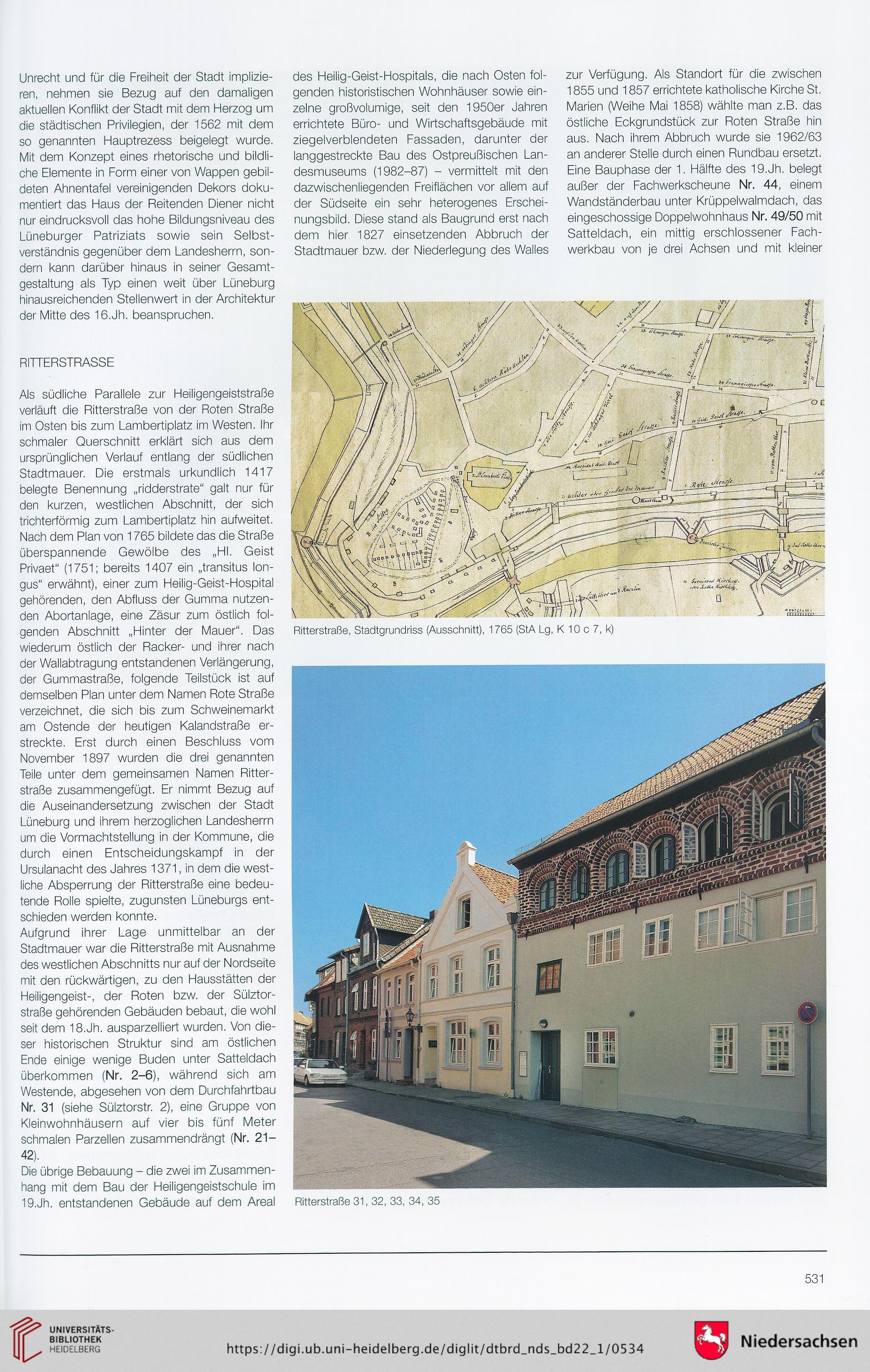Unrecht und für die Freiheit der Stadt implizie-
ren, nehmen sie Bezug auf den damaligen
aktuellen Konflikt der Stadt mit dem Herzog um
die städtischen Privilegien, der 1562 mit dem
so genannten Hauptrezess beigelegt wurde.
Mit dem Konzept eines rhetorische und bildli-
che Elemente in Form einer von Wappen gebil-
deten Ahnentafel vereinigenden Dekors doku-
mentiert das Haus der Reitenden Diener nicht
nur eindrucksvoll das hohe Bildungsniveau des
Lüneburger Patriziats sowie sein Selbst-
verständnis gegenüber dem Landesherrn, son-
dern kann darüber hinaus in seiner Gesamt-
gestaltung als Typ einen weit über Lüneburg
hinausreichenden Stellenwert in der Architektur
der Mitte des 16.Jh. beanspruchen.
RITTERSTRASSE
Als südliche Parallele zur Heiligengeiststraße
verläuft die Ritterstraße von der Roten Straße
im Osten bis zum Lambertiplatz im Westen. Ihr
schmaler Querschnitt erklärt sich aus dem
ursprünglichen Verlauf entlang der südlichen
Stadtmauer. Die erstmals urkundlich 1417
belegte Benennung „ridderstrate“ galt nur für
den kurzen, westlichen Abschnitt, der sich
trichterförmig zum Lambertiplatz hin aufweitet.
Nach dem Plan von 1765 bildete das die Straße
überspannende Gewölbe des „Hl. Geist
Privaet“ (1751; bereits 1407 ein „transitus lon-
gus“ erwähnt), einer zum Heilig-Geist-Hospital
gehörenden, den Abfluss der Gumma nutzen-
den Abortanlage, eine Zäsur zum östlich fol-
genden Abschnitt „Hinter der Mauer“. Das
wiederum östlich der Racker- und ihrer nach
der Wallabtragung entstandenen Verlängerung,
der Gummastraße, folgende Teilstück ist auf
demselben Plan unter dem Namen Rote Straße
verzeichnet, die sich bis zum Schweinemarkt
am Ostende der heutigen Kalandstraße er-
streckte. Erst durch einen Beschluss vom
November 1897 wurden die drei genannten
Teile unter dem gemeinsamen Namen Ritter-
straße zusammengefügt. Er nimmt Bezug auf
die Auseinandersetzung zwischen der Stadt
Lüneburg und ihrem herzoglichen Landesherrn
um die Vormachtstellung in der Kommune, die
durch einen Entscheidungskampf in der
Ursulanacht des Jahres 1371, in dem die west-
liche Absperrung der Ritterstraße eine bedeu-
tende Rolle spielte, zugunsten Lüneburgs ent-
schieden werden konnte.
Aufgrund ihrer Lage unmittelbar an der
Stadtmauer war die Ritterstraße mit Ausnahme
des westlichen Abschnitts nur auf der Nordseite
mit den rückwärtigen, zu den Hausstätten der
Heiligengeist-, der Roten bzw. der Sülztor-
straße gehörenden Gebäuden bebaut, die wohl
seit dem 18.Jh. ausparzelliert wurden. Von die-
ser historischen Struktur sind am östlichen
Ende einige wenige Buden unter Satteldach
überkommen (Nr. 2-6), während sich am
Westende, abgesehen von dem Durchfahrtbau
Nr. 31 (siehe Sülztorstr. 2), eine Gruppe von
Kleinwohnhäusern auf vier bis fünf Meter
schmalen Parzellen zusammendrängt (Nr. 21-
42).
Die übrige Bebauung - die zwei im Zusammen-
hang mit dem Bau der Heiligengeistschule im
19.Jh. entstandenen Gebäude auf dem Areal
des Heilig-Geist-Hospitals, die nach Osten fol-
genden historistischen Wohnhäuser sowie ein-
zelne großvolumige, seit den 1950er Jahren
errichtete Büro- und Wirtschaftsgebäude mit
ziegelverblendeten Fassaden, darunter der
langgestreckte Bau des Ostpreußischen Lan-
desmuseums (1982-87) - vermittelt mit den
dazwischenliegenden Freiflächen vor allem auf
der Südseite ein sehr heterogenes Erschei-
nungsbild. Diese stand als Baugrund erst nach
dem hier 1827 einsetzenden Abbruch der
Stadtmauer bzw. der Niederlegung des Walles
zur Verfügung. Als Standort für die zwischen
1855 und 1857 errichtete katholische Kirche St.
Marien (Weihe Mai 1858) wählte man z.B. das
östliche Eckgrundstück zur Roten Straße hin
aus. Nach ihrem Abbruch wurde sie 1962/63
an anderer Stelle durch einen Rundbau ersetzt.
Eine Bauphase der 1. Hälfte des 19.Jh. belegt
außer der Fachwerkscheune Nr. 44, einem
Wandständerbau unter Krüppelwalmdach, das
eingeschossige Doppelwohnhaus Nr. 49/50 mit
Satteldach, ein mittig erschlossener Fach-
werkbau von je drei Achsen und mit kleiner
Ritterstraße, Stadtgrundriss (Ausschnitt), 1765 (StA Lg, K 10 c 7, k)
Ritterstraße 31,32, 33, 34, 35
531
ren, nehmen sie Bezug auf den damaligen
aktuellen Konflikt der Stadt mit dem Herzog um
die städtischen Privilegien, der 1562 mit dem
so genannten Hauptrezess beigelegt wurde.
Mit dem Konzept eines rhetorische und bildli-
che Elemente in Form einer von Wappen gebil-
deten Ahnentafel vereinigenden Dekors doku-
mentiert das Haus der Reitenden Diener nicht
nur eindrucksvoll das hohe Bildungsniveau des
Lüneburger Patriziats sowie sein Selbst-
verständnis gegenüber dem Landesherrn, son-
dern kann darüber hinaus in seiner Gesamt-
gestaltung als Typ einen weit über Lüneburg
hinausreichenden Stellenwert in der Architektur
der Mitte des 16.Jh. beanspruchen.
RITTERSTRASSE
Als südliche Parallele zur Heiligengeiststraße
verläuft die Ritterstraße von der Roten Straße
im Osten bis zum Lambertiplatz im Westen. Ihr
schmaler Querschnitt erklärt sich aus dem
ursprünglichen Verlauf entlang der südlichen
Stadtmauer. Die erstmals urkundlich 1417
belegte Benennung „ridderstrate“ galt nur für
den kurzen, westlichen Abschnitt, der sich
trichterförmig zum Lambertiplatz hin aufweitet.
Nach dem Plan von 1765 bildete das die Straße
überspannende Gewölbe des „Hl. Geist
Privaet“ (1751; bereits 1407 ein „transitus lon-
gus“ erwähnt), einer zum Heilig-Geist-Hospital
gehörenden, den Abfluss der Gumma nutzen-
den Abortanlage, eine Zäsur zum östlich fol-
genden Abschnitt „Hinter der Mauer“. Das
wiederum östlich der Racker- und ihrer nach
der Wallabtragung entstandenen Verlängerung,
der Gummastraße, folgende Teilstück ist auf
demselben Plan unter dem Namen Rote Straße
verzeichnet, die sich bis zum Schweinemarkt
am Ostende der heutigen Kalandstraße er-
streckte. Erst durch einen Beschluss vom
November 1897 wurden die drei genannten
Teile unter dem gemeinsamen Namen Ritter-
straße zusammengefügt. Er nimmt Bezug auf
die Auseinandersetzung zwischen der Stadt
Lüneburg und ihrem herzoglichen Landesherrn
um die Vormachtstellung in der Kommune, die
durch einen Entscheidungskampf in der
Ursulanacht des Jahres 1371, in dem die west-
liche Absperrung der Ritterstraße eine bedeu-
tende Rolle spielte, zugunsten Lüneburgs ent-
schieden werden konnte.
Aufgrund ihrer Lage unmittelbar an der
Stadtmauer war die Ritterstraße mit Ausnahme
des westlichen Abschnitts nur auf der Nordseite
mit den rückwärtigen, zu den Hausstätten der
Heiligengeist-, der Roten bzw. der Sülztor-
straße gehörenden Gebäuden bebaut, die wohl
seit dem 18.Jh. ausparzelliert wurden. Von die-
ser historischen Struktur sind am östlichen
Ende einige wenige Buden unter Satteldach
überkommen (Nr. 2-6), während sich am
Westende, abgesehen von dem Durchfahrtbau
Nr. 31 (siehe Sülztorstr. 2), eine Gruppe von
Kleinwohnhäusern auf vier bis fünf Meter
schmalen Parzellen zusammendrängt (Nr. 21-
42).
Die übrige Bebauung - die zwei im Zusammen-
hang mit dem Bau der Heiligengeistschule im
19.Jh. entstandenen Gebäude auf dem Areal
des Heilig-Geist-Hospitals, die nach Osten fol-
genden historistischen Wohnhäuser sowie ein-
zelne großvolumige, seit den 1950er Jahren
errichtete Büro- und Wirtschaftsgebäude mit
ziegelverblendeten Fassaden, darunter der
langgestreckte Bau des Ostpreußischen Lan-
desmuseums (1982-87) - vermittelt mit den
dazwischenliegenden Freiflächen vor allem auf
der Südseite ein sehr heterogenes Erschei-
nungsbild. Diese stand als Baugrund erst nach
dem hier 1827 einsetzenden Abbruch der
Stadtmauer bzw. der Niederlegung des Walles
zur Verfügung. Als Standort für die zwischen
1855 und 1857 errichtete katholische Kirche St.
Marien (Weihe Mai 1858) wählte man z.B. das
östliche Eckgrundstück zur Roten Straße hin
aus. Nach ihrem Abbruch wurde sie 1962/63
an anderer Stelle durch einen Rundbau ersetzt.
Eine Bauphase der 1. Hälfte des 19.Jh. belegt
außer der Fachwerkscheune Nr. 44, einem
Wandständerbau unter Krüppelwalmdach, das
eingeschossige Doppelwohnhaus Nr. 49/50 mit
Satteldach, ein mittig erschlossener Fach-
werkbau von je drei Achsen und mit kleiner
Ritterstraße, Stadtgrundriss (Ausschnitt), 1765 (StA Lg, K 10 c 7, k)
Ritterstraße 31,32, 33, 34, 35
531