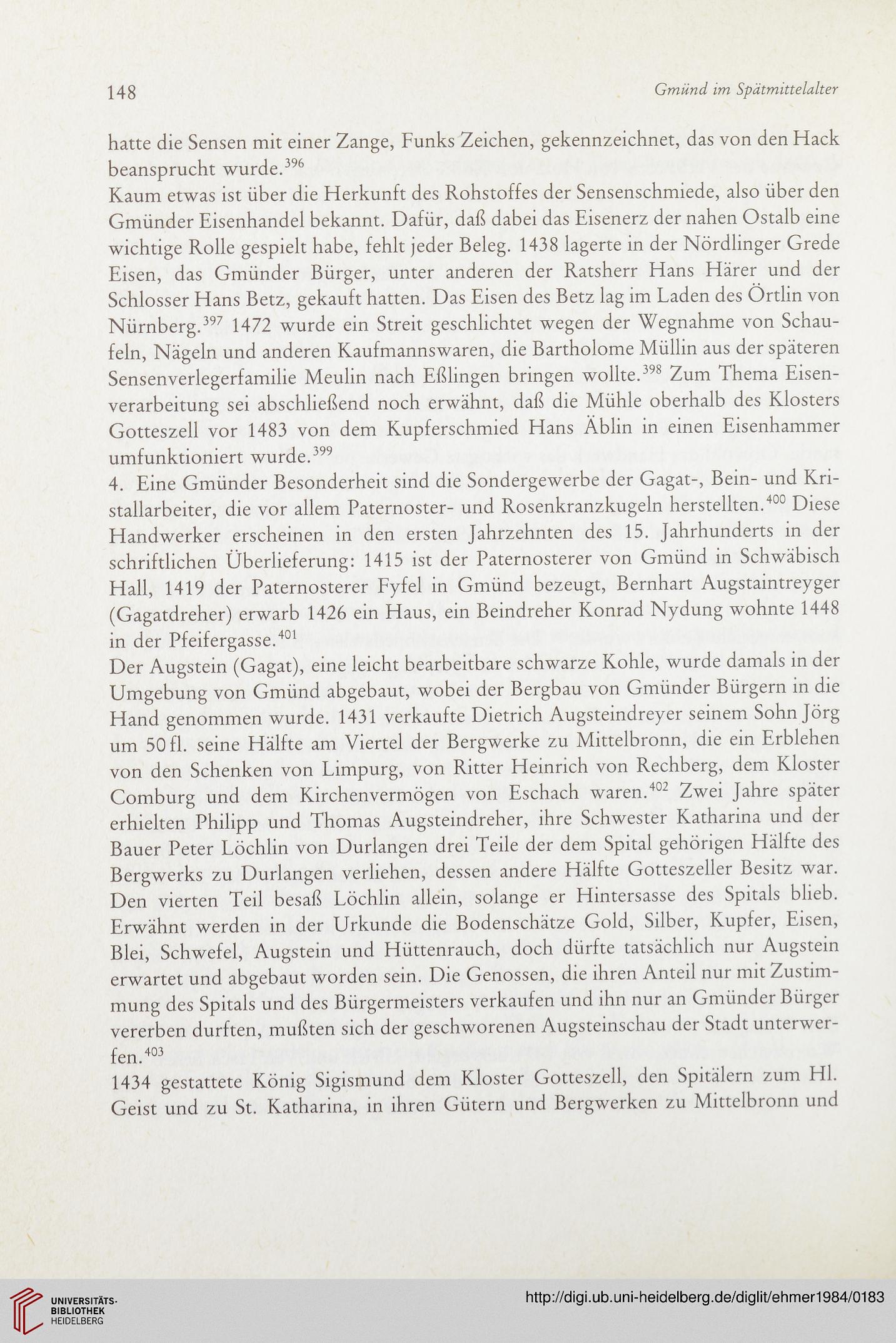148
Gmünd, im Spätmittelalter
hatte die Sensen mit einer Zange, Funks Zeichen, gekennzeichnet, das von den Hack
beansprucht wurde.396
Kaum etwas ist über die Herkunft des Rohstoffes der Sensenschmiede, also über den
Gmünder Eisenhandel bekannt. Dafür, daß dabei das Eisenerz der nahen Ostalb eine
wichtige Rolle gespielt habe, fehlt jeder Beleg. 1438 lagerte in der Nördlinger Grede
Eisen, das Gmünder Bürger, unter anderen der Ratsherr Hans Härer und der
Schlosser Hans Betz, gekauft hatten. Das Eisen des Betz lag im Laden des Örtlin von
Nürnberg.397 1 4 72 wurde ein Streit geschlichtet wegen der Wegnahme von Schau-
feln, Nägeln und anderen Kaufmannswaren, die Bartholome Müllin aus der späteren
Sensenverlegerfamilie Meulin nach Eßlingen bringen wollte.398 Zum Thema Eisen-
verarbeitung sei abschließend noch erwähnt, daß die Mühle oberhalb des Klosters
Gotteszell vor 1483 von dem Kupferschmied Hans Ablin in einen Eisenhammer
umfunktioniert wurde.399
4. Eine Gmünder Besonderheit sind die Sondergewerbe der Gagat-, Bein- und Kri-
stallarbeiter, die vor allem Paternoster- und Rosenkranzkugeln herstellten.400 Diese
Handwerker erscheinen in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in der
schriftlichen Überlieferung: 1415 ist der Paternosterer von Gmünd in Schwäbisch
Hall, 1419 der Paternosterer Fyfel in Gmünd bezeugt, Bernhart Augstaintreyger
(Gagatdreher) erwarb 1426 ein Haus, ein Beindreher Konrad Nydung wohnte 1448
in der Pfeifergasse.401
Der Augstein (Gagat), eine leicht bearbeitbare schwarze Kohle, wurde damals in der
Umgebung von Gmünd abgebaut, wobei der Bergbau von Gmünder Bürgern in die
Hand genommen wurde. 1431 verkaufte Dietrich Augsteindreyer seinem Sohn Jörg
um 50 fl. seine Hälfte am Viertel der Bergwerke zu Mittelbronn, die ein Erblehen
von den Schenken von Limpurg, von Ritter Heinrich von Rechberg, dem Kloster
Comburg und dem Kirchenvermögen von Eschach waren.402 Zwei Jahre später
erhielten Philipp und Thomas Augsteindreher, ihre Schwester Katharina und der
Bauer Peter Löchlin von Durlangen drei Teile der dem Spital gehörigen Hälfte des
Bergwerks zu Durlangen verliehen, dessen andere Hälfte Gotteszeller Besitz war.
Den vierten Teil besaß Löchlin allein, solange er Hintersasse des Spitals blieb.
Erwähnt werden in der Urkunde die Bodenschätze Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
Blei, Schwefel, Augstein und Hüttenrauch, doch dürfte tatsächlich nur Augstein
erwartet und abgebaut worden sein. Die Genossen, die ihren Anteil nur mit Zustim-
mung des Spitals und des Bürgermeisters verkaufen und ihn nur an Gmünder Bürger
vererben durften, mußten sich der geschworenen Augsteinschau der Stadt unterwer-
fen.403
1434 gestattete König Sigismund dem Kloster Gotteszell, den Spitälern zum Hl.
Geist und zu St. Katharina, in ihren Gütern und Bergwerken zu Mittelbronn und
Gmünd, im Spätmittelalter
hatte die Sensen mit einer Zange, Funks Zeichen, gekennzeichnet, das von den Hack
beansprucht wurde.396
Kaum etwas ist über die Herkunft des Rohstoffes der Sensenschmiede, also über den
Gmünder Eisenhandel bekannt. Dafür, daß dabei das Eisenerz der nahen Ostalb eine
wichtige Rolle gespielt habe, fehlt jeder Beleg. 1438 lagerte in der Nördlinger Grede
Eisen, das Gmünder Bürger, unter anderen der Ratsherr Hans Härer und der
Schlosser Hans Betz, gekauft hatten. Das Eisen des Betz lag im Laden des Örtlin von
Nürnberg.397 1 4 72 wurde ein Streit geschlichtet wegen der Wegnahme von Schau-
feln, Nägeln und anderen Kaufmannswaren, die Bartholome Müllin aus der späteren
Sensenverlegerfamilie Meulin nach Eßlingen bringen wollte.398 Zum Thema Eisen-
verarbeitung sei abschließend noch erwähnt, daß die Mühle oberhalb des Klosters
Gotteszell vor 1483 von dem Kupferschmied Hans Ablin in einen Eisenhammer
umfunktioniert wurde.399
4. Eine Gmünder Besonderheit sind die Sondergewerbe der Gagat-, Bein- und Kri-
stallarbeiter, die vor allem Paternoster- und Rosenkranzkugeln herstellten.400 Diese
Handwerker erscheinen in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in der
schriftlichen Überlieferung: 1415 ist der Paternosterer von Gmünd in Schwäbisch
Hall, 1419 der Paternosterer Fyfel in Gmünd bezeugt, Bernhart Augstaintreyger
(Gagatdreher) erwarb 1426 ein Haus, ein Beindreher Konrad Nydung wohnte 1448
in der Pfeifergasse.401
Der Augstein (Gagat), eine leicht bearbeitbare schwarze Kohle, wurde damals in der
Umgebung von Gmünd abgebaut, wobei der Bergbau von Gmünder Bürgern in die
Hand genommen wurde. 1431 verkaufte Dietrich Augsteindreyer seinem Sohn Jörg
um 50 fl. seine Hälfte am Viertel der Bergwerke zu Mittelbronn, die ein Erblehen
von den Schenken von Limpurg, von Ritter Heinrich von Rechberg, dem Kloster
Comburg und dem Kirchenvermögen von Eschach waren.402 Zwei Jahre später
erhielten Philipp und Thomas Augsteindreher, ihre Schwester Katharina und der
Bauer Peter Löchlin von Durlangen drei Teile der dem Spital gehörigen Hälfte des
Bergwerks zu Durlangen verliehen, dessen andere Hälfte Gotteszeller Besitz war.
Den vierten Teil besaß Löchlin allein, solange er Hintersasse des Spitals blieb.
Erwähnt werden in der Urkunde die Bodenschätze Gold, Silber, Kupfer, Eisen,
Blei, Schwefel, Augstein und Hüttenrauch, doch dürfte tatsächlich nur Augstein
erwartet und abgebaut worden sein. Die Genossen, die ihren Anteil nur mit Zustim-
mung des Spitals und des Bürgermeisters verkaufen und ihn nur an Gmünder Bürger
vererben durften, mußten sich der geschworenen Augsteinschau der Stadt unterwer-
fen.403
1434 gestattete König Sigismund dem Kloster Gotteszell, den Spitälern zum Hl.
Geist und zu St. Katharina, in ihren Gütern und Bergwerken zu Mittelbronn und