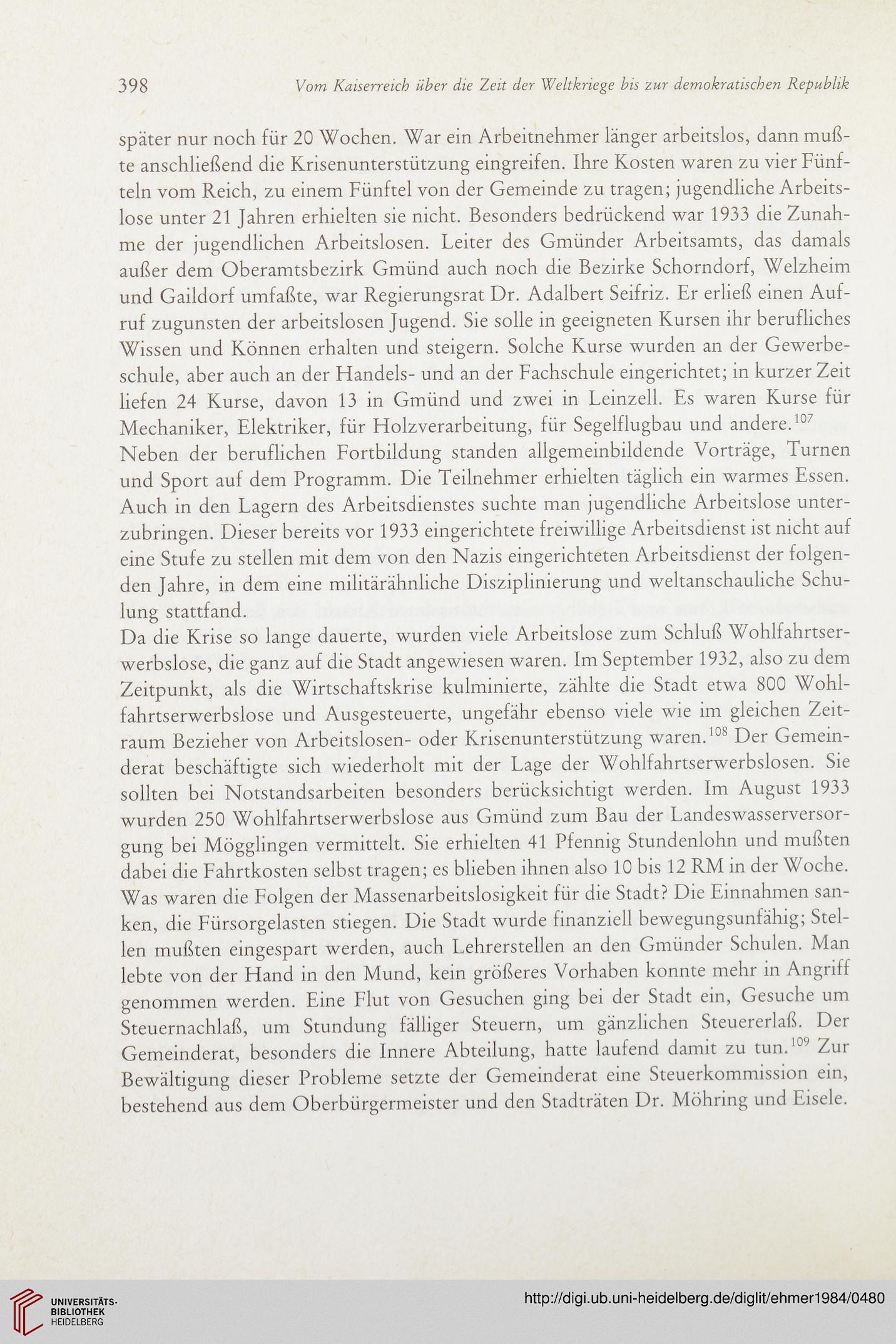398
Vom Kaiserreich über die Zeit der Weltkriege bis zur demokratischen Republik
später nur noch für 20 Wochen. War ein Arbeitnehmer länger arbeitslos, dann muß-
te anschließend die Krisenunterstützung eingreifen. Ihre Kosten waren zu vier Fünf-
teln vom Reich, zu einem Fünftel von der Gemeinde zu tragen; jugendliche Arbeits-
lose unter 21 Jahren erhielten sie nicht. Besonders bedrückend war 1933 die Zunah-
me der jugendlichen Arbeitslosen. Leiter des Gmünder Arbeitsamts, das damals
außer dem Oberamtsbezirk Gmünd auch noch die Bezirke Schorndorf, Welzheim
und Gaildorf umfaßte, war Regierungsrat Dr. Adalbert Seifriz. Er erließ einen Auf-
ruf zugunsten der arbeitslosen Jugend. Sie solle in geeigneten Kursen ihr berufliches
Wissen und Können erhalten und steigern. Solche Kurse wurden an der Gewerbe-
schule, aber auch an der Handels- und an der Fachschule eingerichtet; in kurzer Zeit
liefen 24 Kurse, davon 13 in Gmünd und zwei in Leinzell. Es waren Kurse für
Mechaniker, Elektriker, für Holzverarbeitung, für Segelflugbau und andere.107
Neben der beruflichen Fortbildung standen allgemeinbildende Vorträge, Turnen
und Sport auf dem Programm. Die Teilnehmer erhielten täglich ein warmes Essen.
Auch in den Lagern des Arbeitsdienstes suchte man jugendliche Arbeitslose unter-
zubringen. Dieser bereits vor 1933 eingerichtete freiwillige Arbeitsdienst ist nicht auf
eine Stufe zu stellen mit dem von den Nazis eingerichteten Arbeitsdienst der folgen-
den Jahre, in dem eine militärähnliche Disziplinierung und weltanschauliche Schu-
lung stattfand.
Da die Krise so lange dauerte, wurden viele Arbeitslose zum Schluß Wohlfahrtser-
werbslose, die ganz auf die Stadt angewiesen waren. Im September 1932, also zu dem
Zeitpunkt, als die Wirtschaftskrise kulminierte, zählte die Stadt etwa 800 Wohl-
fahrtserwerbslose und Ausgesteuerte, ungefähr ebenso viele wie im gleichen Zeit-
raum Bezieher von Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung waren.108 Der Gemein-
derat beschäftigte sich wiederholt mit der Lage der Wohlfahrtserwerbslosen. Sie
sollten bei Notstandsarbeiten besonders berücksichtigt werden. Im August 1933
wurden 250 Wohlfahrtserwerbslose aus Gmünd zum Bau der Landeswasserversor-
gung bei Mögglingen vermittelt. Sie erhielten 41 Pfennig Stundenlohn und mußten
dabei die Fahrtkosten selbst tragen; es blieben ihnen also 10 bis 12 RM in der Woche.
Was waren die Folgen der Massenarbeitslosigkeit für die Stadt? Die Einnahmen san-
ken, die Fürsorgelasten stiegen. Die Stadt wurde finanziell bewegungsunfähig; Stel-
len mußten eingespart werden, auch Lehrerstellen an den Gmünder Schulen. Man
lebte von der Hand in den Mund, kein größeres Vorhaben konnte mehr in Angriff
genommen werden. Eine Flut von Gesuchen ging bei der Stadt ein, Gesuche um
Steuernachlaß, um Stundung fälliger Steuern, um gänzlichen Steuererlaß. Der
Gemeinderat, besonders die Innere Abteilung, hatte laufend damit zu tun.109 Zur
Bewältigung dieser Probleme setzte der Gemeinderat eine Steuerkommission ein,
bestehend aus dem Oberbürgermeister und den Stadträten Dr. Möhring und Eisele.
Vom Kaiserreich über die Zeit der Weltkriege bis zur demokratischen Republik
später nur noch für 20 Wochen. War ein Arbeitnehmer länger arbeitslos, dann muß-
te anschließend die Krisenunterstützung eingreifen. Ihre Kosten waren zu vier Fünf-
teln vom Reich, zu einem Fünftel von der Gemeinde zu tragen; jugendliche Arbeits-
lose unter 21 Jahren erhielten sie nicht. Besonders bedrückend war 1933 die Zunah-
me der jugendlichen Arbeitslosen. Leiter des Gmünder Arbeitsamts, das damals
außer dem Oberamtsbezirk Gmünd auch noch die Bezirke Schorndorf, Welzheim
und Gaildorf umfaßte, war Regierungsrat Dr. Adalbert Seifriz. Er erließ einen Auf-
ruf zugunsten der arbeitslosen Jugend. Sie solle in geeigneten Kursen ihr berufliches
Wissen und Können erhalten und steigern. Solche Kurse wurden an der Gewerbe-
schule, aber auch an der Handels- und an der Fachschule eingerichtet; in kurzer Zeit
liefen 24 Kurse, davon 13 in Gmünd und zwei in Leinzell. Es waren Kurse für
Mechaniker, Elektriker, für Holzverarbeitung, für Segelflugbau und andere.107
Neben der beruflichen Fortbildung standen allgemeinbildende Vorträge, Turnen
und Sport auf dem Programm. Die Teilnehmer erhielten täglich ein warmes Essen.
Auch in den Lagern des Arbeitsdienstes suchte man jugendliche Arbeitslose unter-
zubringen. Dieser bereits vor 1933 eingerichtete freiwillige Arbeitsdienst ist nicht auf
eine Stufe zu stellen mit dem von den Nazis eingerichteten Arbeitsdienst der folgen-
den Jahre, in dem eine militärähnliche Disziplinierung und weltanschauliche Schu-
lung stattfand.
Da die Krise so lange dauerte, wurden viele Arbeitslose zum Schluß Wohlfahrtser-
werbslose, die ganz auf die Stadt angewiesen waren. Im September 1932, also zu dem
Zeitpunkt, als die Wirtschaftskrise kulminierte, zählte die Stadt etwa 800 Wohl-
fahrtserwerbslose und Ausgesteuerte, ungefähr ebenso viele wie im gleichen Zeit-
raum Bezieher von Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung waren.108 Der Gemein-
derat beschäftigte sich wiederholt mit der Lage der Wohlfahrtserwerbslosen. Sie
sollten bei Notstandsarbeiten besonders berücksichtigt werden. Im August 1933
wurden 250 Wohlfahrtserwerbslose aus Gmünd zum Bau der Landeswasserversor-
gung bei Mögglingen vermittelt. Sie erhielten 41 Pfennig Stundenlohn und mußten
dabei die Fahrtkosten selbst tragen; es blieben ihnen also 10 bis 12 RM in der Woche.
Was waren die Folgen der Massenarbeitslosigkeit für die Stadt? Die Einnahmen san-
ken, die Fürsorgelasten stiegen. Die Stadt wurde finanziell bewegungsunfähig; Stel-
len mußten eingespart werden, auch Lehrerstellen an den Gmünder Schulen. Man
lebte von der Hand in den Mund, kein größeres Vorhaben konnte mehr in Angriff
genommen werden. Eine Flut von Gesuchen ging bei der Stadt ein, Gesuche um
Steuernachlaß, um Stundung fälliger Steuern, um gänzlichen Steuererlaß. Der
Gemeinderat, besonders die Innere Abteilung, hatte laufend damit zu tun.109 Zur
Bewältigung dieser Probleme setzte der Gemeinderat eine Steuerkommission ein,
bestehend aus dem Oberbürgermeister und den Stadträten Dr. Möhring und Eisele.