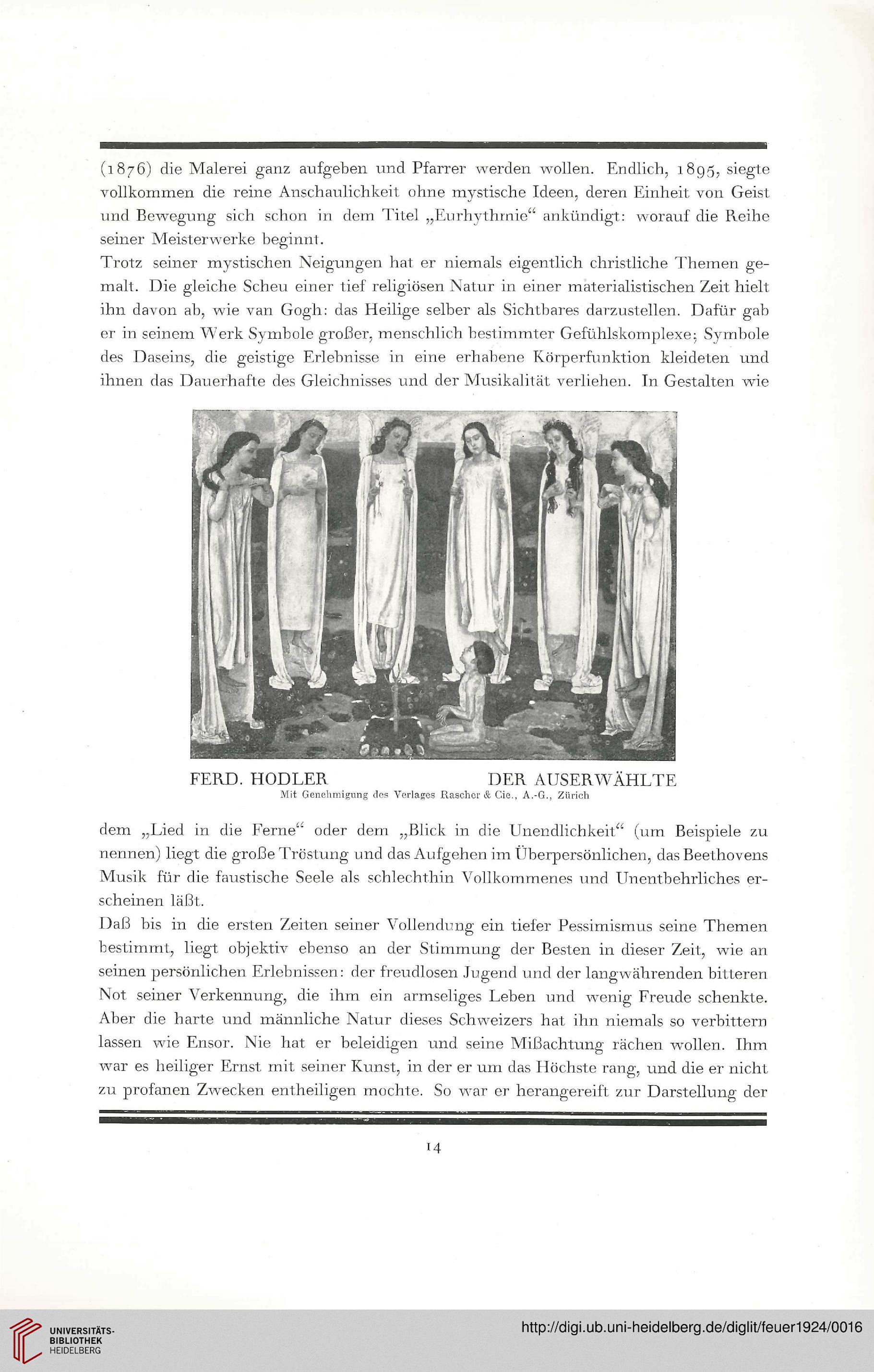(1876) die Malerei ganz aufgeben und Pfarrer werden wollen. Endlich, 1895, siegte
vollkommen die reine Anschaulichkeit ohne mystische Ideen, deren Einheit von Geist
und Bewegung sich schon in dem Titel „Eurhythmie“ ankündigt: worauf die Reihe
seiner Meisterwerke beginnt.
Trotz seiner mystischen Neigungen hat er niemals eigentlich christliche Themen ge-
malt. Die gleiche Scheu einer tief religiösen Natur in einer materialistischen Zeit hielt
ihn davon ab, wie van Gogh: das Heilige selber als Sichtbares darzustellen. Dafür gab
er in seinem Werk Symbole großer, menschlich bestimmter Gefühlskomplexe; Symbole
des Daseins, die geistige Erlebnisse in eine erhabene Körperfunktion kleideten und
ihnen das Dauerhafte des Gleichnisses und der Musikalität verliehen. In Gestalten wie
FERD. HODLER DER AUSERW^ÄHLTE
Mit Genehmigung des Verlages Rascher & Cie., A.-G., Zürich
dem „Lied in die Ferne“ oder dem „Blick in die Unendlichkeit“ (um Beispiele zu
nennen) liegt die große Tröstung und das Aufgehen im Überpersönlichen, das Beethovens
Musik für die faustische Seele als schlechthin Vollkommenes und Unentbehrliches er-
scheinen läßt.
Daß bis in die ersten Zeiten seiner Vollendung ein tiefer Pessimismus seine Themen
bestimmt, liegt objektiv ebenso an der Stimmung der Besten in dieser Zeit, wie an
seinen persönlichen Erlebnissen: der freudlosen lugend und der langwährenden bitteren
Not seiner Verkennung, die ihm ein armseliges Leben und wenig Freude schenkte.
Aber die harte und männliche Natur dieses Schweizers hat ihn niemals so verbittern
lassen wie Ensor. Nie hat er beleidigen und seine Mißachtung rächen wollen. Ihm
war es heiliger Ernst mit seiner Kunst, in der er um das Höchste rang, und die er nicht
zu profanen Zwecken entheiligen mochte. So war er herangereift zur Darstellung der
14
vollkommen die reine Anschaulichkeit ohne mystische Ideen, deren Einheit von Geist
und Bewegung sich schon in dem Titel „Eurhythmie“ ankündigt: worauf die Reihe
seiner Meisterwerke beginnt.
Trotz seiner mystischen Neigungen hat er niemals eigentlich christliche Themen ge-
malt. Die gleiche Scheu einer tief religiösen Natur in einer materialistischen Zeit hielt
ihn davon ab, wie van Gogh: das Heilige selber als Sichtbares darzustellen. Dafür gab
er in seinem Werk Symbole großer, menschlich bestimmter Gefühlskomplexe; Symbole
des Daseins, die geistige Erlebnisse in eine erhabene Körperfunktion kleideten und
ihnen das Dauerhafte des Gleichnisses und der Musikalität verliehen. In Gestalten wie
FERD. HODLER DER AUSERW^ÄHLTE
Mit Genehmigung des Verlages Rascher & Cie., A.-G., Zürich
dem „Lied in die Ferne“ oder dem „Blick in die Unendlichkeit“ (um Beispiele zu
nennen) liegt die große Tröstung und das Aufgehen im Überpersönlichen, das Beethovens
Musik für die faustische Seele als schlechthin Vollkommenes und Unentbehrliches er-
scheinen läßt.
Daß bis in die ersten Zeiten seiner Vollendung ein tiefer Pessimismus seine Themen
bestimmt, liegt objektiv ebenso an der Stimmung der Besten in dieser Zeit, wie an
seinen persönlichen Erlebnissen: der freudlosen lugend und der langwährenden bitteren
Not seiner Verkennung, die ihm ein armseliges Leben und wenig Freude schenkte.
Aber die harte und männliche Natur dieses Schweizers hat ihn niemals so verbittern
lassen wie Ensor. Nie hat er beleidigen und seine Mißachtung rächen wollen. Ihm
war es heiliger Ernst mit seiner Kunst, in der er um das Höchste rang, und die er nicht
zu profanen Zwecken entheiligen mochte. So war er herangereift zur Darstellung der
14