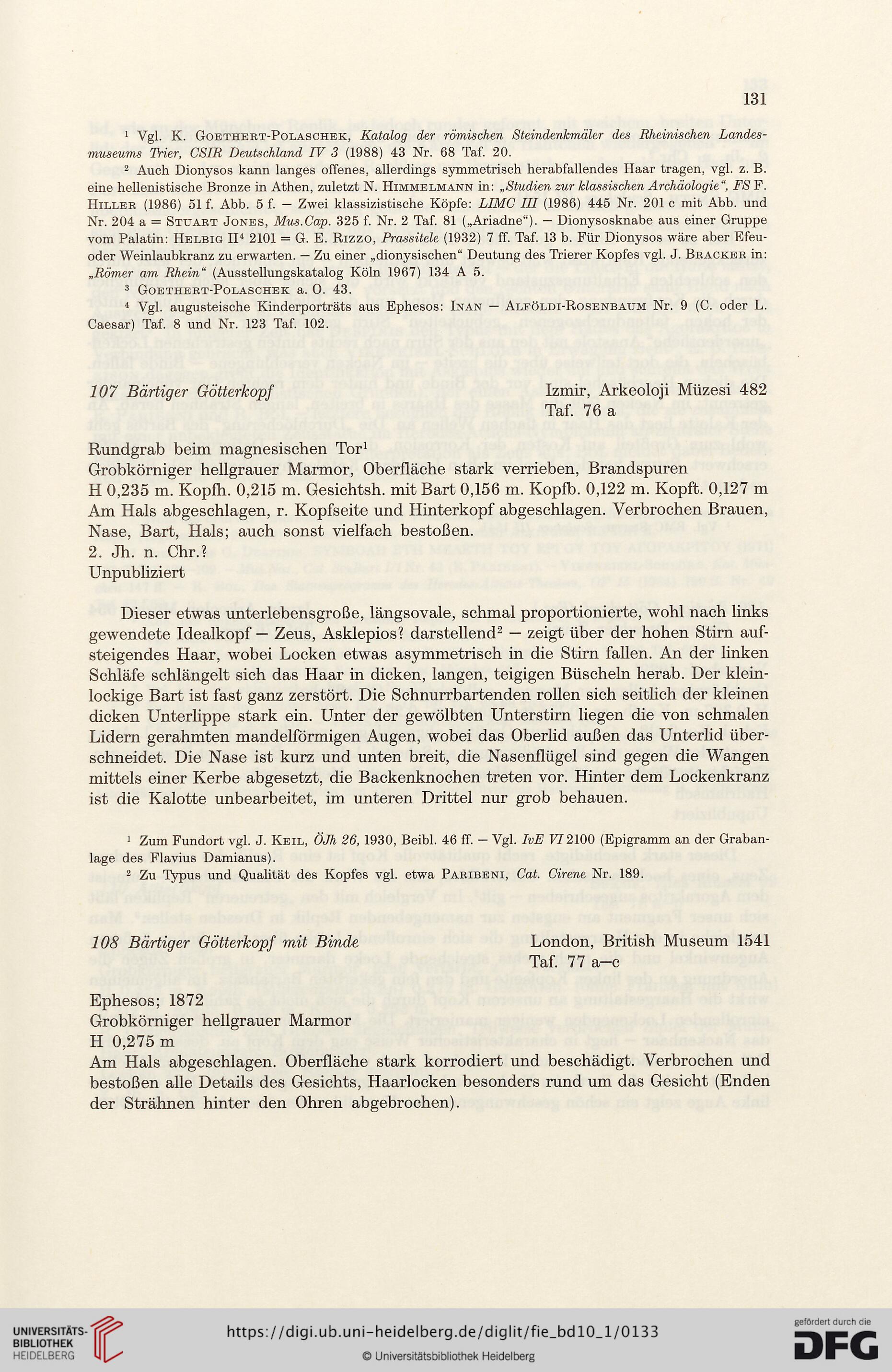131
1 Vgl. K. Goethert-Polaschek, Katalog der römischen Steindenkmäler des Rheinischen Landes-
museums Trier, CSIR Deutschland IV 3 (1988) 43 Nr. 68 Taf. 20.
2 Auch Dionysos kann langes offenes, allerdings symmetrisch herabfallendes Haar tragen, vgl. z. B.
eine hellenistische Bronze in Athen, zuletzt N. Himmelmann in: „Studien zur klassischen Archäologie“, FS F.
Hiller (1986) 51 f. Abb. 5 f. — Zwei klassizistische Köpfe: LIMC III (1986) 445 Nr. 201 c mit Abb. und
Nr. 204 a = Stuart Jones, Mus.Cap. 325 f. Nr. 2 Taf. 81 („Ariadne“). — Dionysosknabe aus einer Gruppe
vom Palatin: Helbig II4 2101 = G. E. Rizzo, Prassitele (1932) 7 ff. Taf. 13 b. Für Dionysos wäre aber Efeu-
oder Weinlaubkranz zu erwarten. — Zu einer „dionysischen“ Deutung des Trierer Kopfes vgl. J. Bracker in:
„Römer am Rhein“ (Ausstellungskatalog Köln 1967) 134 A 5.
3 Goethert-Polaschek a. 0. 43.
4 Vgl. augusteische Kinderporträts aus Ephesos: Inan — Alföldi-Rosenbaum Nr. 9 (C. oder L.
Caesar) Taf. 8 und Nr. 123 Taf. 102.
107 Bärtiger Götterkopf Izmir, Arkeoloji Müzesi 482
Taf. 76 a
Rundgrab beim magnesischen Tor1
Grobkörniger hellgrauer Marmor, Oberfläche stark verrieben, Brandspuren
H 0,235 m. Kopfh. 0,215 m. Gesichtsh. mit Bart 0,156 m. Kopfb. 0,122 m. Köpft. 0,127 m
Am Hals abgeschlagen, r. Kopfseite und Hinterkopf abgeschlagen. Verbrochen Brauen,
Nase, Bart, Hals; auch sonst vielfach bestoßen.
2. Jh. n. Ohr.?
Unpubliziert
Dieser etwas unterlebensgroße, längsovale, schmal proportionierte, wohl nach links
gewendete Idealkopf — Zeus, Asklepios? darstellend2 — zeigt über der hohen Stirn auf-
steigendes Haar, wobei Locken etwas asymmetrisch in die Stirn fallen. An der linken
Schläfe schlängelt sich das Haar in dicken, langen, teigigen Büscheln herab. Der klein-
lockige Bart ist fast ganz zerstört. Die Schnurrbartenden rollen sich seitlich der kleinen
dicken Unterlippe stark ein. Unter der gewölbten Unterstirn liegen die von schmalen
Lidern gerahmten mandelförmigen Augen, wobei das Oberlid außen das Unterlid über-
schneidet. Die Nase ist kurz und unten breit, die Nasenflügel sind gegen die Wangen
mittels einer Kerbe abgesetzt, die Backenknochen treten vor. Hinter dem Lockenkranz
ist die Kalotte unbearbeitet, im unteren Drittel nur grob behauen.
1 Zum Fundort vgl. J. Keil, ÖJh 26, 1930, Beibl. 46 ff. — Vgl. IvE VI2100 (Epigramm an der Graban-
lage des Flavius Damianus).
2 Zu T)ypus und Qualität des Kopfes vgl. etwa Paribeni, Cat. Cirene Nr. 189.
108 Bärtiger Götterkopf mit Binde
London, British Museum 1541
Taf. 77 a-c
Ephesos; 1872
Grobkörniger hellgrauer Marmor
H 0,275 m
Am Hals abgeschlagen. Oberfläche stark korrodiert und beschädigt. Verbrochen und
bestoßen alle Details des Gesichts, Haarlocken besonders rund um das Gesicht (Enden
der Strähnen hinter den Ohren abgebrochen).
1 Vgl. K. Goethert-Polaschek, Katalog der römischen Steindenkmäler des Rheinischen Landes-
museums Trier, CSIR Deutschland IV 3 (1988) 43 Nr. 68 Taf. 20.
2 Auch Dionysos kann langes offenes, allerdings symmetrisch herabfallendes Haar tragen, vgl. z. B.
eine hellenistische Bronze in Athen, zuletzt N. Himmelmann in: „Studien zur klassischen Archäologie“, FS F.
Hiller (1986) 51 f. Abb. 5 f. — Zwei klassizistische Köpfe: LIMC III (1986) 445 Nr. 201 c mit Abb. und
Nr. 204 a = Stuart Jones, Mus.Cap. 325 f. Nr. 2 Taf. 81 („Ariadne“). — Dionysosknabe aus einer Gruppe
vom Palatin: Helbig II4 2101 = G. E. Rizzo, Prassitele (1932) 7 ff. Taf. 13 b. Für Dionysos wäre aber Efeu-
oder Weinlaubkranz zu erwarten. — Zu einer „dionysischen“ Deutung des Trierer Kopfes vgl. J. Bracker in:
„Römer am Rhein“ (Ausstellungskatalog Köln 1967) 134 A 5.
3 Goethert-Polaschek a. 0. 43.
4 Vgl. augusteische Kinderporträts aus Ephesos: Inan — Alföldi-Rosenbaum Nr. 9 (C. oder L.
Caesar) Taf. 8 und Nr. 123 Taf. 102.
107 Bärtiger Götterkopf Izmir, Arkeoloji Müzesi 482
Taf. 76 a
Rundgrab beim magnesischen Tor1
Grobkörniger hellgrauer Marmor, Oberfläche stark verrieben, Brandspuren
H 0,235 m. Kopfh. 0,215 m. Gesichtsh. mit Bart 0,156 m. Kopfb. 0,122 m. Köpft. 0,127 m
Am Hals abgeschlagen, r. Kopfseite und Hinterkopf abgeschlagen. Verbrochen Brauen,
Nase, Bart, Hals; auch sonst vielfach bestoßen.
2. Jh. n. Ohr.?
Unpubliziert
Dieser etwas unterlebensgroße, längsovale, schmal proportionierte, wohl nach links
gewendete Idealkopf — Zeus, Asklepios? darstellend2 — zeigt über der hohen Stirn auf-
steigendes Haar, wobei Locken etwas asymmetrisch in die Stirn fallen. An der linken
Schläfe schlängelt sich das Haar in dicken, langen, teigigen Büscheln herab. Der klein-
lockige Bart ist fast ganz zerstört. Die Schnurrbartenden rollen sich seitlich der kleinen
dicken Unterlippe stark ein. Unter der gewölbten Unterstirn liegen die von schmalen
Lidern gerahmten mandelförmigen Augen, wobei das Oberlid außen das Unterlid über-
schneidet. Die Nase ist kurz und unten breit, die Nasenflügel sind gegen die Wangen
mittels einer Kerbe abgesetzt, die Backenknochen treten vor. Hinter dem Lockenkranz
ist die Kalotte unbearbeitet, im unteren Drittel nur grob behauen.
1 Zum Fundort vgl. J. Keil, ÖJh 26, 1930, Beibl. 46 ff. — Vgl. IvE VI2100 (Epigramm an der Graban-
lage des Flavius Damianus).
2 Zu T)ypus und Qualität des Kopfes vgl. etwa Paribeni, Cat. Cirene Nr. 189.
108 Bärtiger Götterkopf mit Binde
London, British Museum 1541
Taf. 77 a-c
Ephesos; 1872
Grobkörniger hellgrauer Marmor
H 0,275 m
Am Hals abgeschlagen. Oberfläche stark korrodiert und beschädigt. Verbrochen und
bestoßen alle Details des Gesichts, Haarlocken besonders rund um das Gesicht (Enden
der Strähnen hinter den Ohren abgebrochen).