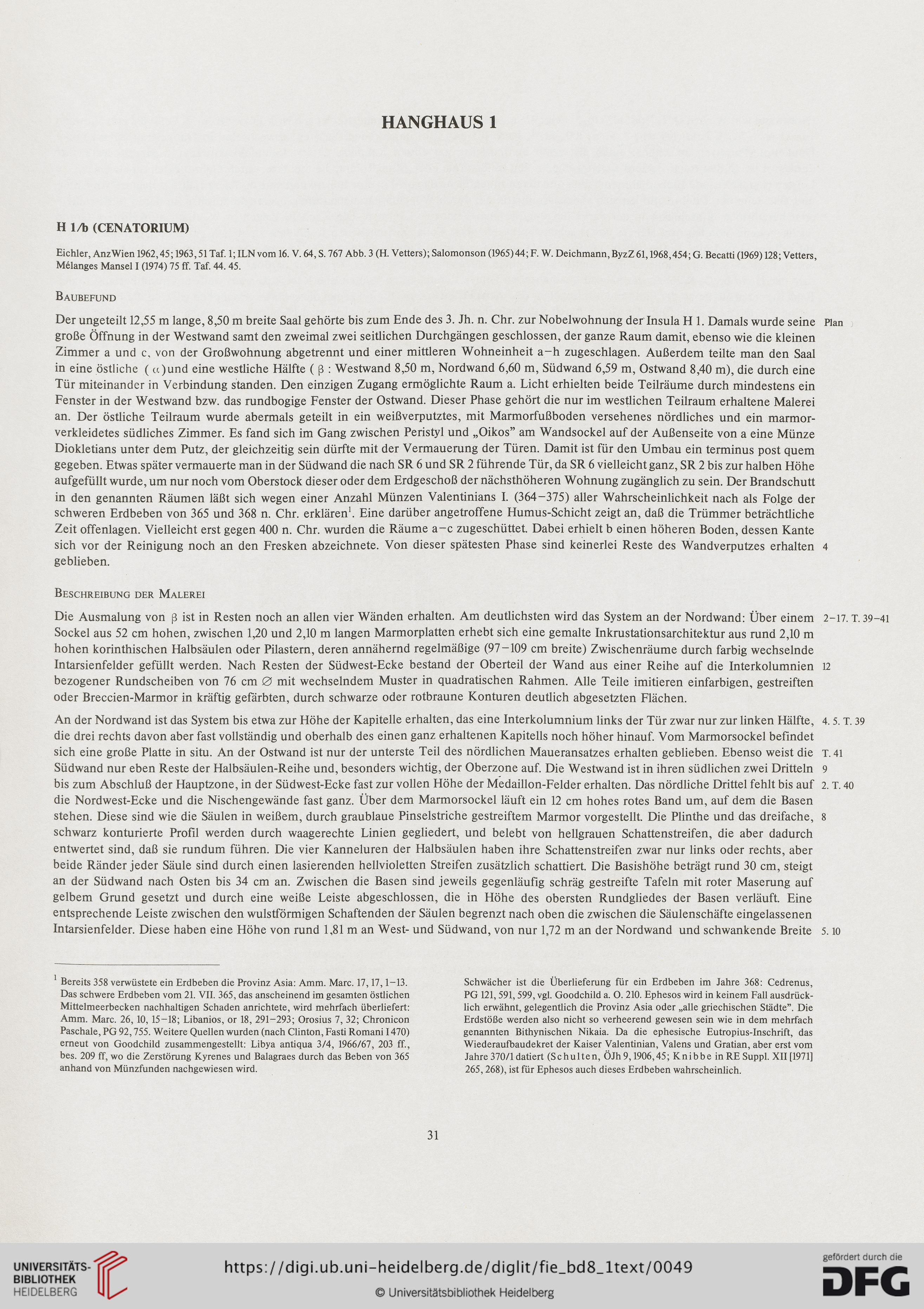HANGHAUS 1
H 1/b (CENATORIUM)
Eichler, AnzWien 1962,45; 1963,51 Taf. 1;ILN vom 16. V. 64, S. 767 Abb. 3 (H. Vetters); Salomonson (1965)44;F. W. Deichmann,ByzZ61,1968,454; G. Becatti (1969) 128; Vetters,
Melanges Mansel I (1974) 75 ff. Taf. 44. 45.
Baubefund
Der ungeteilt 12,55 m lange, 8,50 m breite Saal gehörte bis zum Ende des 3. Jh. n. Chr. zur Nobelwohnung der Insula H 1. Damals wurde seine Plan
große Öffnung in der Westwand samt den zweimal zwei seitlichen Durchgängen geschlossen, der ganze Raum damit, ebenso wie die kleinen
Zimmer a und c, von der Großwohnung abgetrennt und einer mittleren Wohneinheit a-h zugeschlagen. Außerdem teilte man den Saal
in eine östliche ( a)und eine westliche Hälfte ( ß : Westwand 8,50 m, Nordwand 6,60 m, Südwand 6,59 m, Ostwand 8,40 m), die durch eine
Tür miteinander in Verbindung standen. Den einzigen Zugang ermöglichte Raum a. Licht erhielten beide Teilräume durch mindestens ein
Fenster in der Westwand bzw. das rundbogige Fenster der Ostwand. Dieser Phase gehört die nur im westlichen Teilraum erhaltene Malerei
an. Der östliche Teilraum wurde abermals geteilt in ein weißverputztes, mit Marmorfußboden versehenes nördliches und ein marmor-
verkleidetes südliches Zimmer. Es fand sich im Gang zwischen Peristyl und „Oikos” am Wandsockel auf der Außenseite von a eine Münze
Diokletians unter dem Putz, der gleichzeitig sein dürfte mit der Vermauerung der Türen. Damit ist für den Umbau ein terminus post quem
gegeben. Etwas später vermauerte man in der Südwand die nach SR 6 und SR 2 führende Tür, da SR 6 vielleicht ganz, SR 2 bis zur halben Höhe
aufgefüllt wurde, um nur noch vom Oberstock dieser oder dem Erdgeschoß der nächsthöheren Wohnung zugänglich zu sein. Der Brandschutt
in den genannten Räumen läßt sich wegen einer Anzahl Münzen Valentinians I. (364-375) aller Wahrscheinlichkeit nach als Folge der
schweren Erdbeben von 365 und 368 n. Chr. erklären1. Eine darüber angetroffene Humus-Schicht zeigt an, daß die Trümmer beträchtliche
Zeit offenlagen. Vielleicht erst gegen 400 n. Chr. wurden die Räume a-c zugeschüttet. Dabei erhielt b einen höheren Boden, dessen Kante
sich vor der Reinigung noch an den Fresken abzeichnete. Von dieser spätesten Phase sind keinerlei Reste des Wandverputzes erhalten 4
geblieben.
Beschreibung der Malerei
Die Ausmalung von ß ist in Resten noch an allen vier Wänden erhalten. Am deutlichsten wird das System an der Nordwand: Über einem 2-17. T. 39-41
Sockel aus 52 cm hohen, zwischen 1,20 und 2,10 m langen Marmorplatten erhebt sich eine gemalte Inkrustationsarchitektur aus rund 2,10 m
hohen korinthischen Halbsäulen oder Pilastern, deren annähernd regelmäßige (97-109 cm breite) Zwischenräume durch farbig wechselnde
Intarsienfelder gefüllt werden. Nach Resten der Südwest-Ecke bestand der Oberteil der Wand aus einer Reihe auf die Interkolumnien 12
bezogener Rundscheiben von 76 cm 0 mit wechselndem Muster in quadratischen Rahmen. Alle Teile imitieren einfarbigen, gestreiften
oder Breccien-Marmor in kräftig gefärbten, durch schwarze oder rotbraune Konturen deutlich abgesetzten Flächen.
An der Nordwand ist das System bis etwa zur Höhe der Kapitelle erhalten, das eine Interkolumnium links der Tür zwar nur zur linken Hälfte,
die drei rechts davon aber fast vollständig und oberhalb des einen ganz erhaltenen Kapitells noch höher hinauf. Vom Marmorsockel befindet
sich eine große Platte in situ. An der Ostwand ist nur der unterste Teil des nördlichen Maueransatzes erhalten geblieben. Ebenso weist die
Südwand nur eben Reste der Halbsäulen-Reihe und, besonders wichtig, der Oberzone auf. Die Westwand ist in ihren südlichen zwei Dritteln
bis zum Abschluß der Hauptzone, in der Südwest-Ecke fast zur vollen Höhe der Medaillon-Felder erhalten. Das nördliche Drittel fehlt bis auf
die Nordwest-Ecke und die Nischengewände fast ganz. Über dem Marmorsockel läuft ein 12 cm hohes rotes Band um, auf dem die Basen
stehen. Diese sind wie die Säulen in weißem, durch graublaue Pinselstriche gestreiftem Marmor vorgestellt. Die Plinthe und das dreifache,
schwarz konturierte Profil werden durch waagerechte Linien gegliedert, und belebt von hellgrauen Schattenstreifen, die aber dadurch
entwertet sind, daß sie rundum führen. Die vier Kanneluren der Halbsäulen haben ihre Schattenstreifen zwar nur links oder rechts, aber
beide Ränder jeder Säule sind durch einen lasierenden hellvioletten Streifen zusätzlich schattiert. Die Basishöhe beträgt rund 30 cm, steigt
an der Südwand nach Osten bis 34 cm an. Zwischen die Basen sind jeweils gegenläufig schräg gestreifte Tafeln mit roter Maserung auf
gelbem Grund gesetzt und durch eine weiße Leiste abgeschlossen, die in Höhe des obersten Rundgliedes der Basen verläuft. Eine
entsprechende Leiste zwischen den wulstförmigen Schaftenden der Säulen begrenzt nach oben die zwischen die Säulenschäfte eingelassenen
Intarsienfelder. Diese haben eine Höhe von rund 1,81 m an West- und Südwand, von nur 1,72 m an der Nordwand und schwankende Breite
4. 5. T. 39
T. 41
9
2. T. 40
8
5. 10
1 Bereits 358 verwüstete ein Erdbeben die Provinz Asia: Amm. Marc. 17,17,1-13.
Das schwere Erdbeben vom 21. VII. 365, das anscheinend im gesamten östlichen
Mittelmeerbecken nachhaltigen Schaden anrichtete, wird mehrfach überliefert:
Amm. Marc. 26, 10, 15-18; Libanios, or 18, 291-293; Orosius 7, 32; Chronicon
Paschale, PG 92,755. Weitere Quellen wurden (nach Clinton, Fasti Romani 1470)
erneut von Goodchild zusammengestellt: Libya antiqua 3/4, 1966/67, 203 ff.,
bes. 209 ff, wo die Zerstörung Kyrenes und Balagraes durch das Beben von 365
anhand von Münzfunden nachgewiesen wird.
Schwächer ist die Überlieferung für ein Erdbeben im Jahre 368: Cedrenus,
PG 121,591, 599, vgl. Goodchild a. O. 210. Ephesos wird in keinem Fall ausdrück-
lich erwähnt, gelegentlich die Provinz Asia oder „alle griechischen Städte”. Die
Erdstöße werden also nicht so verheerend gewesen sein wie in dem mehrfach
genannten Bithynischen Nikaia. Da die ephesische Eutropius-Inschrift, das
Wiederaufbaudekret der Kaiser Valentinian, Valens und Gratian, aber erst vom
Jahre 370/1 datiert (Schulten, ÖJh 9,1906,45; Knibbe in RE Suppl. XII [1971]
265,268), ist für Ephesos auch dieses Erdbeben wahrscheinlich.
31
H 1/b (CENATORIUM)
Eichler, AnzWien 1962,45; 1963,51 Taf. 1;ILN vom 16. V. 64, S. 767 Abb. 3 (H. Vetters); Salomonson (1965)44;F. W. Deichmann,ByzZ61,1968,454; G. Becatti (1969) 128; Vetters,
Melanges Mansel I (1974) 75 ff. Taf. 44. 45.
Baubefund
Der ungeteilt 12,55 m lange, 8,50 m breite Saal gehörte bis zum Ende des 3. Jh. n. Chr. zur Nobelwohnung der Insula H 1. Damals wurde seine Plan
große Öffnung in der Westwand samt den zweimal zwei seitlichen Durchgängen geschlossen, der ganze Raum damit, ebenso wie die kleinen
Zimmer a und c, von der Großwohnung abgetrennt und einer mittleren Wohneinheit a-h zugeschlagen. Außerdem teilte man den Saal
in eine östliche ( a)und eine westliche Hälfte ( ß : Westwand 8,50 m, Nordwand 6,60 m, Südwand 6,59 m, Ostwand 8,40 m), die durch eine
Tür miteinander in Verbindung standen. Den einzigen Zugang ermöglichte Raum a. Licht erhielten beide Teilräume durch mindestens ein
Fenster in der Westwand bzw. das rundbogige Fenster der Ostwand. Dieser Phase gehört die nur im westlichen Teilraum erhaltene Malerei
an. Der östliche Teilraum wurde abermals geteilt in ein weißverputztes, mit Marmorfußboden versehenes nördliches und ein marmor-
verkleidetes südliches Zimmer. Es fand sich im Gang zwischen Peristyl und „Oikos” am Wandsockel auf der Außenseite von a eine Münze
Diokletians unter dem Putz, der gleichzeitig sein dürfte mit der Vermauerung der Türen. Damit ist für den Umbau ein terminus post quem
gegeben. Etwas später vermauerte man in der Südwand die nach SR 6 und SR 2 führende Tür, da SR 6 vielleicht ganz, SR 2 bis zur halben Höhe
aufgefüllt wurde, um nur noch vom Oberstock dieser oder dem Erdgeschoß der nächsthöheren Wohnung zugänglich zu sein. Der Brandschutt
in den genannten Räumen läßt sich wegen einer Anzahl Münzen Valentinians I. (364-375) aller Wahrscheinlichkeit nach als Folge der
schweren Erdbeben von 365 und 368 n. Chr. erklären1. Eine darüber angetroffene Humus-Schicht zeigt an, daß die Trümmer beträchtliche
Zeit offenlagen. Vielleicht erst gegen 400 n. Chr. wurden die Räume a-c zugeschüttet. Dabei erhielt b einen höheren Boden, dessen Kante
sich vor der Reinigung noch an den Fresken abzeichnete. Von dieser spätesten Phase sind keinerlei Reste des Wandverputzes erhalten 4
geblieben.
Beschreibung der Malerei
Die Ausmalung von ß ist in Resten noch an allen vier Wänden erhalten. Am deutlichsten wird das System an der Nordwand: Über einem 2-17. T. 39-41
Sockel aus 52 cm hohen, zwischen 1,20 und 2,10 m langen Marmorplatten erhebt sich eine gemalte Inkrustationsarchitektur aus rund 2,10 m
hohen korinthischen Halbsäulen oder Pilastern, deren annähernd regelmäßige (97-109 cm breite) Zwischenräume durch farbig wechselnde
Intarsienfelder gefüllt werden. Nach Resten der Südwest-Ecke bestand der Oberteil der Wand aus einer Reihe auf die Interkolumnien 12
bezogener Rundscheiben von 76 cm 0 mit wechselndem Muster in quadratischen Rahmen. Alle Teile imitieren einfarbigen, gestreiften
oder Breccien-Marmor in kräftig gefärbten, durch schwarze oder rotbraune Konturen deutlich abgesetzten Flächen.
An der Nordwand ist das System bis etwa zur Höhe der Kapitelle erhalten, das eine Interkolumnium links der Tür zwar nur zur linken Hälfte,
die drei rechts davon aber fast vollständig und oberhalb des einen ganz erhaltenen Kapitells noch höher hinauf. Vom Marmorsockel befindet
sich eine große Platte in situ. An der Ostwand ist nur der unterste Teil des nördlichen Maueransatzes erhalten geblieben. Ebenso weist die
Südwand nur eben Reste der Halbsäulen-Reihe und, besonders wichtig, der Oberzone auf. Die Westwand ist in ihren südlichen zwei Dritteln
bis zum Abschluß der Hauptzone, in der Südwest-Ecke fast zur vollen Höhe der Medaillon-Felder erhalten. Das nördliche Drittel fehlt bis auf
die Nordwest-Ecke und die Nischengewände fast ganz. Über dem Marmorsockel läuft ein 12 cm hohes rotes Band um, auf dem die Basen
stehen. Diese sind wie die Säulen in weißem, durch graublaue Pinselstriche gestreiftem Marmor vorgestellt. Die Plinthe und das dreifache,
schwarz konturierte Profil werden durch waagerechte Linien gegliedert, und belebt von hellgrauen Schattenstreifen, die aber dadurch
entwertet sind, daß sie rundum führen. Die vier Kanneluren der Halbsäulen haben ihre Schattenstreifen zwar nur links oder rechts, aber
beide Ränder jeder Säule sind durch einen lasierenden hellvioletten Streifen zusätzlich schattiert. Die Basishöhe beträgt rund 30 cm, steigt
an der Südwand nach Osten bis 34 cm an. Zwischen die Basen sind jeweils gegenläufig schräg gestreifte Tafeln mit roter Maserung auf
gelbem Grund gesetzt und durch eine weiße Leiste abgeschlossen, die in Höhe des obersten Rundgliedes der Basen verläuft. Eine
entsprechende Leiste zwischen den wulstförmigen Schaftenden der Säulen begrenzt nach oben die zwischen die Säulenschäfte eingelassenen
Intarsienfelder. Diese haben eine Höhe von rund 1,81 m an West- und Südwand, von nur 1,72 m an der Nordwand und schwankende Breite
4. 5. T. 39
T. 41
9
2. T. 40
8
5. 10
1 Bereits 358 verwüstete ein Erdbeben die Provinz Asia: Amm. Marc. 17,17,1-13.
Das schwere Erdbeben vom 21. VII. 365, das anscheinend im gesamten östlichen
Mittelmeerbecken nachhaltigen Schaden anrichtete, wird mehrfach überliefert:
Amm. Marc. 26, 10, 15-18; Libanios, or 18, 291-293; Orosius 7, 32; Chronicon
Paschale, PG 92,755. Weitere Quellen wurden (nach Clinton, Fasti Romani 1470)
erneut von Goodchild zusammengestellt: Libya antiqua 3/4, 1966/67, 203 ff.,
bes. 209 ff, wo die Zerstörung Kyrenes und Balagraes durch das Beben von 365
anhand von Münzfunden nachgewiesen wird.
Schwächer ist die Überlieferung für ein Erdbeben im Jahre 368: Cedrenus,
PG 121,591, 599, vgl. Goodchild a. O. 210. Ephesos wird in keinem Fall ausdrück-
lich erwähnt, gelegentlich die Provinz Asia oder „alle griechischen Städte”. Die
Erdstöße werden also nicht so verheerend gewesen sein wie in dem mehrfach
genannten Bithynischen Nikaia. Da die ephesische Eutropius-Inschrift, das
Wiederaufbaudekret der Kaiser Valentinian, Valens und Gratian, aber erst vom
Jahre 370/1 datiert (Schulten, ÖJh 9,1906,45; Knibbe in RE Suppl. XII [1971]
265,268), ist für Ephesos auch dieses Erdbeben wahrscheinlich.
31