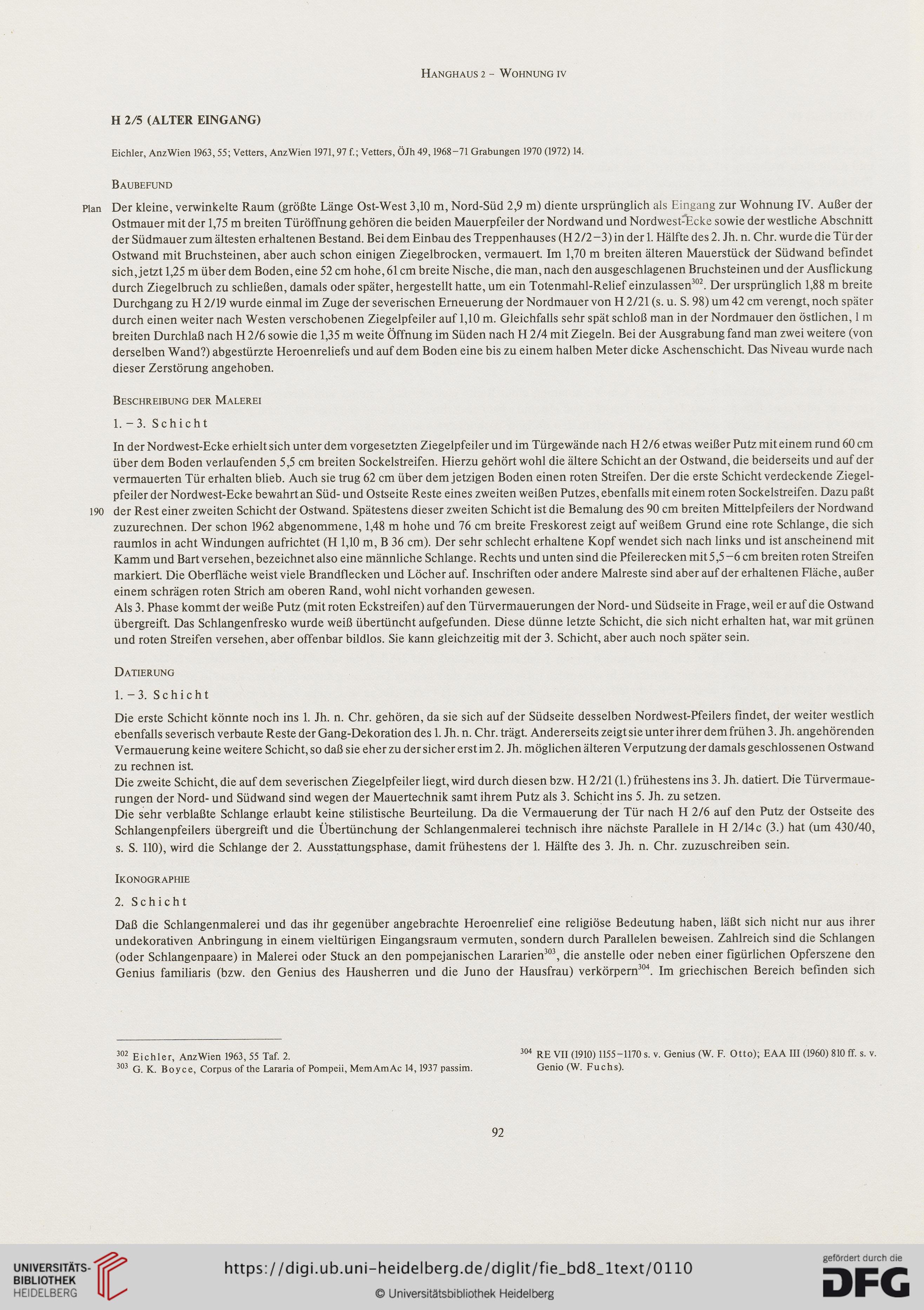Hanghaus 2 - Wohnung iv
H 2/5 (ALTER EINGANG)
Eichler, AnzWien 1963, 55; Vetters, AnzWien 1971,97 f.; Vetters, ÖJh 49,1968-71 Grabungen 1970 (1972) 14.
Baubefund
Plan Der kleine, verwinkelte Raum (größte Länge Ost-West 3,10 m, Nord-Süd 2,9 m) diente ursprünglich als Eingang zur Wohnung IV. Außer der
Ostmauer mit der 1,75 m breiten Türöffnung gehören die beiden Mauerpfeiler der Nordwand und Nordwestöicke sowie der westliche Abschnitt
der Südmauer zum ältesten erhaltenen Bestand. Bei dem Einbau des Treppenhauses (H 2/2-3) in derl. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. wurde die Tür der
Ostwand mit Bruchsteinen, aber auch schon einigen Ziegelbrocken, vermauert. Im 1,70 m breiten älteren Mauerstück der Südwand befindet
sich, jetzt 1,25 m über dem Boden, eine 52 cm hohe, 61 cm breite Nische, die man, nach den ausgeschlagenen Bruchsteinen und der Ausflickung
durch Ziegelbruch zu schließen, damals oder später, hergestellt hatte, um ein Totenmahl-Relief einzulassen302. Der ursprünglich 1,88 m breite
Durchgang zu H 2/19 wurde einmal im Zuge der severischen Erneuerung der Nordmauer von H 2/21 (s. u. S. 98) um 42 cm verengt, noch später
durch einen weiter nach Westen verschobenen Ziegelpfeiler auf 1,10 m. Gleichfalls sehr spät schloß man in der Nordmauer den östlichen, 1 m
breiten Durchlaß nach H 2/6 sowie die 1,35 m weite Öffnung im Süden nach H 2/4 mit Ziegeln. Bei der Ausgrabung fand man zwei weitere (von
derselben Wand?) abgestürzte Heroenreliefs und auf dem Boden eine bis zu einem halben Meter dicke Aschenschicht. Das Niveau wurde nach
dieser Zerstörung angehoben.
Beschreibung der Malerei
1.-3. Schicht
In der Nordwest-Ecke erhielt sich unter dem vorgesetzten Ziegelpfeiler und im Türgewände nach H 2/6 etwas weißer Putz mit einem rund 60 cm
über dem Boden verlaufenden 5,5 cm breiten Sockelstreifen. Hierzu gehört wohl die ältere Schicht an der Ostwand, die beiderseits und auf der
vermauerten Tür erhalten blieb. Auch sie trug 62 cm über dem jetzigen Boden einen roten Streifen. Der die erste Schicht verdeckende Ziegel-
pfeiler der Nordwest-Ecke bewahrt an Süd- und Ostseite Reste eines zweiten weißen Putzes, ebenfalls mit einem roten Sockelstreifen. Dazu paßt
190 der Rest einer zweiten Schicht der Ostwand. Spätestens dieser zweiten Schicht ist die Bemalung des 90 cm breiten Mittelpfeilers der Nordwand
zuzurechnen. Der schon 1962 abgenommene, 1,48 m hohe und 76 cm breite Freskorest zeigt auf weißem Grund eine rote Schlange, die sich
raumlos in acht Windungen aufrichtet (H 1,10 m, B 36 cm). Der sehr schlecht erhaltene Kopf wendet sich nach links und ist anscheinend mit
Kamm und Bart versehen, bezeichnet also eine männliche Schlange. Rechts und unten sind die Pfeilerecken mit 5,5 -6 cm breiten roten Streifen
markiert. Die Oberfläche weist viele Brandflecken und Löcher auf. Inschriften oder andere Malreste sind aber auf der erhaltenen Fläche, außer
einem schrägen roten Strich am oberen Rand, wohl nicht vorhanden gewesen.
Als 3. Phase kommt der weiße Putz (mit roten Eckstreifen) auf den Türvermauerungen der Nord- und Südseite in Frage, weil er auf die Ostwand
übergreift. Das Schlangenfresko wurde weiß übertüncht aufgefunden. Diese dünne letzte Schicht, die sich nicht erhalten hat, war mit grünen
und roten Streifen versehen, aber offenbar bildlos. Sie kann gleichzeitig mit der 3. Schicht, aber auch noch später sein.
Datierung
1. -3. Schicht
Die erste Schicht könnte noch ins 1. Jh. n. Chr. gehören, da sie sich auf der Südseite desselben Nordwest-Pfeilers findet, der weiter westlich
ebenfalls severisch verbaute Reste der Gang-Dekoration des 1. Jh. n. Chr. trägt. Andererseits zeigt sie unter ihrer dem frühen 3. Jh. angehörenden
Vermauerung keine weitere Schicht, so daß sie eher zu der sicher erst im 2. Jh. möglichen älteren Verputzung der damals geschlossenen Ostwand
zu rechnen ist.
Die zweite Schicht, die auf dem severischen Ziegelpfeiler liegt, wird durch diesen bzw. H 2/21 (1.) frühestens ins 3. Jh. datiert. Die Türvermaue-
rungen der Nord- und Südwand sind wegen der Mauertechnik samt ihrem Putz als 3. Schicht ins 5. Jh. zu setzen.
Die sehr verblaßte Schlange erlaubt keine stilistische Beurteilung. Da die Vermauerung der Tür nach H 2/6 auf den Putz der Ostseite des
Schlangenpfeilers übergreift und die Übertünchung der Schlangenmalerei technisch ihre nächste Parallele in H 2/14c (3.) hat (um 430/40,
s. S. 110), wird die Schlange der 2. Ausstattungsphase, damit frühestens der 1. Hälfte des 3. Jh. n. Chr. zuzuschreiben sein.
Ikonographie
2. Schicht
Daß die Schlangenmalerei und das ihr gegenüber angebrachte Heroenrelief eine religiöse Bedeutung haben, läßt sich nicht nur aus ihrer
undekorativen Anbringung in einem vieltürigen Eingangsraum vermuten, sondern durch Parallelen beweisen. Zahlreich sind die Schlangen
(oder Schlangenpaare) in Malerei oder Stuck an den pompejanischen Lararien303, die anstelle oder neben einer figürlichen Opferszene den
Genius familiaris (bzw. den Genius des Hausherren und die Juno der Hausfrau) verkörpern304. Im griechischen Bereich befinden sich
302 Eichler, AnzWien 1963, 55 Taf. 2.
303 G. K. Boyce, Corpus of the Lararia of Pompeii, MemAmAc 14,1937 passim.
304 RE VII (1910) 1155-1170 s. v. Genius (W. F. Otto); EAA III (1960) 810 ff. s. v.
Genio (W. Fuchs).
92
H 2/5 (ALTER EINGANG)
Eichler, AnzWien 1963, 55; Vetters, AnzWien 1971,97 f.; Vetters, ÖJh 49,1968-71 Grabungen 1970 (1972) 14.
Baubefund
Plan Der kleine, verwinkelte Raum (größte Länge Ost-West 3,10 m, Nord-Süd 2,9 m) diente ursprünglich als Eingang zur Wohnung IV. Außer der
Ostmauer mit der 1,75 m breiten Türöffnung gehören die beiden Mauerpfeiler der Nordwand und Nordwestöicke sowie der westliche Abschnitt
der Südmauer zum ältesten erhaltenen Bestand. Bei dem Einbau des Treppenhauses (H 2/2-3) in derl. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. wurde die Tür der
Ostwand mit Bruchsteinen, aber auch schon einigen Ziegelbrocken, vermauert. Im 1,70 m breiten älteren Mauerstück der Südwand befindet
sich, jetzt 1,25 m über dem Boden, eine 52 cm hohe, 61 cm breite Nische, die man, nach den ausgeschlagenen Bruchsteinen und der Ausflickung
durch Ziegelbruch zu schließen, damals oder später, hergestellt hatte, um ein Totenmahl-Relief einzulassen302. Der ursprünglich 1,88 m breite
Durchgang zu H 2/19 wurde einmal im Zuge der severischen Erneuerung der Nordmauer von H 2/21 (s. u. S. 98) um 42 cm verengt, noch später
durch einen weiter nach Westen verschobenen Ziegelpfeiler auf 1,10 m. Gleichfalls sehr spät schloß man in der Nordmauer den östlichen, 1 m
breiten Durchlaß nach H 2/6 sowie die 1,35 m weite Öffnung im Süden nach H 2/4 mit Ziegeln. Bei der Ausgrabung fand man zwei weitere (von
derselben Wand?) abgestürzte Heroenreliefs und auf dem Boden eine bis zu einem halben Meter dicke Aschenschicht. Das Niveau wurde nach
dieser Zerstörung angehoben.
Beschreibung der Malerei
1.-3. Schicht
In der Nordwest-Ecke erhielt sich unter dem vorgesetzten Ziegelpfeiler und im Türgewände nach H 2/6 etwas weißer Putz mit einem rund 60 cm
über dem Boden verlaufenden 5,5 cm breiten Sockelstreifen. Hierzu gehört wohl die ältere Schicht an der Ostwand, die beiderseits und auf der
vermauerten Tür erhalten blieb. Auch sie trug 62 cm über dem jetzigen Boden einen roten Streifen. Der die erste Schicht verdeckende Ziegel-
pfeiler der Nordwest-Ecke bewahrt an Süd- und Ostseite Reste eines zweiten weißen Putzes, ebenfalls mit einem roten Sockelstreifen. Dazu paßt
190 der Rest einer zweiten Schicht der Ostwand. Spätestens dieser zweiten Schicht ist die Bemalung des 90 cm breiten Mittelpfeilers der Nordwand
zuzurechnen. Der schon 1962 abgenommene, 1,48 m hohe und 76 cm breite Freskorest zeigt auf weißem Grund eine rote Schlange, die sich
raumlos in acht Windungen aufrichtet (H 1,10 m, B 36 cm). Der sehr schlecht erhaltene Kopf wendet sich nach links und ist anscheinend mit
Kamm und Bart versehen, bezeichnet also eine männliche Schlange. Rechts und unten sind die Pfeilerecken mit 5,5 -6 cm breiten roten Streifen
markiert. Die Oberfläche weist viele Brandflecken und Löcher auf. Inschriften oder andere Malreste sind aber auf der erhaltenen Fläche, außer
einem schrägen roten Strich am oberen Rand, wohl nicht vorhanden gewesen.
Als 3. Phase kommt der weiße Putz (mit roten Eckstreifen) auf den Türvermauerungen der Nord- und Südseite in Frage, weil er auf die Ostwand
übergreift. Das Schlangenfresko wurde weiß übertüncht aufgefunden. Diese dünne letzte Schicht, die sich nicht erhalten hat, war mit grünen
und roten Streifen versehen, aber offenbar bildlos. Sie kann gleichzeitig mit der 3. Schicht, aber auch noch später sein.
Datierung
1. -3. Schicht
Die erste Schicht könnte noch ins 1. Jh. n. Chr. gehören, da sie sich auf der Südseite desselben Nordwest-Pfeilers findet, der weiter westlich
ebenfalls severisch verbaute Reste der Gang-Dekoration des 1. Jh. n. Chr. trägt. Andererseits zeigt sie unter ihrer dem frühen 3. Jh. angehörenden
Vermauerung keine weitere Schicht, so daß sie eher zu der sicher erst im 2. Jh. möglichen älteren Verputzung der damals geschlossenen Ostwand
zu rechnen ist.
Die zweite Schicht, die auf dem severischen Ziegelpfeiler liegt, wird durch diesen bzw. H 2/21 (1.) frühestens ins 3. Jh. datiert. Die Türvermaue-
rungen der Nord- und Südwand sind wegen der Mauertechnik samt ihrem Putz als 3. Schicht ins 5. Jh. zu setzen.
Die sehr verblaßte Schlange erlaubt keine stilistische Beurteilung. Da die Vermauerung der Tür nach H 2/6 auf den Putz der Ostseite des
Schlangenpfeilers übergreift und die Übertünchung der Schlangenmalerei technisch ihre nächste Parallele in H 2/14c (3.) hat (um 430/40,
s. S. 110), wird die Schlange der 2. Ausstattungsphase, damit frühestens der 1. Hälfte des 3. Jh. n. Chr. zuzuschreiben sein.
Ikonographie
2. Schicht
Daß die Schlangenmalerei und das ihr gegenüber angebrachte Heroenrelief eine religiöse Bedeutung haben, läßt sich nicht nur aus ihrer
undekorativen Anbringung in einem vieltürigen Eingangsraum vermuten, sondern durch Parallelen beweisen. Zahlreich sind die Schlangen
(oder Schlangenpaare) in Malerei oder Stuck an den pompejanischen Lararien303, die anstelle oder neben einer figürlichen Opferszene den
Genius familiaris (bzw. den Genius des Hausherren und die Juno der Hausfrau) verkörpern304. Im griechischen Bereich befinden sich
302 Eichler, AnzWien 1963, 55 Taf. 2.
303 G. K. Boyce, Corpus of the Lararia of Pompeii, MemAmAc 14,1937 passim.
304 RE VII (1910) 1155-1170 s. v. Genius (W. F. Otto); EAA III (1960) 810 ff. s. v.
Genio (W. Fuchs).
92