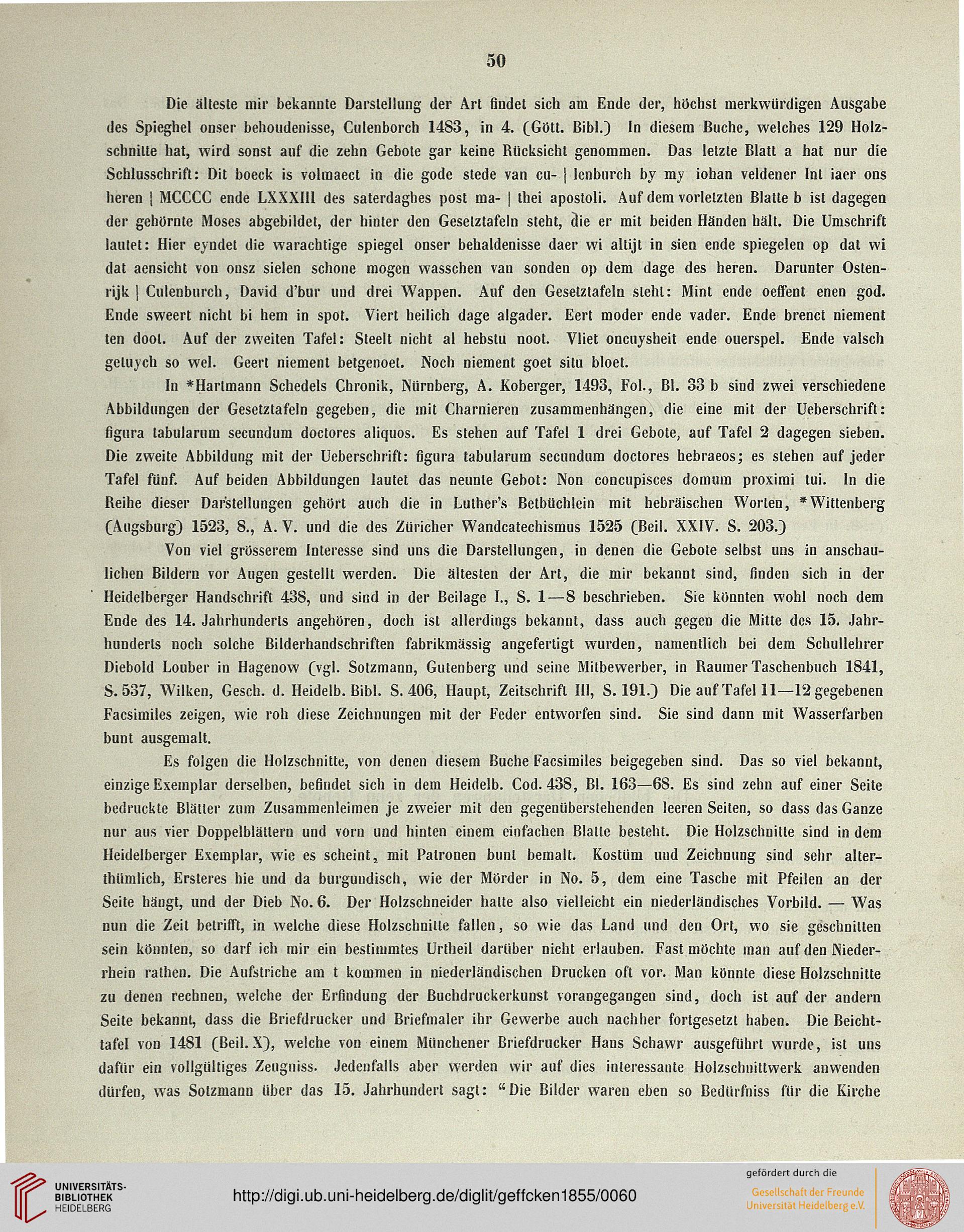50
Die älteste mir bekannte Darstellung der Art findet sich am Ende der, höchst merkwürdigen Ausgabe
des Spieghel onser behoudenisse, Culenborch 1483, in 4. (Gott, ßibl.) In diesem Buche, welches 129 Holz-
schnitte hat, wird sonst auf die zehn Gebote gar keine Rücksicht genommen. Das letzte Blatt a hat nur die
Schlusschrift: Dil boeck is volmaecl in die gode stede van cu- j lenburch by my iohan veldener Int iaer ons
heren | MCCCC ende LXXXI1I des saterdaghes post ma- | thei apostoli. Auf dem vorletzten Blatte b ist dagegen
der gehörnte Moses abgebildet, der hinter den Gesetztafeln steht, die er mit beiden Händen hält. Die Umschrift
lautet: Hier eyndet die warachtige Spiegel onser behaldenisse daer wi altijt in sien ende spiegelen op dat wi
dat aensicht von onsz sielen schone mögen wasschen van sonden op dem dage des heren. Darunter Osten-
rijk | Culenburch, David d'bur und drei Wappen. Auf den Gesetztafeln steht: Mint ende oeffent enen god.
Ende sweert nicht bi hem in spot. Viert heilich dage algader. Eert moder ende vader. Ende brenct niement
ten doot. Auf der zweiten Tafel: Steelt nicht al hebslu noot. Vliet oncuysheit ende ouerspel. Ende valsch
geluych so wel. Geert niement betgenoet. Noch niement goet situ bloet.
In *Hartmann Schedels Chronik, Nürnberg, A. Koberger, 1493, Fol., BI. 33 b sind zwei verschiedene
Abbildungen der Gesetztafeln gegeben, die mit Charnieren zusammenhängen, die eine mit der Ueberschrift:
figura tabularum secundum doctores aliquos. Es stehen auf Tafel 1 drei Gebote, auf Tafel 2 dagegen sieben.
Die zweite Abbildung mit der Ueberschrift: figura tabularum secundum doctores hebraeos; es stehen auf jeder
Tafel fünf. Auf beiden Abbildungen lautet das neunte Gebot: Non concupisces domum proximi tui. In die
Reihe dieser Darstellungen gehört auch die in Luther's Betbüchlein mit hebräischen Worten, "Wittenberg
(Augsburg) 1523, 8., A. V. und die des Züricher Wandcatechismus 1525 (Beil. XXIV. S. 203.)
Von viel grösserem Interesse sind uns die Darstellungen, in denen die Gebote selbst uns in anschau-
lichen Bildern vor Augen gestellt werden. Die ältesten der Art, die mir bekannt sind, finden sich in der
Heidelberger Handschrift 438, und sind in der Beilage I., S. 1—8 beschrieben. Sie könnten wohl noch dem
Ende des 14. Jahrhunderts angehören, doch ist allerdings bekannt, dass auch gegen die Mitte des 15. Jahr-
hunderts noch solche Bilderhandschriften fabrikmässig angefertigt wurden, namentlich bei dem Schullehrer
Diebold Louber in Hagenow (vgl. Sotzmann, Gutenberg und seine Mitbewerber, in Raumer Taschenbuch 1841,
S.537, Wilken, Gesch. d. Heidelb. Bibl. S. 406, Haupt, Zeitschrift III, S. 191.) Die auf Tafel 11—12 gegebenen
Facsimiles zeigen, wie roh diese Zeichnungen mit der Feder entworfen sind. Sie sind dann mit Wasserfarben
bunt ausgemalt.
Es folgen die Holzschnitte, von denen diesem Buche Facsimiles beigegeben sind. Das so viel bekannt,
einzige Exemplar derselben, befindet sich in dem Heidelb. Cod. 438, BI. 163—68. Es sind zehn auf einer Seite
bedruckte Blätter zum Zusammenleimen je zweier mit den gegenüberstehenden leeren Seiten, so dass das Ganze
nur aus vier Doppelblällern und vorn und hinten einem einfachen Blatte besteht. Die Holzschnitte sind in dem
Heidelberger Exemplar, wie es scheint, mit Palronen bunt bemalt. Kostüm und Zeichnung sind sehr alter-
thümlich, Ersteres hie und da burgundisch, wie der Mörder in No. 5, dem eine Tasche mit Pfeilen an der
Seite hängt, und der Dieb No. 6. Der Holzschneider hatte also vielleicht ein niederländisches Vorbild. — Was
nun die Zeit betrifft, in welche diese Holzschnitte fallen, so wie das Land und den Ort, wo sie geschnitten
sein könnten, so darf ich mir ein bestimmtes Urtheil darüber nicht erlauben. Fast möchte man auf den Nieder-
rhein rathen. Die Aufstriche am t kommen in niederländischen Drucken oft vor. Man könnte diese Holzschnitte
zu denen rechnen, welche der Erfindung der ßuchdruckerkunst vorangegangen sind, doch ist auf der andern
Seite bekannt, dass die Briefdrucker und Briefmaler ihr Gewerbe auch nachher fortgesetzt haben. Die Beicht-
tafel von 1481 (Beil. X), welche von einem Münchener ßriefdrucker Hans Schawr ausgeführt wurde, ist uns
dafür ein vollgültiges Zeugniss. Jedenfalls aber werden wir auf dies interessante Holzschnittwerk anwenden
dürfen, was Sotzmann über das 15. Jahrhundert sagt: "Die Bilder waren eben so Bedürfniss für die Kirche
Die älteste mir bekannte Darstellung der Art findet sich am Ende der, höchst merkwürdigen Ausgabe
des Spieghel onser behoudenisse, Culenborch 1483, in 4. (Gott, ßibl.) In diesem Buche, welches 129 Holz-
schnitte hat, wird sonst auf die zehn Gebote gar keine Rücksicht genommen. Das letzte Blatt a hat nur die
Schlusschrift: Dil boeck is volmaecl in die gode stede van cu- j lenburch by my iohan veldener Int iaer ons
heren | MCCCC ende LXXXI1I des saterdaghes post ma- | thei apostoli. Auf dem vorletzten Blatte b ist dagegen
der gehörnte Moses abgebildet, der hinter den Gesetztafeln steht, die er mit beiden Händen hält. Die Umschrift
lautet: Hier eyndet die warachtige Spiegel onser behaldenisse daer wi altijt in sien ende spiegelen op dat wi
dat aensicht von onsz sielen schone mögen wasschen van sonden op dem dage des heren. Darunter Osten-
rijk | Culenburch, David d'bur und drei Wappen. Auf den Gesetztafeln steht: Mint ende oeffent enen god.
Ende sweert nicht bi hem in spot. Viert heilich dage algader. Eert moder ende vader. Ende brenct niement
ten doot. Auf der zweiten Tafel: Steelt nicht al hebslu noot. Vliet oncuysheit ende ouerspel. Ende valsch
geluych so wel. Geert niement betgenoet. Noch niement goet situ bloet.
In *Hartmann Schedels Chronik, Nürnberg, A. Koberger, 1493, Fol., BI. 33 b sind zwei verschiedene
Abbildungen der Gesetztafeln gegeben, die mit Charnieren zusammenhängen, die eine mit der Ueberschrift:
figura tabularum secundum doctores aliquos. Es stehen auf Tafel 1 drei Gebote, auf Tafel 2 dagegen sieben.
Die zweite Abbildung mit der Ueberschrift: figura tabularum secundum doctores hebraeos; es stehen auf jeder
Tafel fünf. Auf beiden Abbildungen lautet das neunte Gebot: Non concupisces domum proximi tui. In die
Reihe dieser Darstellungen gehört auch die in Luther's Betbüchlein mit hebräischen Worten, "Wittenberg
(Augsburg) 1523, 8., A. V. und die des Züricher Wandcatechismus 1525 (Beil. XXIV. S. 203.)
Von viel grösserem Interesse sind uns die Darstellungen, in denen die Gebote selbst uns in anschau-
lichen Bildern vor Augen gestellt werden. Die ältesten der Art, die mir bekannt sind, finden sich in der
Heidelberger Handschrift 438, und sind in der Beilage I., S. 1—8 beschrieben. Sie könnten wohl noch dem
Ende des 14. Jahrhunderts angehören, doch ist allerdings bekannt, dass auch gegen die Mitte des 15. Jahr-
hunderts noch solche Bilderhandschriften fabrikmässig angefertigt wurden, namentlich bei dem Schullehrer
Diebold Louber in Hagenow (vgl. Sotzmann, Gutenberg und seine Mitbewerber, in Raumer Taschenbuch 1841,
S.537, Wilken, Gesch. d. Heidelb. Bibl. S. 406, Haupt, Zeitschrift III, S. 191.) Die auf Tafel 11—12 gegebenen
Facsimiles zeigen, wie roh diese Zeichnungen mit der Feder entworfen sind. Sie sind dann mit Wasserfarben
bunt ausgemalt.
Es folgen die Holzschnitte, von denen diesem Buche Facsimiles beigegeben sind. Das so viel bekannt,
einzige Exemplar derselben, befindet sich in dem Heidelb. Cod. 438, BI. 163—68. Es sind zehn auf einer Seite
bedruckte Blätter zum Zusammenleimen je zweier mit den gegenüberstehenden leeren Seiten, so dass das Ganze
nur aus vier Doppelblällern und vorn und hinten einem einfachen Blatte besteht. Die Holzschnitte sind in dem
Heidelberger Exemplar, wie es scheint, mit Palronen bunt bemalt. Kostüm und Zeichnung sind sehr alter-
thümlich, Ersteres hie und da burgundisch, wie der Mörder in No. 5, dem eine Tasche mit Pfeilen an der
Seite hängt, und der Dieb No. 6. Der Holzschneider hatte also vielleicht ein niederländisches Vorbild. — Was
nun die Zeit betrifft, in welche diese Holzschnitte fallen, so wie das Land und den Ort, wo sie geschnitten
sein könnten, so darf ich mir ein bestimmtes Urtheil darüber nicht erlauben. Fast möchte man auf den Nieder-
rhein rathen. Die Aufstriche am t kommen in niederländischen Drucken oft vor. Man könnte diese Holzschnitte
zu denen rechnen, welche der Erfindung der ßuchdruckerkunst vorangegangen sind, doch ist auf der andern
Seite bekannt, dass die Briefdrucker und Briefmaler ihr Gewerbe auch nachher fortgesetzt haben. Die Beicht-
tafel von 1481 (Beil. X), welche von einem Münchener ßriefdrucker Hans Schawr ausgeführt wurde, ist uns
dafür ein vollgültiges Zeugniss. Jedenfalls aber werden wir auf dies interessante Holzschnittwerk anwenden
dürfen, was Sotzmann über das 15. Jahrhundert sagt: "Die Bilder waren eben so Bedürfniss für die Kirche