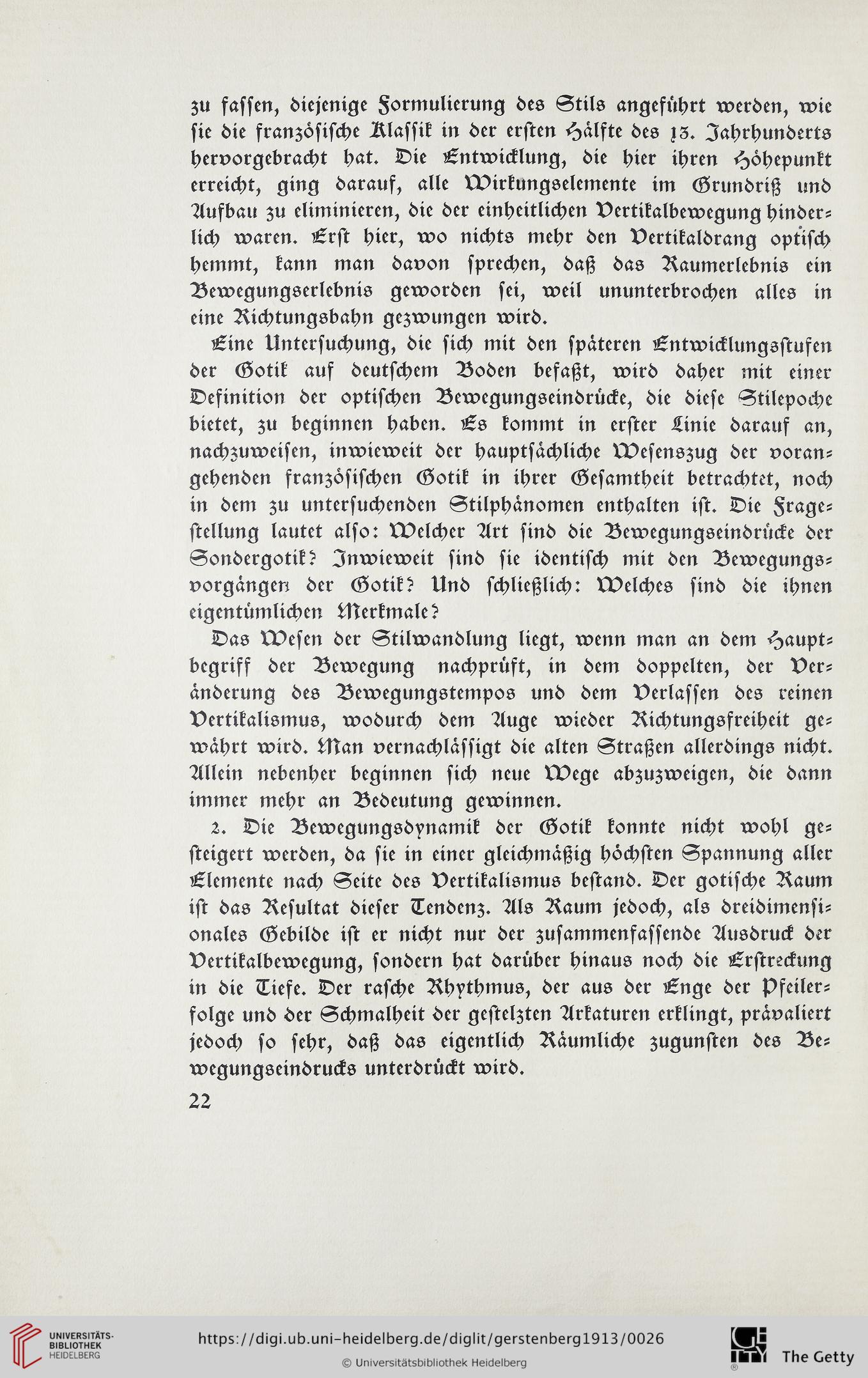zu fassen, diejenige Formulierung des Stils angeführt werden, wie
sie die französische Klassik in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
hervorgebracht hat. Die Entwicklung, die hier ihren Höhepunkt
erreicht, ging darauf, alle Wirkungselemente im Grundriß und
Aufbau zu eliminieren, die der einheitlichen Vertikalbewegung hinder-
lich waren. Erst hier, wo nichts mehr den Vertikaldrang optisch
hemmt, kann man davon sprechen, daß das Raumerlebnis ein
Bewegungserlebnis geworden sei, weil ununterbrochen alles in
eine Richtungsbahn gezwungen wird.
Eine Untersuchung, die sich mit den späteren Entwicklungsstufen
der Gotik auf deutschem Boden befaßt, wird daher mit einer
Definition der optischen Bewegungseindrücke, die diese Stilepoche
bietet, zu beginnen haben. Es kommt in erster Linie darauf an,
nachzuweisen, inwieweit der hauptsächliche Wesenszug der voran-
gehenden französischen Gotik in ihrer Gesamtheit betrachtet, noch
in dem zu untersuchenden Stilphänomen enthalten ist. Die Frage-
stellung lautet also: Welcher Art sind die Bewegungseindrücke der
Sondergotik) Inwieweit sind sie identisch mit den Bewegungs-
vorgängen der Gotik) Und schließlich: welches sind die ihnen
eigentümlichen Merkmale)
Das Wesen der Stilwandlung liegt, wenn man an dem Haupt-
begriff der Bewegung nachprüft, in dem doppelten, der Ver-
änderung des Bewegungstempos und dem Verlassen des reinen
Vertikalismus, wodurch dem Auge wieder Richtungsfreiheit ge-
währt wird. Man vernachlässigt die alten Straßen allerdings nicht.
Allein nebenher beginnen sich neue Wege abzuzweigen, die dann
immer mehr an Bedeutung gewinnen.
2. Die Bewegungsdynamik der Gotik konnte nicht wohl ge-
steigert werden, da sie in einer gleichmäßig höchsten Spannung aller
Elemente nach Seite des Vertikalismus bestand. Der gotische Raum
ist das Resultat dieser Tendenz. Als Raum jedoch, als dreidimensi-
onales Gebilde ist er nicht nur der zusammenfassende Ausdruck der
Vertikalbewegung, sondern hat darüber hinaus noch die Erstreckung
in die Tiefe. Der rasche Rhythmus, der aus der Enge der Pfeiler-
folge und der Schmalheit der gestelzten Arkaturen erklingt, prävaliert
jedoch so sehr, daß das eigentlich Räumliche zugunsten des Be-
wegungseindrucks unterdrückt wird.
22
sie die französische Klassik in der ersten Hälfte des Jahrhunderts
hervorgebracht hat. Die Entwicklung, die hier ihren Höhepunkt
erreicht, ging darauf, alle Wirkungselemente im Grundriß und
Aufbau zu eliminieren, die der einheitlichen Vertikalbewegung hinder-
lich waren. Erst hier, wo nichts mehr den Vertikaldrang optisch
hemmt, kann man davon sprechen, daß das Raumerlebnis ein
Bewegungserlebnis geworden sei, weil ununterbrochen alles in
eine Richtungsbahn gezwungen wird.
Eine Untersuchung, die sich mit den späteren Entwicklungsstufen
der Gotik auf deutschem Boden befaßt, wird daher mit einer
Definition der optischen Bewegungseindrücke, die diese Stilepoche
bietet, zu beginnen haben. Es kommt in erster Linie darauf an,
nachzuweisen, inwieweit der hauptsächliche Wesenszug der voran-
gehenden französischen Gotik in ihrer Gesamtheit betrachtet, noch
in dem zu untersuchenden Stilphänomen enthalten ist. Die Frage-
stellung lautet also: Welcher Art sind die Bewegungseindrücke der
Sondergotik) Inwieweit sind sie identisch mit den Bewegungs-
vorgängen der Gotik) Und schließlich: welches sind die ihnen
eigentümlichen Merkmale)
Das Wesen der Stilwandlung liegt, wenn man an dem Haupt-
begriff der Bewegung nachprüft, in dem doppelten, der Ver-
änderung des Bewegungstempos und dem Verlassen des reinen
Vertikalismus, wodurch dem Auge wieder Richtungsfreiheit ge-
währt wird. Man vernachlässigt die alten Straßen allerdings nicht.
Allein nebenher beginnen sich neue Wege abzuzweigen, die dann
immer mehr an Bedeutung gewinnen.
2. Die Bewegungsdynamik der Gotik konnte nicht wohl ge-
steigert werden, da sie in einer gleichmäßig höchsten Spannung aller
Elemente nach Seite des Vertikalismus bestand. Der gotische Raum
ist das Resultat dieser Tendenz. Als Raum jedoch, als dreidimensi-
onales Gebilde ist er nicht nur der zusammenfassende Ausdruck der
Vertikalbewegung, sondern hat darüber hinaus noch die Erstreckung
in die Tiefe. Der rasche Rhythmus, der aus der Enge der Pfeiler-
folge und der Schmalheit der gestelzten Arkaturen erklingt, prävaliert
jedoch so sehr, daß das eigentlich Räumliche zugunsten des Be-
wegungseindrucks unterdrückt wird.
22