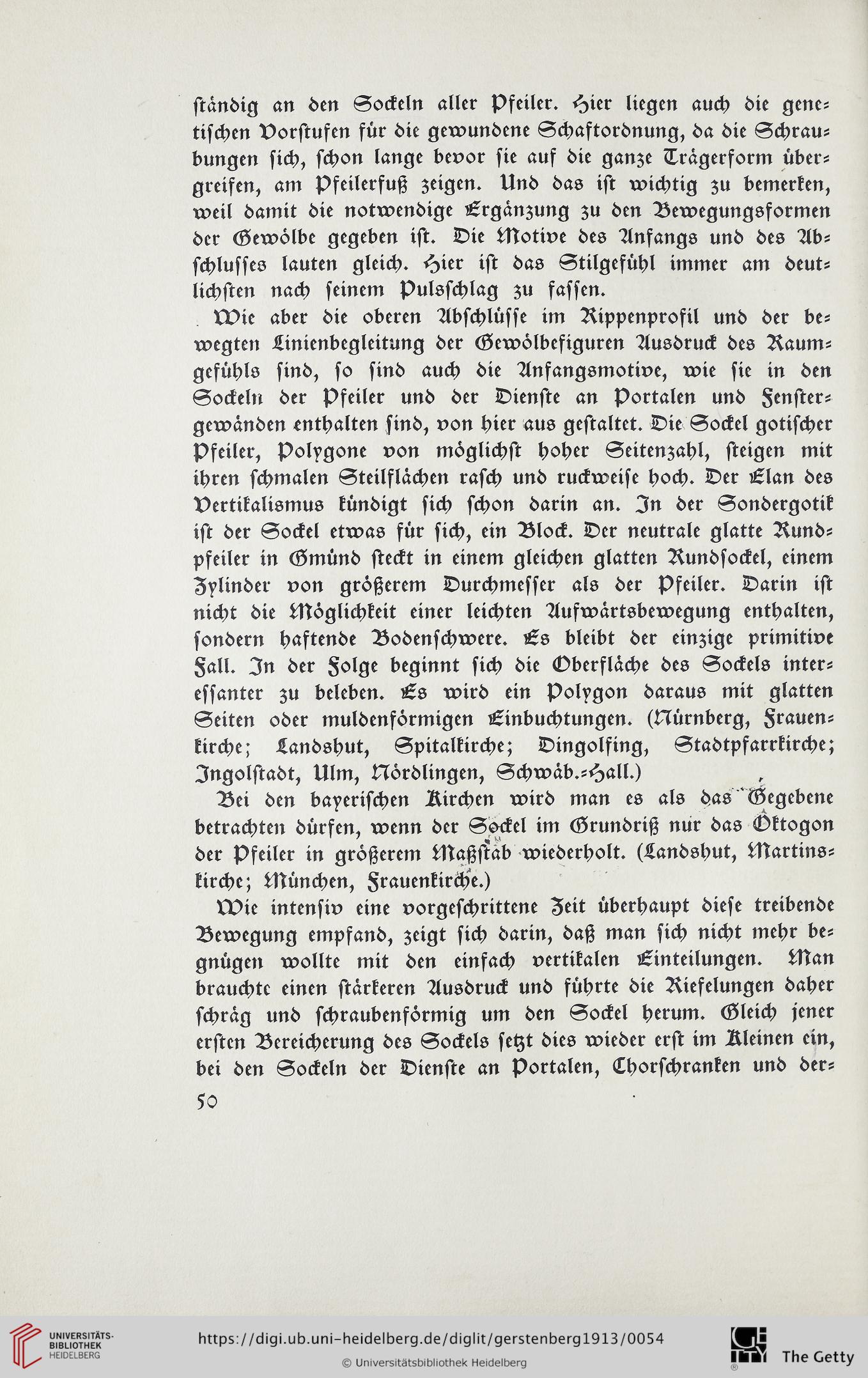ständig an den Sockeln aller Pfeiler. Hier liegen auch die gene-
tischen Vorstufen für die gewundene Schaftordnung, da die Schrau-
bungen sich, schon lange bevor sie auf die ganze Trägerform über-
greifen, am Pfeilerfuß zeigen. Und das ist wichtig zu bemerken,
weil damit die notwendige Ergänzung zu den Bewegungsformen
der Gewölbe gegeben ist. Die Motive des Anfangs und des Ab-
schlusses lauten gleich. Hier ist das Stilgefühl immer am deut-
lichsten nach seinem Pulsschlag zu fassen.
Wie aber die oberen Abschlüsse im Rippenprosil und der be-
wegten Linienbegleitung der Gewölbefiguren Ausdruck des Raum-
gefühls sind, so sind auch die Anfangsmotive, wie sie in den
Sockeln der Pfeiler und der Dienste an Portalen und Fenster-
gewänden enthalten sind, von hier aus gestaltet. Die Sockel gotischer
Pfeiler, Polygone von möglichst hoher Seitenzahl, steigen mit
ihren schmalen Stellflächen rasch und ruckweise hoch. Der Elan des
Vertikalismus kündigt sich schon darin an. In der Sondergotik
ist der Gockel etwas für sich, ein Block. Der neutrale glatte Rund-
pfeiler in Gmünd steckt in einem gleichen glatten Rundsockel, einem
Zylinder von größerem Durchmesser als der Pfeiler. Darin ist
nicht die Möglichkeit einer leichten Aufwärtsbewegung enthalten,
sondern haftende Bodenschwere. Es bleibt der einzige primitive
Fall. In der Folge beginnt sich die Oberfläche des Sockels inter-
essanter zu beleben. Es wird ein Polygon daraus mit glatten
Seiten oder muldenförmigen Einbuchtungen. (Nürnberg, Frauen-
kirche; Landshut, Spitalkirche; Dingolfing, Stadtpfarrkirche;
Ingolstadt, Ulm, Nördlingen, Schwäb.-Hall.)
Bei den bayerischen Kirchen wird man es als das Gegebene
betrachten dürfen, wenn der Sockel im Grundriß nur das Oktogon
der Pfeiler in größerem Maßstab wiederholt. (Landshut, Martins-
kirche; München, Frauenkirche.)
Wie intensiv eine vorgeschrittene Zeit überhaupt diese treibende
Bewegung empfand, zeigt sich darin, daß man sich nicht mehr be-
gnügen wollte mit den einfach vertikalen Einteilungen. Man
brauchte einen stärkeren Ausdruck und führte die Riefelungen daher
schräg und schraubenförmig um den Sockel herum. Gleich jener
ersten Bereicherung des Sockels setzt dies wieder erst im Kleinen ein,
bei den Sockeln der Dienste an Portalen, Lhorschranken und der-
50
tischen Vorstufen für die gewundene Schaftordnung, da die Schrau-
bungen sich, schon lange bevor sie auf die ganze Trägerform über-
greifen, am Pfeilerfuß zeigen. Und das ist wichtig zu bemerken,
weil damit die notwendige Ergänzung zu den Bewegungsformen
der Gewölbe gegeben ist. Die Motive des Anfangs und des Ab-
schlusses lauten gleich. Hier ist das Stilgefühl immer am deut-
lichsten nach seinem Pulsschlag zu fassen.
Wie aber die oberen Abschlüsse im Rippenprosil und der be-
wegten Linienbegleitung der Gewölbefiguren Ausdruck des Raum-
gefühls sind, so sind auch die Anfangsmotive, wie sie in den
Sockeln der Pfeiler und der Dienste an Portalen und Fenster-
gewänden enthalten sind, von hier aus gestaltet. Die Sockel gotischer
Pfeiler, Polygone von möglichst hoher Seitenzahl, steigen mit
ihren schmalen Stellflächen rasch und ruckweise hoch. Der Elan des
Vertikalismus kündigt sich schon darin an. In der Sondergotik
ist der Gockel etwas für sich, ein Block. Der neutrale glatte Rund-
pfeiler in Gmünd steckt in einem gleichen glatten Rundsockel, einem
Zylinder von größerem Durchmesser als der Pfeiler. Darin ist
nicht die Möglichkeit einer leichten Aufwärtsbewegung enthalten,
sondern haftende Bodenschwere. Es bleibt der einzige primitive
Fall. In der Folge beginnt sich die Oberfläche des Sockels inter-
essanter zu beleben. Es wird ein Polygon daraus mit glatten
Seiten oder muldenförmigen Einbuchtungen. (Nürnberg, Frauen-
kirche; Landshut, Spitalkirche; Dingolfing, Stadtpfarrkirche;
Ingolstadt, Ulm, Nördlingen, Schwäb.-Hall.)
Bei den bayerischen Kirchen wird man es als das Gegebene
betrachten dürfen, wenn der Sockel im Grundriß nur das Oktogon
der Pfeiler in größerem Maßstab wiederholt. (Landshut, Martins-
kirche; München, Frauenkirche.)
Wie intensiv eine vorgeschrittene Zeit überhaupt diese treibende
Bewegung empfand, zeigt sich darin, daß man sich nicht mehr be-
gnügen wollte mit den einfach vertikalen Einteilungen. Man
brauchte einen stärkeren Ausdruck und führte die Riefelungen daher
schräg und schraubenförmig um den Sockel herum. Gleich jener
ersten Bereicherung des Sockels setzt dies wieder erst im Kleinen ein,
bei den Sockeln der Dienste an Portalen, Lhorschranken und der-
50