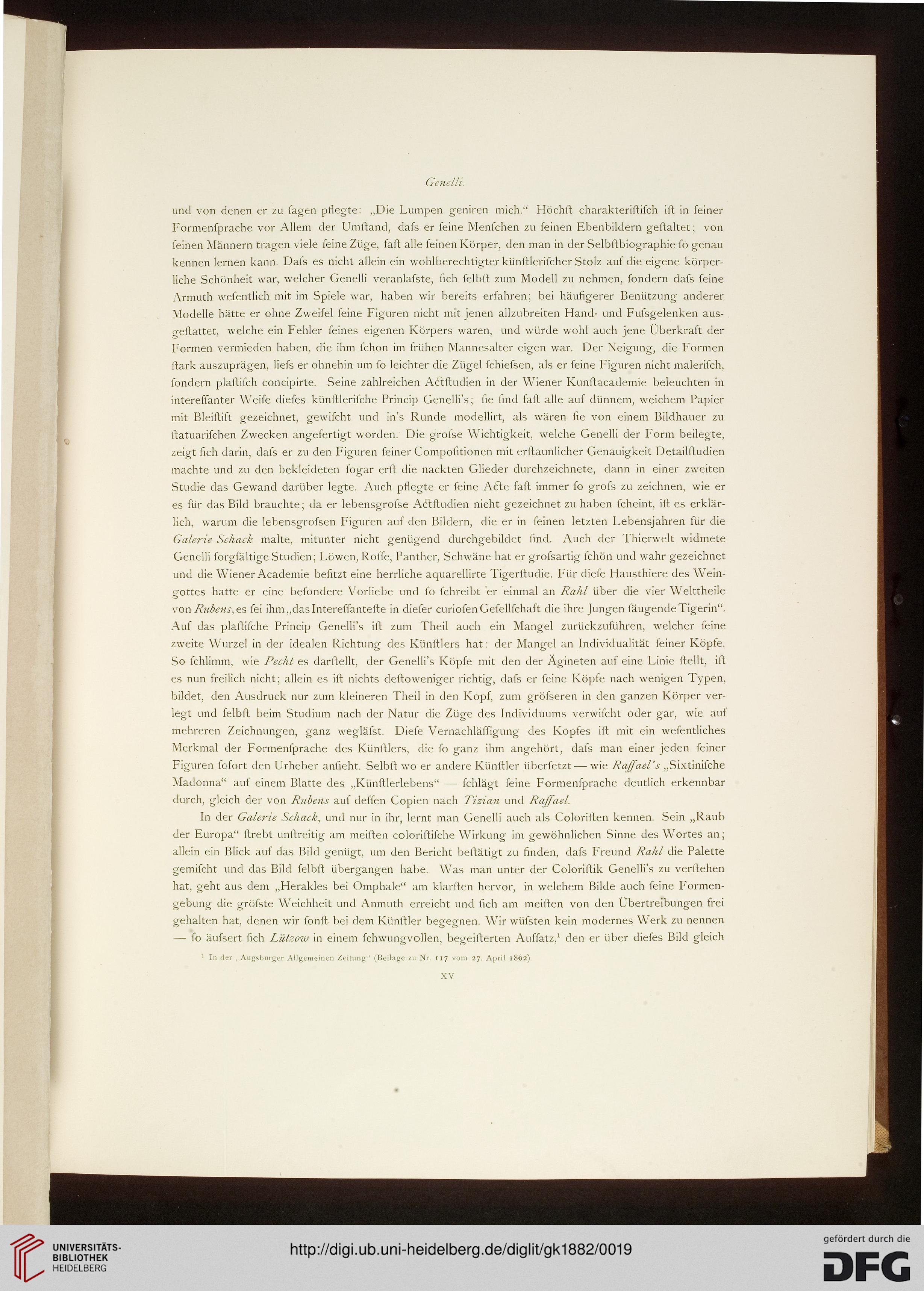Genelli.
und von denen er zu sagen pssegte: „Die Lumpen geniren mich." Höchst charakteristisch ill in seiner
Formensprache vor Allem der Umstand, dass er seine Menschen zu seinen Ebenbildern gestaltet; von
seinen Männern tragen viele seine Züge, fast alle seinen Körper, den man in der Selbstbiographie so genau
kennen lernen kann. Dass es nicht allein ein wohlberechtigter künstlerischer Stolz auf die eigene körper-
liche Schönheit war, welcher Genelli veranlasste, sich selbst zum Modell zu nehmen, sondern dass seine
Armuth wesentlich mit im Spiele war, haben wir bereits erfahren; bei häufigerer Benützung anderer
Modelle hätte er ohne Zweifel seine Figuren nicht mit jenen allzubreiten Hand- und Fussgelenken aus-
gestattet, welche ein Fehler seines eigenen Körpers waren, und würde wohl auch jene Überkraft der
Formen vermieden haben, die ihm schon im frühen Mannesalter eigen war. Der Neigung, die Formen
stark auszuprägen, liess er ohnehin um so leichter die Zügel schiessen, als er seine Figuren nicht malerisch,
sondern plastisch concipirte. Seine zahlreichen Aftstudien in der Wiener Kunstacademie beleuchten in
interessanter Weise dieses künstlerische Princip Genelli's; sie sind fast alle auf dünnem, weichem Papier
mit Bleistift gezeichnet, gewischt und in's Runde modellirt, als wären sie von einem Bildhauer zu
statuarischen Zwecken angefertigt worden. Die grosse Wichtigkeit, welche Genelli der Form beilegte,
zeigt sich darin, dass er zu den Figuren seiner Compositionen mit erstaunlicher Genauigkeit Detailstudien
machte und zu den bekleideten sogar erst die nackten Glieder durchzeichnete, dann in einer zweiten
Studie das Gewand darüber legte. Auch pssegte er seine Acfte fast immer so gross zu zeichnen, wie er
es für das Bild brauchte; da er lebensgrosse Aclstudien nicht gezeichnet zu haben scheint, ist es erklär-
lich, warum die lebensgrossen Figuren auf den Bildern, die er in seinen letzten Lebensjahren tür die
Galerie Schack malte, mitunter nicht genügend durchgebildet sind. Auch der Thierwelt widmete
Genelli sorofältio;e Studien; Löwen, Rolse, Panther, Schwäne hat er orossartiu- schön und wahr o-ezeichnet
und die Wiener Academie besitzt eine herrliche aquarellirte Tigerstudie. Für diele Hausthiere des Wein-
gottes hatte er eine besondere Vorliebe und so schreibt er einmal an Rahl über die vier Welttheile
von Rubens,es sei ihm,,daslnteresfanteste in dieser curiosenGesellschaft die ihre Jungen säugendeTigerin",
Auf das plastische Princip Genelli's ist zum Theil auch ein Mangel zurückzuführen, welcher seine
zweite Wurzel in der idealen Richtung des Künstlers hat: der Mangel an Individualität seiner Kopte.
So schlimm, wie Pecht es darstellt, der Genelli's Köpfe mit den der Ägineten auf eine Linie stellt, ist
es nun freilich nicht; allein es ist nichts destoweniger richtig, dass er seine Köpfe nach wenigen Typen,
bildet, den Ausdruck nur zum kleineren Theil in den Kopf, zum grösseren in den ganzen Körper ver-
legt und selbst beim Studium nach der Natur die Züge des Individuums verwischt oder gar, wie auf
mehreren Zeichnungen, ganz weglässt. Diese Vernachlässigung des Kopfes ist mit ein wesentliches
Merkmal der Formensprache des Künstlers, die so ganz ihm angehört, dass man einer jeden seiner
Figuren sofort den Urheber ansseht. Selbst wo er andere Künstler übersetzt — wie Raffael's „Sixtinische
Madonna" auf einem Blatte des „Künstlerlebens" — schlägt seine Formensprache deutlich erkennbar
durch, gleich der von Rubens auf dessen Copien nach Tizian und Raffael.
In der Galerie Schack, und nur in ihr, lernt man Genelli auch als Coloristen kennen. Sein „Raub
der Europa" strebt unstreitig am meisten coloristische Wirkung im gewöhnlichen Sinne des Wortes an;
allein ein Blick auf das Bild genügt, um den Bericht bestätigt zu finden, dass Freund Rahl die Palette
gemischt und das Bild selbst übergangen habe. Was man unter der Coloristik Genelli's zu verstehen
hat, geht aus dem „Herakles bei Omphale" am klarsten hervor, in welchem Bilde auch seine Formen-
gebung die grösste Weichheit und Anmuth erreicht und sich am meisten von den Übertreibungen frei
gehalten hat, denen wir sonst bei dem Künstler begegnen. Wir wüssten kein modernes Werk zu nennen
— so äussert sseh Lütsow in einem schwunevollen, be^eisterten Auffatz,1 den er über dieses Bild gleich
1 In der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" (Beilage zu Nr. 117 vom 27. April 1862)
XV
und von denen er zu sagen pssegte: „Die Lumpen geniren mich." Höchst charakteristisch ill in seiner
Formensprache vor Allem der Umstand, dass er seine Menschen zu seinen Ebenbildern gestaltet; von
seinen Männern tragen viele seine Züge, fast alle seinen Körper, den man in der Selbstbiographie so genau
kennen lernen kann. Dass es nicht allein ein wohlberechtigter künstlerischer Stolz auf die eigene körper-
liche Schönheit war, welcher Genelli veranlasste, sich selbst zum Modell zu nehmen, sondern dass seine
Armuth wesentlich mit im Spiele war, haben wir bereits erfahren; bei häufigerer Benützung anderer
Modelle hätte er ohne Zweifel seine Figuren nicht mit jenen allzubreiten Hand- und Fussgelenken aus-
gestattet, welche ein Fehler seines eigenen Körpers waren, und würde wohl auch jene Überkraft der
Formen vermieden haben, die ihm schon im frühen Mannesalter eigen war. Der Neigung, die Formen
stark auszuprägen, liess er ohnehin um so leichter die Zügel schiessen, als er seine Figuren nicht malerisch,
sondern plastisch concipirte. Seine zahlreichen Aftstudien in der Wiener Kunstacademie beleuchten in
interessanter Weise dieses künstlerische Princip Genelli's; sie sind fast alle auf dünnem, weichem Papier
mit Bleistift gezeichnet, gewischt und in's Runde modellirt, als wären sie von einem Bildhauer zu
statuarischen Zwecken angefertigt worden. Die grosse Wichtigkeit, welche Genelli der Form beilegte,
zeigt sich darin, dass er zu den Figuren seiner Compositionen mit erstaunlicher Genauigkeit Detailstudien
machte und zu den bekleideten sogar erst die nackten Glieder durchzeichnete, dann in einer zweiten
Studie das Gewand darüber legte. Auch pssegte er seine Acfte fast immer so gross zu zeichnen, wie er
es für das Bild brauchte; da er lebensgrosse Aclstudien nicht gezeichnet zu haben scheint, ist es erklär-
lich, warum die lebensgrossen Figuren auf den Bildern, die er in seinen letzten Lebensjahren tür die
Galerie Schack malte, mitunter nicht genügend durchgebildet sind. Auch der Thierwelt widmete
Genelli sorofältio;e Studien; Löwen, Rolse, Panther, Schwäne hat er orossartiu- schön und wahr o-ezeichnet
und die Wiener Academie besitzt eine herrliche aquarellirte Tigerstudie. Für diele Hausthiere des Wein-
gottes hatte er eine besondere Vorliebe und so schreibt er einmal an Rahl über die vier Welttheile
von Rubens,es sei ihm,,daslnteresfanteste in dieser curiosenGesellschaft die ihre Jungen säugendeTigerin",
Auf das plastische Princip Genelli's ist zum Theil auch ein Mangel zurückzuführen, welcher seine
zweite Wurzel in der idealen Richtung des Künstlers hat: der Mangel an Individualität seiner Kopte.
So schlimm, wie Pecht es darstellt, der Genelli's Köpfe mit den der Ägineten auf eine Linie stellt, ist
es nun freilich nicht; allein es ist nichts destoweniger richtig, dass er seine Köpfe nach wenigen Typen,
bildet, den Ausdruck nur zum kleineren Theil in den Kopf, zum grösseren in den ganzen Körper ver-
legt und selbst beim Studium nach der Natur die Züge des Individuums verwischt oder gar, wie auf
mehreren Zeichnungen, ganz weglässt. Diese Vernachlässigung des Kopfes ist mit ein wesentliches
Merkmal der Formensprache des Künstlers, die so ganz ihm angehört, dass man einer jeden seiner
Figuren sofort den Urheber ansseht. Selbst wo er andere Künstler übersetzt — wie Raffael's „Sixtinische
Madonna" auf einem Blatte des „Künstlerlebens" — schlägt seine Formensprache deutlich erkennbar
durch, gleich der von Rubens auf dessen Copien nach Tizian und Raffael.
In der Galerie Schack, und nur in ihr, lernt man Genelli auch als Coloristen kennen. Sein „Raub
der Europa" strebt unstreitig am meisten coloristische Wirkung im gewöhnlichen Sinne des Wortes an;
allein ein Blick auf das Bild genügt, um den Bericht bestätigt zu finden, dass Freund Rahl die Palette
gemischt und das Bild selbst übergangen habe. Was man unter der Coloristik Genelli's zu verstehen
hat, geht aus dem „Herakles bei Omphale" am klarsten hervor, in welchem Bilde auch seine Formen-
gebung die grösste Weichheit und Anmuth erreicht und sich am meisten von den Übertreibungen frei
gehalten hat, denen wir sonst bei dem Künstler begegnen. Wir wüssten kein modernes Werk zu nennen
— so äussert sseh Lütsow in einem schwunevollen, be^eisterten Auffatz,1 den er über dieses Bild gleich
1 In der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" (Beilage zu Nr. 117 vom 27. April 1862)
XV