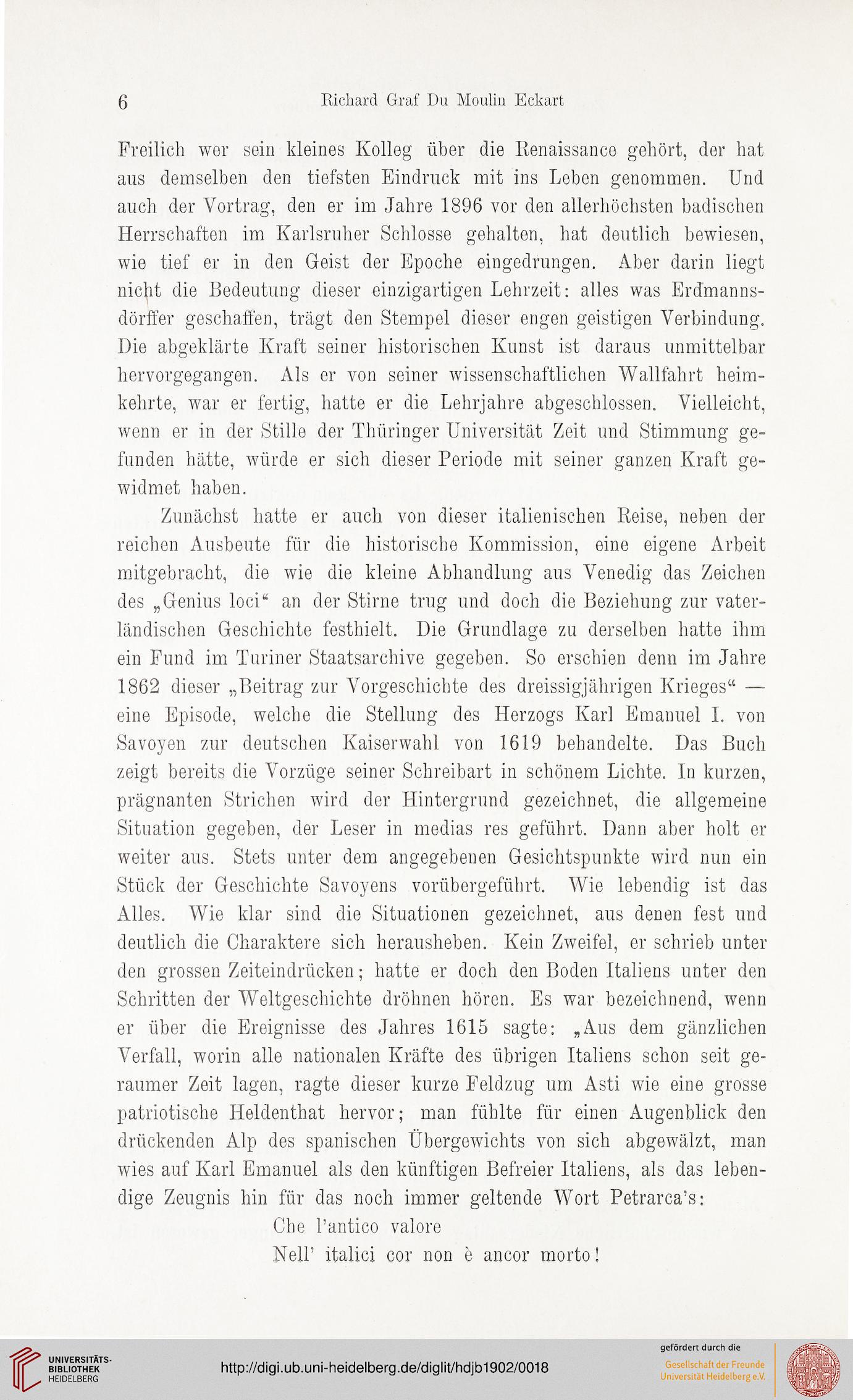6
Richard Graf Du Mouliu Eckart
Freilich wer sein kleines Kolleg über die Renaissance gehört, der hat
aus demselben den tiefsten Eindruck mit ins Leben genommen. Und
auch der Vortrag, den er im Jahre 1896 vor den allerhöchsten badischen
Herrschaften im Karlsruher Schlosse gehalten, hat deutlich bewiesen,
wie tief er in den Geist der Epoche eingedrungen. Aber darin liegt
nicht die Bedeutung dieser einzigartigen Lehrzeit: alles was Erdmanns-
dörffer geschaffen, trägt den Stempel dieser engen geistigen Verbindung.
Die abgeklärte Kraft seiner historischen Kunst ist daraus unmittelbar
hervorgegangen. Als er von seiner wissenschaftlichen Wallfahrt heim-
kehrte, war er fertig, hatte er die Lehrjahre abgeschlossen. Vielleicht,
wenn er in der Stille der Thüringer Universität Zeit und Stimmung ge-
funden hätte, würde er sich dieser Periode mit seiner ganzen Kraft ge-
widmet haben.
Zunächst hatte er auch von dieser italienischen Reise, neben der
reichen Ausbeute für die historische Kommission, eine eigene Arbeit
mitgebracht, die wie die kleine Abhandlung aus Venedig das Zeichen
des „Genius loci“ an der Stirne trug und doch die Beziehung zur vater-
ländischen Geschichte festhielt. Die Grundlage zu derselben hatte ihm
ein Fund im Turiner Staatsarchive gegeben. So erschien denn im Jahre
1862 dieser „Beitrag zur Vorgeschichte des dreissigjährigen Krieges“ —
eine Episode, welche die Stellung des Herzogs Karl Emanuel I. von
Savoyen zur deutschen Kaiserwahl von 1619 behandelte. Das Buch
zeigt bereits die Vorzüge seiner Schreibart in schönem Lichte. In kurzen,
prägnanten Strichen wird der Hintergrund gezeichnet, die allgemeine
Situation gegeben, der Leser in medias res geführt. Dann aber holt er
weiter aus. Stets unter dem angegebenen Gesichtspunkte wird nun ein
Stück der Geschichte Savoyens vorübergeführt. Wie lebendig ist das
Alles. Wie klar sind die Situationen gezeichnet, aus denen fest und
deutlich die Charaktere sich herausheben. Kein Zweifel, er schrieb unter
den grossen Zeiteindrücken; hatte er doch den Boden Italiens unter den
Schritten der Weltgeschichte dröhnen hören. Es war bezeichnend, wenn
er über die Ereignisse des Jahres 1615 sagte: „Aus dem gänzlichen
Verfall, worin alle nationalen Kräfte des übrigen Italiens schon seit ge-
raumer Zeit lagen, ragte dieser kurze Feldzug um Asti wie eine grosse
patriotische Heldenthat hervor; man fühlte für einen Augenblick den
drückenden Alp des spanischen Übergewichts von sich abgewälzt, man
wies auf Karl Emanuel als den künftigen Befreier Italiens, als das leben-
dige Zeugnis hin für das noch immer geltende Wort Petrarca’s:
Che l’antico valore
Nell’ italici cor non e ancor morto!
Richard Graf Du Mouliu Eckart
Freilich wer sein kleines Kolleg über die Renaissance gehört, der hat
aus demselben den tiefsten Eindruck mit ins Leben genommen. Und
auch der Vortrag, den er im Jahre 1896 vor den allerhöchsten badischen
Herrschaften im Karlsruher Schlosse gehalten, hat deutlich bewiesen,
wie tief er in den Geist der Epoche eingedrungen. Aber darin liegt
nicht die Bedeutung dieser einzigartigen Lehrzeit: alles was Erdmanns-
dörffer geschaffen, trägt den Stempel dieser engen geistigen Verbindung.
Die abgeklärte Kraft seiner historischen Kunst ist daraus unmittelbar
hervorgegangen. Als er von seiner wissenschaftlichen Wallfahrt heim-
kehrte, war er fertig, hatte er die Lehrjahre abgeschlossen. Vielleicht,
wenn er in der Stille der Thüringer Universität Zeit und Stimmung ge-
funden hätte, würde er sich dieser Periode mit seiner ganzen Kraft ge-
widmet haben.
Zunächst hatte er auch von dieser italienischen Reise, neben der
reichen Ausbeute für die historische Kommission, eine eigene Arbeit
mitgebracht, die wie die kleine Abhandlung aus Venedig das Zeichen
des „Genius loci“ an der Stirne trug und doch die Beziehung zur vater-
ländischen Geschichte festhielt. Die Grundlage zu derselben hatte ihm
ein Fund im Turiner Staatsarchive gegeben. So erschien denn im Jahre
1862 dieser „Beitrag zur Vorgeschichte des dreissigjährigen Krieges“ —
eine Episode, welche die Stellung des Herzogs Karl Emanuel I. von
Savoyen zur deutschen Kaiserwahl von 1619 behandelte. Das Buch
zeigt bereits die Vorzüge seiner Schreibart in schönem Lichte. In kurzen,
prägnanten Strichen wird der Hintergrund gezeichnet, die allgemeine
Situation gegeben, der Leser in medias res geführt. Dann aber holt er
weiter aus. Stets unter dem angegebenen Gesichtspunkte wird nun ein
Stück der Geschichte Savoyens vorübergeführt. Wie lebendig ist das
Alles. Wie klar sind die Situationen gezeichnet, aus denen fest und
deutlich die Charaktere sich herausheben. Kein Zweifel, er schrieb unter
den grossen Zeiteindrücken; hatte er doch den Boden Italiens unter den
Schritten der Weltgeschichte dröhnen hören. Es war bezeichnend, wenn
er über die Ereignisse des Jahres 1615 sagte: „Aus dem gänzlichen
Verfall, worin alle nationalen Kräfte des übrigen Italiens schon seit ge-
raumer Zeit lagen, ragte dieser kurze Feldzug um Asti wie eine grosse
patriotische Heldenthat hervor; man fühlte für einen Augenblick den
drückenden Alp des spanischen Übergewichts von sich abgewälzt, man
wies auf Karl Emanuel als den künftigen Befreier Italiens, als das leben-
dige Zeugnis hin für das noch immer geltende Wort Petrarca’s:
Che l’antico valore
Nell’ italici cor non e ancor morto!