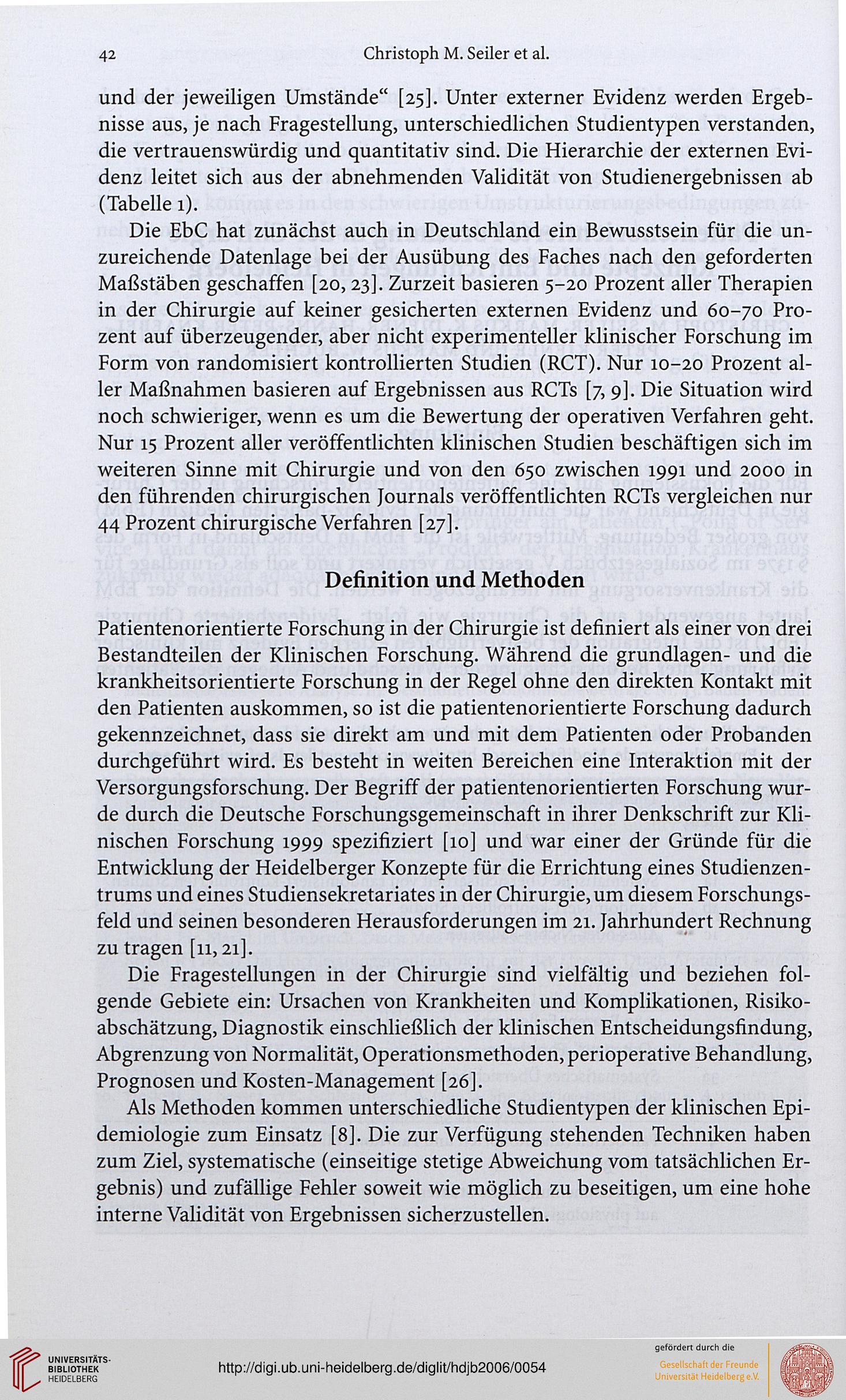42 Christoph M. Seiler et al.
und der jeweiligen Umstände" [25]. Unter externer Evidenz werden Ergeb-
nisse aus, je nach Fragestellung, unterschiedlichen Studientypen verstanden,
die vertrauenswürdig und quantitativ sind. Die Hierarchie der externen Evi-
denz leitet sich aus der abnehmenden Validität von Studienergebnissen ab
(Tabelle 1).
Die EbC hat zunächst auch in Deutschland ein Bewusstsein für die un-
zureichende Datenlage bei der Ausübung des Faches nach den geforderten
Maßstäben geschaffen [20,23]. Zurzeit basieren 5-20 Prozent aller Therapien
in der Chirurgie auf keiner gesicherten externen Evidenz und 60-70 Pro-
zent auf überzeugender, aber nicht experimenteller klinischer Forschung im
Form von randomisiert kontrollierten Studien (RCT). Nur 10-20 Prozent al-
ler Maßnahmen basieren auf Ergebnissen aus RCTs [7, 9]. Die Situation wird
noch schwieriger, wenn es um die Bewertung der operativen Verfahren geht.
Nur 15 Prozent aller veröffentlichten klinischen Studien beschäftigen sich im
weiteren Sinne mit Chirurgie und von den 650 zwischen 1991 und 2000 in
den führenden chirurgischen Journals veröffentlichten RCTs vergleichen nur
44 Prozent chirurgische Verfahren [27].
Definition und Methoden
Patientenorientierte Forschung in der Chirurgie ist definiert als einer von drei
Bestandteilen der Klinischen Forschung. Während die grundlagen- und die
krankheitsorientierte Forschung in der Regel ohne den direkten Kontakt mit
den Patienten auskommen, so ist die patientenorientierte Forschung dadurch
gekennzeichnet, dass sie direkt am und mit dem Patienten oder Probanden
durchgeführt wird. Es besteht in weiten Bereichen eine Interaktion mit der
Versorgungsforschung. Der Begriff der patientenorientierten Forschung wur-
de durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer Denkschrift zur Kli-
nischen Forschung 1999 spezifiziert [10] und war einer der Gründe für die
Entwicklung der Heidelberger Konzepte für die Errichtung eines Studienzen-
trums und eines Studiensekretariates in der Chirurgie, um diesem Forschungs-
feld und seinen besonderen Herausforderungen im 21. Jahrhundert Rechnung
zutragen [11,21].
Die Fragestellungen in der Chirurgie sind vielfältig und beziehen fol-
gende Gebiete ein: Ursachen von Krankheiten und Komplikationen, Risiko-
abschätzung, Diagnostik einschließlich der klinischen Entscheidungsfindung,
Abgrenzung von Normalität, Operationsmethoden, perioperative Behandlung,
Prognosen und Kosten-Management [26].
Als Methoden kommen unterschiedliche Studientypen der klinischen Epi-
demiologie zum Einsatz [8]. Die zur Verfügung stehenden Techniken haben
zum Ziel, systematische (einseitige stetige Abweichung vom tatsächlichen Er-
gebnis) und zufällige Fehler soweit wie möglich zu beseitigen, um eine hohe
interne Validität von Ergebnissen sicherzustellen.
und der jeweiligen Umstände" [25]. Unter externer Evidenz werden Ergeb-
nisse aus, je nach Fragestellung, unterschiedlichen Studientypen verstanden,
die vertrauenswürdig und quantitativ sind. Die Hierarchie der externen Evi-
denz leitet sich aus der abnehmenden Validität von Studienergebnissen ab
(Tabelle 1).
Die EbC hat zunächst auch in Deutschland ein Bewusstsein für die un-
zureichende Datenlage bei der Ausübung des Faches nach den geforderten
Maßstäben geschaffen [20,23]. Zurzeit basieren 5-20 Prozent aller Therapien
in der Chirurgie auf keiner gesicherten externen Evidenz und 60-70 Pro-
zent auf überzeugender, aber nicht experimenteller klinischer Forschung im
Form von randomisiert kontrollierten Studien (RCT). Nur 10-20 Prozent al-
ler Maßnahmen basieren auf Ergebnissen aus RCTs [7, 9]. Die Situation wird
noch schwieriger, wenn es um die Bewertung der operativen Verfahren geht.
Nur 15 Prozent aller veröffentlichten klinischen Studien beschäftigen sich im
weiteren Sinne mit Chirurgie und von den 650 zwischen 1991 und 2000 in
den führenden chirurgischen Journals veröffentlichten RCTs vergleichen nur
44 Prozent chirurgische Verfahren [27].
Definition und Methoden
Patientenorientierte Forschung in der Chirurgie ist definiert als einer von drei
Bestandteilen der Klinischen Forschung. Während die grundlagen- und die
krankheitsorientierte Forschung in der Regel ohne den direkten Kontakt mit
den Patienten auskommen, so ist die patientenorientierte Forschung dadurch
gekennzeichnet, dass sie direkt am und mit dem Patienten oder Probanden
durchgeführt wird. Es besteht in weiten Bereichen eine Interaktion mit der
Versorgungsforschung. Der Begriff der patientenorientierten Forschung wur-
de durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer Denkschrift zur Kli-
nischen Forschung 1999 spezifiziert [10] und war einer der Gründe für die
Entwicklung der Heidelberger Konzepte für die Errichtung eines Studienzen-
trums und eines Studiensekretariates in der Chirurgie, um diesem Forschungs-
feld und seinen besonderen Herausforderungen im 21. Jahrhundert Rechnung
zutragen [11,21].
Die Fragestellungen in der Chirurgie sind vielfältig und beziehen fol-
gende Gebiete ein: Ursachen von Krankheiten und Komplikationen, Risiko-
abschätzung, Diagnostik einschließlich der klinischen Entscheidungsfindung,
Abgrenzung von Normalität, Operationsmethoden, perioperative Behandlung,
Prognosen und Kosten-Management [26].
Als Methoden kommen unterschiedliche Studientypen der klinischen Epi-
demiologie zum Einsatz [8]. Die zur Verfügung stehenden Techniken haben
zum Ziel, systematische (einseitige stetige Abweichung vom tatsächlichen Er-
gebnis) und zufällige Fehler soweit wie möglich zu beseitigen, um eine hohe
interne Validität von Ergebnissen sicherzustellen.