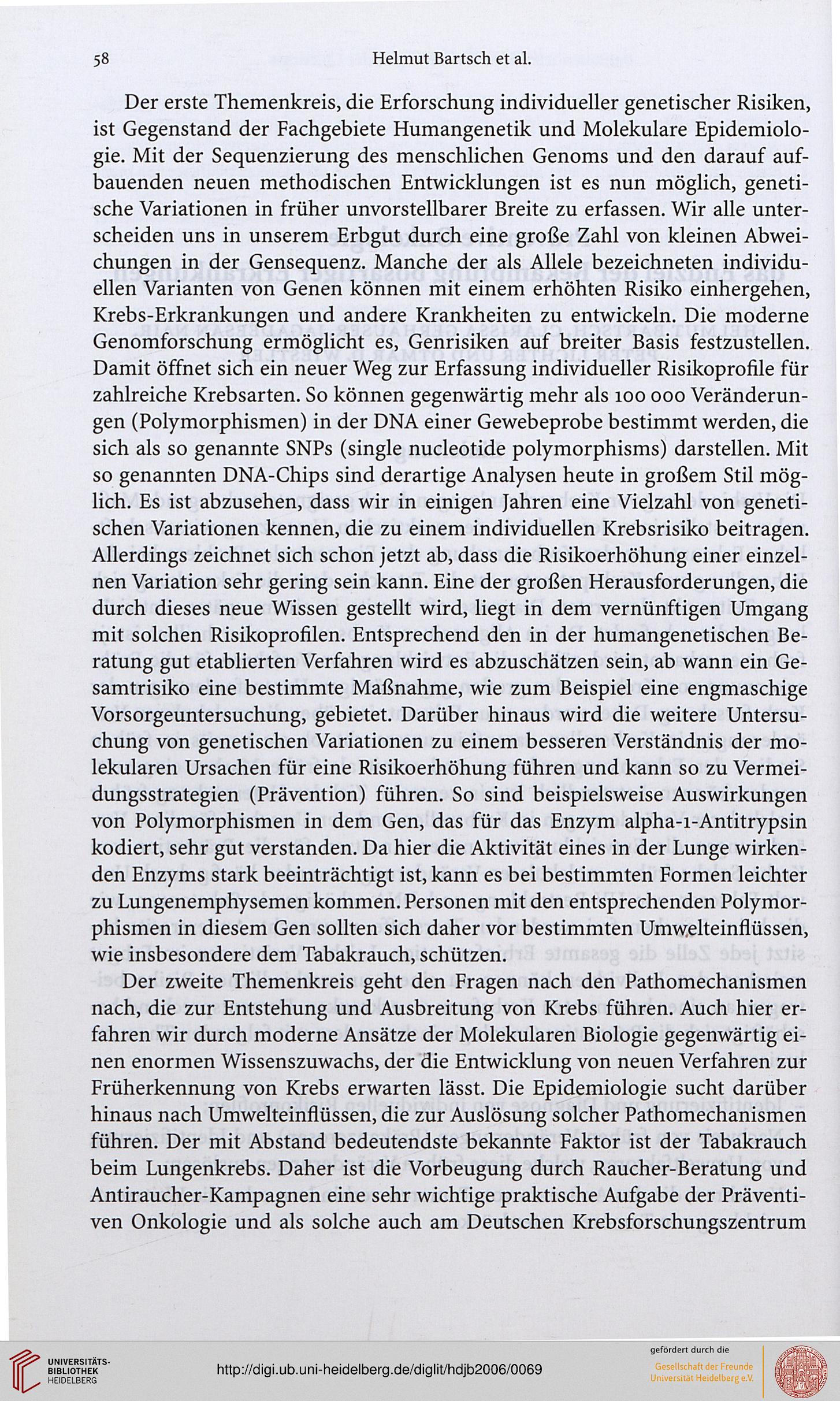58 Helmut Bartsch et al.
Der erste Themenkreis, die Erforschung individueller genetischer Risiken,
ist Gegenstand der Fachgebiete Humangenetik und Molekulare Epidemiolo-
gie. Mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms und den darauf auf-
bauenden neuen methodischen Entwicklungen ist es nun möglich, geneti-
sche Variationen in früher unvorstellbarer Breite zu erfassen. Wir alle unter-
scheiden uns in unserem Erbgut durch eine große Zahl von kleinen Abwei-
chungen in der Gensequenz. Manche der als Allele bezeichneten individu-
ellen Varianten von Genen können mit einem erhöhten Risiko einhergehen,
Krebs-Erkrankungen und andere Krankheiten zu entwickeln. Die moderne
Genomforschung ermöglicht es, Genrisiken auf breiter Basis festzustellen.
Damit öffnet sich ein neuer Weg zur Erfassung individueller Risikoprofile für
zahlreiche Krebsarten. So können gegenwärtig mehr als 100 ooo Veränderun-
gen (Polymorphismen) in der DNA einer Gewebeprobe bestimmt werden, die
sich als so genannte SNPs (single nucleotide polymorphisms) darstellen. Mit
so genannten DNA-Chips sind derartige Analysen heute in großem Stil mög-
lich. Es ist abzusehen, dass wir in einigen Jahren eine Vielzahl von geneti-
schen Variationen kennen, die zu einem individuellen Krebsrisiko beitragen.
Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Risikoerhöhung einer einzel-
nen Variation sehr gering sein kann. Eine der großen Herausforderungen, die
durch dieses neue Wissen gestellt wird, liegt in dem vernünftigen Umgang
mit solchen Risikoprofilen. Entsprechend den in der humangenetischen Be-
ratung gut etablierten Verfahren wird es abzuschätzen sein, ab wann ein Ge-
samtrisiko eine bestimmte Maßnahme, wie zum Beispiel eine engmaschige
Vorsorgeuntersuchung, gebietet. Darüber hinaus wird die weitere Untersu-
chung von genetischen Variationen zu einem besseren Verständnis der mo-
lekularen Ursachen für eine Risikoerhöhung führen und kann so zu Vermei-
dungsstrategien (Prävention) führen. So sind beispielsweise Auswirkungen
von Polymorphismen in dem Gen, das für das Enzym alpha-i-Antitrypsin
kodiert, sehr gut verstanden. Da hier die Aktivität eines in der Lunge wirken-
den Enzyms stark beeinträchtigt ist, kann es bei bestimmten Formen leichter
zu Lungenemphysemen kommen. Personen mit den entsprechenden Polymor-
phismen in diesem Gen sollten sich daher vor bestimmten Umwelteinflüssen,
wie insbesondere dem Tabakrauch, schützen.
Der zweite Themenkreis geht den Fragen nach den Pathomechanismen
nach, die zur Entstehung und Ausbreitung von Krebs führen. Auch hier er-
fahren wir durch moderne Ansätze der Molekularen Biologie gegenwärtig ei-
nen enormen Wissenszuwachs, der die Entwicklung von neuen Verfahren zur
Früherkennung von Krebs erwarten lässt. Die Epidemiologie sucht darüber
hinaus nach Umwelteinflüssen, die zur Auslösung solcher Pathomechanismen
führen. Der mit Abstand bedeutendste bekannte Faktor ist der Tabakrauch
beim Lungenkrebs. Daher ist die Vorbeugung durch Raucher-Beratung und
Antiraucher-Kampagnen eine sehr wichtige praktische Aufgabe der Präventi-
ven Onkologie und als solche auch am Deutschen Krebsforschungszentrum
Der erste Themenkreis, die Erforschung individueller genetischer Risiken,
ist Gegenstand der Fachgebiete Humangenetik und Molekulare Epidemiolo-
gie. Mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms und den darauf auf-
bauenden neuen methodischen Entwicklungen ist es nun möglich, geneti-
sche Variationen in früher unvorstellbarer Breite zu erfassen. Wir alle unter-
scheiden uns in unserem Erbgut durch eine große Zahl von kleinen Abwei-
chungen in der Gensequenz. Manche der als Allele bezeichneten individu-
ellen Varianten von Genen können mit einem erhöhten Risiko einhergehen,
Krebs-Erkrankungen und andere Krankheiten zu entwickeln. Die moderne
Genomforschung ermöglicht es, Genrisiken auf breiter Basis festzustellen.
Damit öffnet sich ein neuer Weg zur Erfassung individueller Risikoprofile für
zahlreiche Krebsarten. So können gegenwärtig mehr als 100 ooo Veränderun-
gen (Polymorphismen) in der DNA einer Gewebeprobe bestimmt werden, die
sich als so genannte SNPs (single nucleotide polymorphisms) darstellen. Mit
so genannten DNA-Chips sind derartige Analysen heute in großem Stil mög-
lich. Es ist abzusehen, dass wir in einigen Jahren eine Vielzahl von geneti-
schen Variationen kennen, die zu einem individuellen Krebsrisiko beitragen.
Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Risikoerhöhung einer einzel-
nen Variation sehr gering sein kann. Eine der großen Herausforderungen, die
durch dieses neue Wissen gestellt wird, liegt in dem vernünftigen Umgang
mit solchen Risikoprofilen. Entsprechend den in der humangenetischen Be-
ratung gut etablierten Verfahren wird es abzuschätzen sein, ab wann ein Ge-
samtrisiko eine bestimmte Maßnahme, wie zum Beispiel eine engmaschige
Vorsorgeuntersuchung, gebietet. Darüber hinaus wird die weitere Untersu-
chung von genetischen Variationen zu einem besseren Verständnis der mo-
lekularen Ursachen für eine Risikoerhöhung führen und kann so zu Vermei-
dungsstrategien (Prävention) führen. So sind beispielsweise Auswirkungen
von Polymorphismen in dem Gen, das für das Enzym alpha-i-Antitrypsin
kodiert, sehr gut verstanden. Da hier die Aktivität eines in der Lunge wirken-
den Enzyms stark beeinträchtigt ist, kann es bei bestimmten Formen leichter
zu Lungenemphysemen kommen. Personen mit den entsprechenden Polymor-
phismen in diesem Gen sollten sich daher vor bestimmten Umwelteinflüssen,
wie insbesondere dem Tabakrauch, schützen.
Der zweite Themenkreis geht den Fragen nach den Pathomechanismen
nach, die zur Entstehung und Ausbreitung von Krebs führen. Auch hier er-
fahren wir durch moderne Ansätze der Molekularen Biologie gegenwärtig ei-
nen enormen Wissenszuwachs, der die Entwicklung von neuen Verfahren zur
Früherkennung von Krebs erwarten lässt. Die Epidemiologie sucht darüber
hinaus nach Umwelteinflüssen, die zur Auslösung solcher Pathomechanismen
führen. Der mit Abstand bedeutendste bekannte Faktor ist der Tabakrauch
beim Lungenkrebs. Daher ist die Vorbeugung durch Raucher-Beratung und
Antiraucher-Kampagnen eine sehr wichtige praktische Aufgabe der Präventi-
ven Onkologie und als solche auch am Deutschen Krebsforschungszentrum