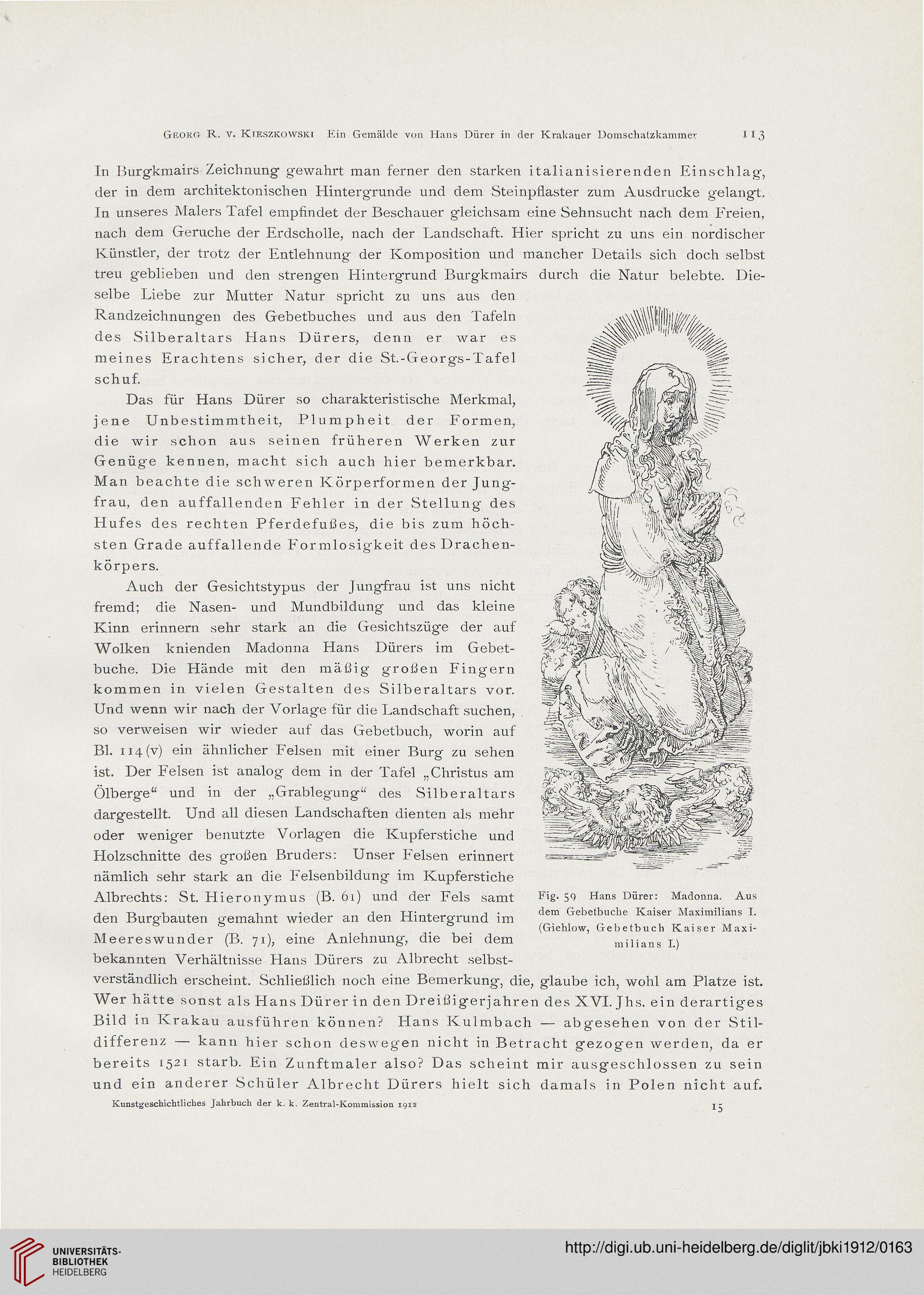Georg R. v. Kteszkowski Ein Gemälde von Hans Dürer in der Krakauer Domschatzkammer
113
In Burgkmairs Zeichnung gewahrt man ferner den starken italianisierenden Einschlag,
der in dem architektonischen Hintergründe und dem Steinpflaster zum Ausdrucke gelangt.
In unseres Malers Tafel empfindet der Beschauer gleichsam eine Sehnsucht nach dem Freien,
nach dem Gerüche der Erdscholle, nach der Landschaft. Hier spricht zu uns ein nordischer
Künstler, der trotz der Entlehnung der Komposition und mancher Details sich doch selbst
treu geblieben und den strengen Hintergrund Burgkmairs durch die Natur belebte. Die-
selbe Liebe zur Mutter Natur spricht zu uns aus den
Randzeichnungen des Gebetbuches und aus den Tafeln
des Silberaltars Hans Dürers, denn er war es
meines Erachtens sicher, der die St.-Georgs-Tafel
schuf.
Das für Hans Dürer so charakteristische Merkmal,
jene Unbestimmtheit, Plumpheit der Formen,
die wir schon aus seinen früheren Werken zur
Genüge kennen, macht sich auch hier bemerkbar.
Man beachte die schweren Körperformen der Jung-
frau, den auffallenden Fehler in der Stellung des
Hufes des rechten Pferdefußes, die bis zum höch-
sten Grade auffallende Formlosigkeit des Drachen-
körpers.
Auch der Gesichtstypus der Jungfrau ist uns nicht
fremd; die Nasen- und Mundbildung und das kleine
Kinn erinnern sehr stark an die Gesichtszüge der auf
Wolken knienden Madonna Hans Dürers im Gebet-
buche. Die Hände mit den mäßig großen Fingern
kommen in vielen Gestalten des Silberaltars vor.
Und wenn wir nach der Vorlage für die Landschaft suchen,
so verweisen wir wieder auf das Gebetbuch, worin auf
Bl. 114 (v) ein ähnlicher Felsen mit einer Burg zu sehen
ist. Der Felsen ist analog dem in der Tafel „Christus am
Ölberge“ und in der „Grablegung“ des Silberaltars
dargestellt. Und all diesen Landschaften dienten als mehr
oder weniger benutzte Vorlagen die Kupferstiche und
Holzschnitte des großen Bruders: Unser Felsen erinnert
nämlich sehr stark an die Felsenbildung im Kupferstiche
Albrechts: St. Hieronymus (B. 61) und der Fels samt
den Burgbauten gemahnt wieder an den Hintergrund im
Meereswunder (B. 71), eine Anlehnung, die bei dem
bekannten Verhältnisse Hans Dürers zu Albrecht selbst-
verständlich erscheint. Schließlich noch eine Bemerkung, die, glaube ich, wohl am Platze ist.
Wer hätte sonst als Hans Dürer in den Dreißiger Jahren des XVI. Jhs. ein derartiges
Bild in Krakau ausführen können? Hans Kulmbach — abgesehen von der Stil-
differenz — kann hier schon deswegen nicht in Betracht gezogen werden, da er
bereits 1521 starb. Ein Zunftmaler also? Das scheint mir ausgeschlossen zu sein
und ein anderer Schüler Albrecht Dürers hielt sich damals in Polen nicht auf.
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Koramission 1912 j-
Fig. 59 Hans Dürer: Madonna. Aus
dem Gebetbuche Kaiser Maximilians I.
(Gielilow, Gebetbuch Kaiser Maxi-
milians I.)
113
In Burgkmairs Zeichnung gewahrt man ferner den starken italianisierenden Einschlag,
der in dem architektonischen Hintergründe und dem Steinpflaster zum Ausdrucke gelangt.
In unseres Malers Tafel empfindet der Beschauer gleichsam eine Sehnsucht nach dem Freien,
nach dem Gerüche der Erdscholle, nach der Landschaft. Hier spricht zu uns ein nordischer
Künstler, der trotz der Entlehnung der Komposition und mancher Details sich doch selbst
treu geblieben und den strengen Hintergrund Burgkmairs durch die Natur belebte. Die-
selbe Liebe zur Mutter Natur spricht zu uns aus den
Randzeichnungen des Gebetbuches und aus den Tafeln
des Silberaltars Hans Dürers, denn er war es
meines Erachtens sicher, der die St.-Georgs-Tafel
schuf.
Das für Hans Dürer so charakteristische Merkmal,
jene Unbestimmtheit, Plumpheit der Formen,
die wir schon aus seinen früheren Werken zur
Genüge kennen, macht sich auch hier bemerkbar.
Man beachte die schweren Körperformen der Jung-
frau, den auffallenden Fehler in der Stellung des
Hufes des rechten Pferdefußes, die bis zum höch-
sten Grade auffallende Formlosigkeit des Drachen-
körpers.
Auch der Gesichtstypus der Jungfrau ist uns nicht
fremd; die Nasen- und Mundbildung und das kleine
Kinn erinnern sehr stark an die Gesichtszüge der auf
Wolken knienden Madonna Hans Dürers im Gebet-
buche. Die Hände mit den mäßig großen Fingern
kommen in vielen Gestalten des Silberaltars vor.
Und wenn wir nach der Vorlage für die Landschaft suchen,
so verweisen wir wieder auf das Gebetbuch, worin auf
Bl. 114 (v) ein ähnlicher Felsen mit einer Burg zu sehen
ist. Der Felsen ist analog dem in der Tafel „Christus am
Ölberge“ und in der „Grablegung“ des Silberaltars
dargestellt. Und all diesen Landschaften dienten als mehr
oder weniger benutzte Vorlagen die Kupferstiche und
Holzschnitte des großen Bruders: Unser Felsen erinnert
nämlich sehr stark an die Felsenbildung im Kupferstiche
Albrechts: St. Hieronymus (B. 61) und der Fels samt
den Burgbauten gemahnt wieder an den Hintergrund im
Meereswunder (B. 71), eine Anlehnung, die bei dem
bekannten Verhältnisse Hans Dürers zu Albrecht selbst-
verständlich erscheint. Schließlich noch eine Bemerkung, die, glaube ich, wohl am Platze ist.
Wer hätte sonst als Hans Dürer in den Dreißiger Jahren des XVI. Jhs. ein derartiges
Bild in Krakau ausführen können? Hans Kulmbach — abgesehen von der Stil-
differenz — kann hier schon deswegen nicht in Betracht gezogen werden, da er
bereits 1521 starb. Ein Zunftmaler also? Das scheint mir ausgeschlossen zu sein
und ein anderer Schüler Albrecht Dürers hielt sich damals in Polen nicht auf.
Kunstgeschichtliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Koramission 1912 j-
Fig. 59 Hans Dürer: Madonna. Aus
dem Gebetbuche Kaiser Maximilians I.
(Gielilow, Gebetbuch Kaiser Maxi-
milians I.)