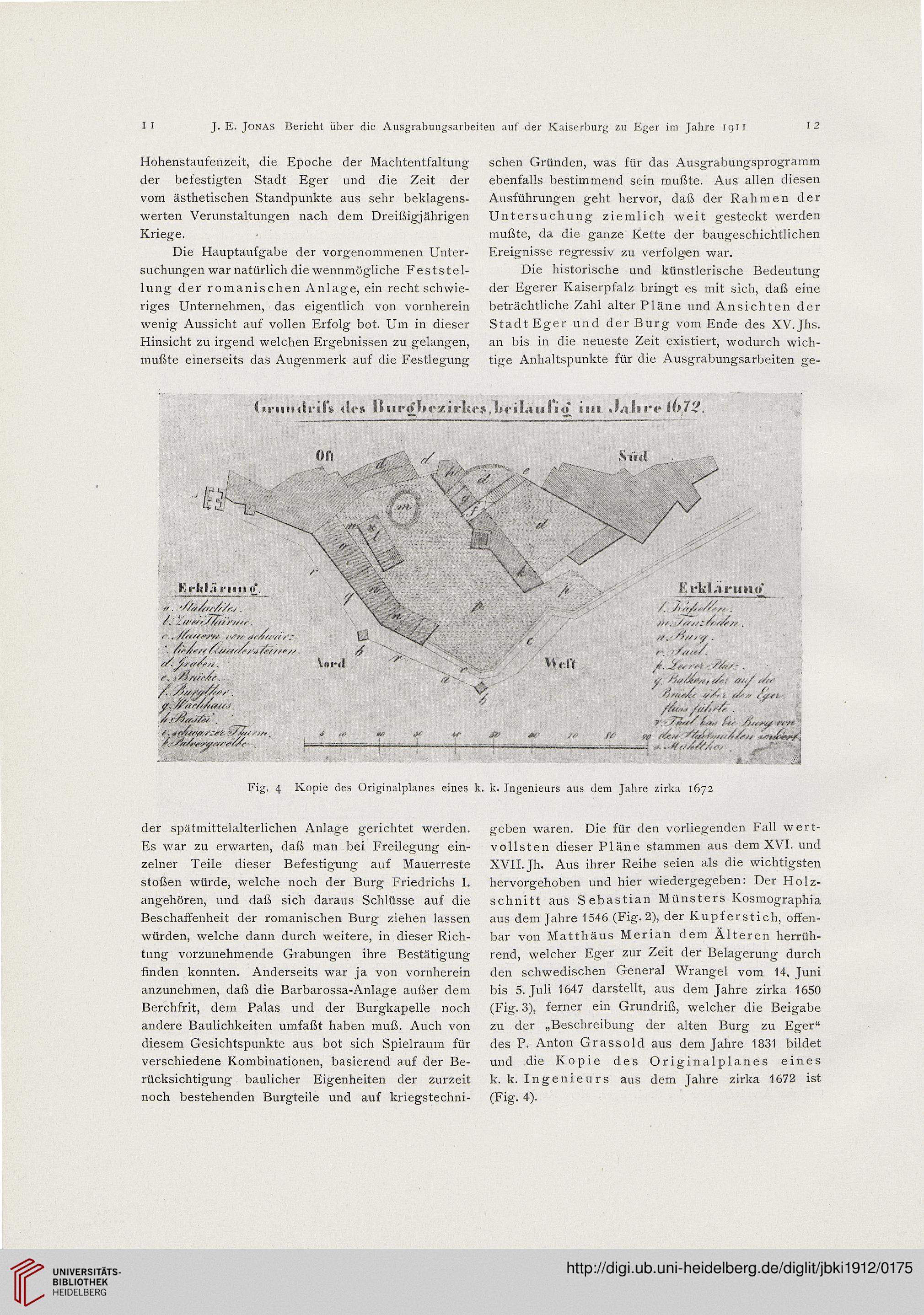J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911
I I
Hohenstaufenzeit, die Epoche der Machtentfaltung
der befestigten Stadt Eger und die Zeit der
vom ästhetischen Standpunkte aus sehr beklagens-
werten Verunstaltungen nach dem Dreißigjährigen
Kriege.
Die Hauptaufgabe der vorgenommenen Unter-
suchungen war natürlich die wennmögliche Feststel-
lung der romanischen Anlage, ein recht schwie-
riges Unternehmen, das eigentlich von vornherein
wenig Aussicht auf vollen Erfolg bot. Um in dieser
Hinsicht zu irgend welchen Ergebnissen zu gelangen,
mußte einerseits das Augenmerk auf die Festlegung
1 2
sehen Gründen, was für das Ausgrabungsprogramm
ebenfalls bestimmend sein mußte. Aus allen diesen
Ausführungen geht hervor, daß der Rahmen der
Untersuchung ziemlich weit gesteckt werden
mußte, da die ganze Kette der baugeschichtlichen
Ereignisse regressiv zu verfolgen war.
Die historische und künstlerische Bedeutung
der Egerer Kaiserpfalz bringt es mit sich, daß eine
beträchtliche Zahl alter Pläne und Ansichten der
Stadt Eger und der Burg vom Ende des XV. Jhs.
an bis in die neueste Zeit existiert, wodurch wich-
tige Anhaltspunkte für die Ausgrabungsarbeiten ge-
(•i iiiKlrilV tlnt lliir(ilM /.ii ltM,lic ilaurio int .l.t lirt* i(>72.
Rrlilj rin» »■
/' >Z///Z//ZZ//
/. ////■ /%//'///// ,
f .. /Z/////'// ts/t tUfüW/ '
Zf/f// Z,//////Z/'J Zf///ff/
7/J//f'Z//,
s. > //'ft/fZf
/ ////yZZ//'.
y. /Z‘/////////
ZZZf/fJ/b/ .
//Z/////r/7 ZA//////.
/ ■////// zy/z/zZZ' .
v«i*il
Kfkl.'i rimo
/. yi //// ■ // ■ //.
///. //// -// /////,
//.'Zi///•// .
/ Z///r/.
Z Zs//// ' Z////S .
y ZZi/ZCft/, Z: a//f /Zf
Z////Z/ '/// , //-/y/i
///< ><* ft/A/Zs .
7 ' 7Z//Z/./,• //.- /}/ffUt /‘/'ff '
«p? /// / Z///{ f/////ZZ// <///>//// .
—I .. . A/z/ZZ/Zr/
.1
Fig. 4 Kopie des Originalplanes eines k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672
der spätmittelalterlichen Anlage gerichtet werden.
Es war zu erwarten, daß man bei Freilegung ein-
zelner Teile dieser Befestigung auf Mauerreste
stoßen würde, welche noch der Burg Friedrichs I.
angehören, und daß sich daraus Schlüsse auf die
Beschaffenheit der romanischen Burg ziehen lassen
würden, welche dann durch weitere, in dieser Rich-
tung vorzunehmende Grabungen ihre Bestätigung
finden konnten. Anderseits war ja von vornherein
anzunehmen, daß die Barbarossa-Anlage außer dem
Berchfrit, dem Palas und der Burgkapelle noch
andere Baulichkeiten umfaßt haben muß. Auch von
diesem Gesichtspunkte aus bot sich Spielraum für
verschiedene Kombinationen, basierend auf der Be-
rücksichtigung baulicher Eigenheiten der zurzeit
noch bestehenden Burgteile und auf kriegstechni-
geben waren. Die für den vorliegenden Fall wert-
vollsten dieser Pläne stammen aus dem XVI. und
XVII. Jh. Aus ihrer Reihe seien als die wichtigsten
hervorgehoben und hier wiedergegeben: Der Holz-
schnitt aus Sebastian Münsters Kosmographia
aus dem Jahre 1546 (Fig. 2), der Kupferstich, offen-
bar von Matthäus Merian dem Älteren herrüh-
rend, welcher Eger zur Zeit der Belagerung durch
den schwedischen General Wrangel vom 14, Juni
bis 5. Juli 1647 darstellt, aus dem Jahre zirka 1650
(Fig. 3), ferner ein Grundriß, welcher die Beigabe
zu der „Beschreibung der alten Burg zu Eger“
des P. Anton Grassold aus dem Jahre 1831 bildet
und die Kopie des Originalplanes eines
k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672 ist
(Fig. 4).
I I
Hohenstaufenzeit, die Epoche der Machtentfaltung
der befestigten Stadt Eger und die Zeit der
vom ästhetischen Standpunkte aus sehr beklagens-
werten Verunstaltungen nach dem Dreißigjährigen
Kriege.
Die Hauptaufgabe der vorgenommenen Unter-
suchungen war natürlich die wennmögliche Feststel-
lung der romanischen Anlage, ein recht schwie-
riges Unternehmen, das eigentlich von vornherein
wenig Aussicht auf vollen Erfolg bot. Um in dieser
Hinsicht zu irgend welchen Ergebnissen zu gelangen,
mußte einerseits das Augenmerk auf die Festlegung
1 2
sehen Gründen, was für das Ausgrabungsprogramm
ebenfalls bestimmend sein mußte. Aus allen diesen
Ausführungen geht hervor, daß der Rahmen der
Untersuchung ziemlich weit gesteckt werden
mußte, da die ganze Kette der baugeschichtlichen
Ereignisse regressiv zu verfolgen war.
Die historische und künstlerische Bedeutung
der Egerer Kaiserpfalz bringt es mit sich, daß eine
beträchtliche Zahl alter Pläne und Ansichten der
Stadt Eger und der Burg vom Ende des XV. Jhs.
an bis in die neueste Zeit existiert, wodurch wich-
tige Anhaltspunkte für die Ausgrabungsarbeiten ge-
(•i iiiKlrilV tlnt lliir(ilM /.ii ltM,lic ilaurio int .l.t lirt* i(>72.
Rrlilj rin» »■
/' >Z///Z//ZZ//
/. ////■ /%//'///// ,
f .. /Z/////'// ts/t tUfüW/ '
Zf/f// Z,//////Z/'J Zf///ff/
7/J//f'Z//,
s. > //'ft/fZf
/ ////yZZ//'.
y. /Z‘/////////
ZZZf/fJ/b/ .
//Z/////r/7 ZA//////.
/ ■////// zy/z/zZZ' .
v«i*il
Kfkl.'i rimo
/. yi //// ■ // ■ //.
///. //// -// /////,
//.'Zi///•// .
/ Z///r/.
Z Zs//// ' Z////S .
y ZZi/ZCft/, Z: a//f /Zf
Z////Z/ '/// , //-/y/i
///< ><* ft/A/Zs .
7 ' 7Z//Z/./,• //.- /}/ffUt /‘/'ff '
«p? /// / Z///{ f/////ZZ// <///>//// .
—I .. . A/z/ZZ/Zr/
.1
Fig. 4 Kopie des Originalplanes eines k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672
der spätmittelalterlichen Anlage gerichtet werden.
Es war zu erwarten, daß man bei Freilegung ein-
zelner Teile dieser Befestigung auf Mauerreste
stoßen würde, welche noch der Burg Friedrichs I.
angehören, und daß sich daraus Schlüsse auf die
Beschaffenheit der romanischen Burg ziehen lassen
würden, welche dann durch weitere, in dieser Rich-
tung vorzunehmende Grabungen ihre Bestätigung
finden konnten. Anderseits war ja von vornherein
anzunehmen, daß die Barbarossa-Anlage außer dem
Berchfrit, dem Palas und der Burgkapelle noch
andere Baulichkeiten umfaßt haben muß. Auch von
diesem Gesichtspunkte aus bot sich Spielraum für
verschiedene Kombinationen, basierend auf der Be-
rücksichtigung baulicher Eigenheiten der zurzeit
noch bestehenden Burgteile und auf kriegstechni-
geben waren. Die für den vorliegenden Fall wert-
vollsten dieser Pläne stammen aus dem XVI. und
XVII. Jh. Aus ihrer Reihe seien als die wichtigsten
hervorgehoben und hier wiedergegeben: Der Holz-
schnitt aus Sebastian Münsters Kosmographia
aus dem Jahre 1546 (Fig. 2), der Kupferstich, offen-
bar von Matthäus Merian dem Älteren herrüh-
rend, welcher Eger zur Zeit der Belagerung durch
den schwedischen General Wrangel vom 14, Juni
bis 5. Juli 1647 darstellt, aus dem Jahre zirka 1650
(Fig. 3), ferner ein Grundriß, welcher die Beigabe
zu der „Beschreibung der alten Burg zu Eger“
des P. Anton Grassold aus dem Jahre 1831 bildet
und die Kopie des Originalplanes eines
k. k. Ingenieurs aus dem Jahre zirka 1672 ist
(Fig. 4).