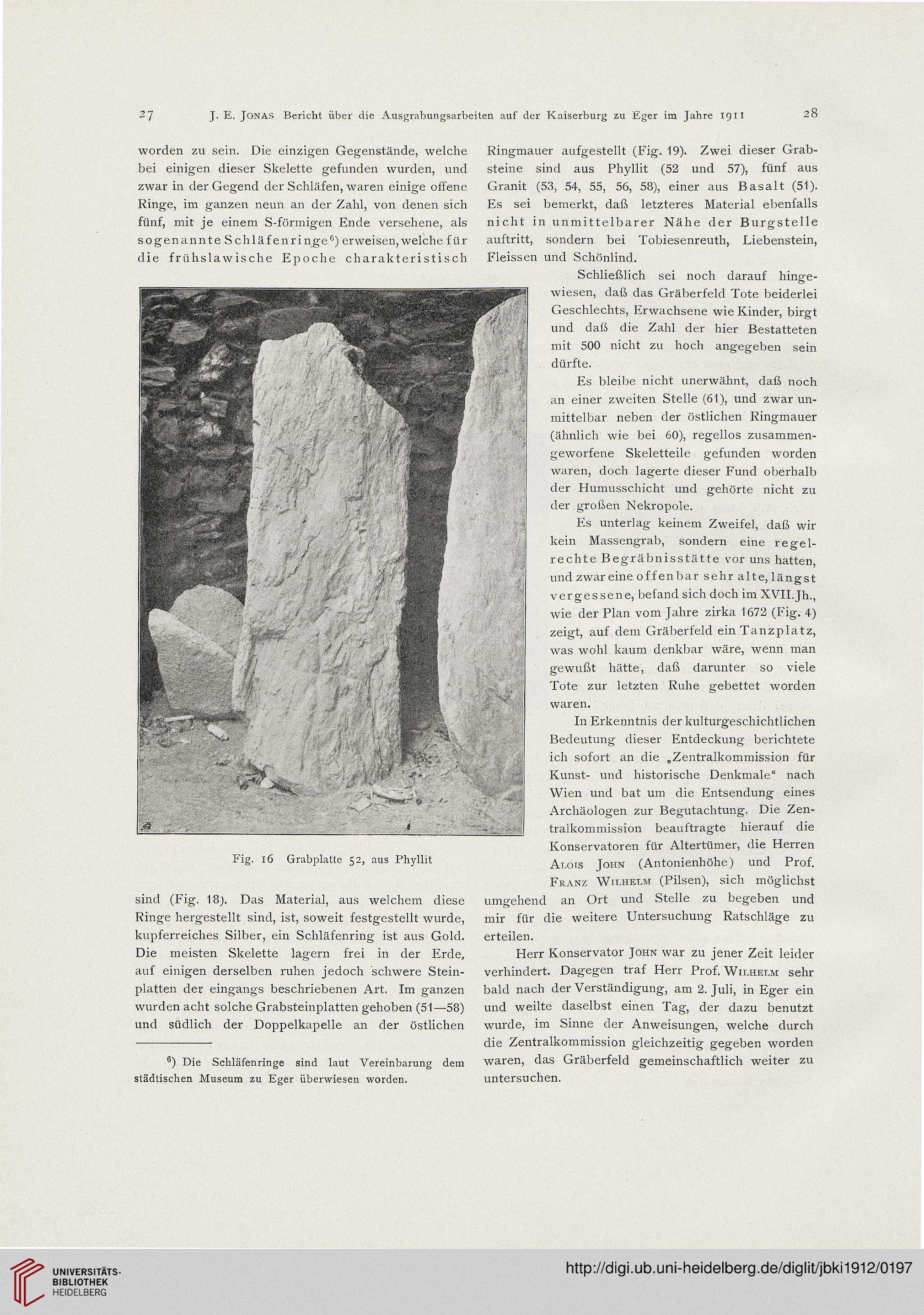27
J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911
28
worden zu sein. Die einzigen Gegenstände, welche
bei einigen dieser Skelette gefunden wurden, und
zwar in der Gegend der Schläfen, waren einige offene
Ringe, im ganzen neun an der Zahl, von denen sich
fünf, mit je einem S-förmigen Ende versehene, als
sogenannte Schläfenringe6) erweisen, welche für
die frühslawische Epoche charakteristisch
sind (Fig. 18). Das Material, aus welchem diese
Ringe hergestellt sind, ist, soweit festgestellt wurde,
kupferreiches Silber, ein Schläfenring ist aus Gold.
Die meisten Skelette lagern frei in der Erde,
auf einigen derselben ruhen jedoch 'schwere Stein-
platten der eingangs beschriebenen Art. Im ganzen
wurden acht solche Grabsteinplatten gehoben (51—58)
und südlich der Doppelkapelle an der östlichen
6) Die Schläfenringe sind laut Vereinbarung dem
städtischen Museum zu Eger überwiesen worden.
Ringmauer aufgestellt (Fig. 19). Zwei dieser Grab-
steine sind aus Phyllit (52 und 57), fünf aus
Granit (53, 54, 55, 56, 58), einer aus Basalt (51).
Es sei bemerkt, daß letzteres Material ebenfalls
nicht in unmittelbarer Nähe der Burgstelle
auftritt, sondern bei Tobiesenreuth, Liebenstein,
Fleissen und Schönlind.
Schließlich sei noch darauf hinge-
wiesen, daß das Gräberfeld Tote beiderlei
Geschlechts, Erwachsene wie Kinder, birgt
und daß die Zahl der hier Bestatteten
mit 500 nicht zu hoch angegeben sein
dürfte.
Es bleibe nicht unerwähnt, daß noch
an einer zweiten Stelle (61), und zwar un-
mittelbar neben der östlichen Ringmauer
(ähnlich wie bei 60), regellos zusammen-
geworfene Skeletteile gefunden worden
waren, doch lagerte dieser Fund oberhalb
der Humusschicht und gehörte nicht zu
der großen Nekropole.
Es unterlag keinem Zweifel, daß wir
kein Massengrab, sondern eine regel-
rechte Begräbnisstätte vor uns hatten,
und zwar eine offenbar sehr alte, längst
vergessene, befand sich doch im XVII.Jh.,
wie der Plan vom Jahre zirka 1672 (Fig. 4)
zeigt, auf dem Gräberfeld ein Tanz platz,
was wohl kaum denkbar wäre, wenn man
gewußt hätte, daß darunter so viele
Tote zur letzten Ruhe gebettet worden
waren.
In Erkenntnis der kulturgeschichtlichen
Bedeutung dieser Entdeckung berichtete
ich sofort an die „Zentralkommission für
Kunst- und historische Denkmale“ nach
Wien und bat um die Entsendung eines
Archäologen zur Begutachtung. Die Zen-
tralkommission beauftragte hierauf die
Konservatoren für Altertümer, die Herren
Alois John (Antonienhöhe) und Prof.
Franz Wilhelm (Pilsen), sich möglichst
umgehend an Ort und Stelle zu begeben und
mir für die weitere Untersuchung Ratschläge zu
erteilen.
Herr Konservator John war zu jener Zeit leider
verhindert. Dagegen traf Herr Prof. Wilhelm sehr
bald nach der Verständigung, am 2. Juli, in Eger ein
und weilte daselbst einen Tag, der dazu benutzt
wurde, im Sinne der Anweisungen, welche durch
die Zentralkommission gleichzeitig gegeben worden
waren, das Gräberfeld gemeinschaftlich weiter zu
untersuchen.
Fig. 16 Grabplatte 52, aus Phyllit
J. E. Jonas Bericht über die Ausgrabungsarbeiten auf der Kaiserburg zu Eger im Jahre 1911
28
worden zu sein. Die einzigen Gegenstände, welche
bei einigen dieser Skelette gefunden wurden, und
zwar in der Gegend der Schläfen, waren einige offene
Ringe, im ganzen neun an der Zahl, von denen sich
fünf, mit je einem S-förmigen Ende versehene, als
sogenannte Schläfenringe6) erweisen, welche für
die frühslawische Epoche charakteristisch
sind (Fig. 18). Das Material, aus welchem diese
Ringe hergestellt sind, ist, soweit festgestellt wurde,
kupferreiches Silber, ein Schläfenring ist aus Gold.
Die meisten Skelette lagern frei in der Erde,
auf einigen derselben ruhen jedoch 'schwere Stein-
platten der eingangs beschriebenen Art. Im ganzen
wurden acht solche Grabsteinplatten gehoben (51—58)
und südlich der Doppelkapelle an der östlichen
6) Die Schläfenringe sind laut Vereinbarung dem
städtischen Museum zu Eger überwiesen worden.
Ringmauer aufgestellt (Fig. 19). Zwei dieser Grab-
steine sind aus Phyllit (52 und 57), fünf aus
Granit (53, 54, 55, 56, 58), einer aus Basalt (51).
Es sei bemerkt, daß letzteres Material ebenfalls
nicht in unmittelbarer Nähe der Burgstelle
auftritt, sondern bei Tobiesenreuth, Liebenstein,
Fleissen und Schönlind.
Schließlich sei noch darauf hinge-
wiesen, daß das Gräberfeld Tote beiderlei
Geschlechts, Erwachsene wie Kinder, birgt
und daß die Zahl der hier Bestatteten
mit 500 nicht zu hoch angegeben sein
dürfte.
Es bleibe nicht unerwähnt, daß noch
an einer zweiten Stelle (61), und zwar un-
mittelbar neben der östlichen Ringmauer
(ähnlich wie bei 60), regellos zusammen-
geworfene Skeletteile gefunden worden
waren, doch lagerte dieser Fund oberhalb
der Humusschicht und gehörte nicht zu
der großen Nekropole.
Es unterlag keinem Zweifel, daß wir
kein Massengrab, sondern eine regel-
rechte Begräbnisstätte vor uns hatten,
und zwar eine offenbar sehr alte, längst
vergessene, befand sich doch im XVII.Jh.,
wie der Plan vom Jahre zirka 1672 (Fig. 4)
zeigt, auf dem Gräberfeld ein Tanz platz,
was wohl kaum denkbar wäre, wenn man
gewußt hätte, daß darunter so viele
Tote zur letzten Ruhe gebettet worden
waren.
In Erkenntnis der kulturgeschichtlichen
Bedeutung dieser Entdeckung berichtete
ich sofort an die „Zentralkommission für
Kunst- und historische Denkmale“ nach
Wien und bat um die Entsendung eines
Archäologen zur Begutachtung. Die Zen-
tralkommission beauftragte hierauf die
Konservatoren für Altertümer, die Herren
Alois John (Antonienhöhe) und Prof.
Franz Wilhelm (Pilsen), sich möglichst
umgehend an Ort und Stelle zu begeben und
mir für die weitere Untersuchung Ratschläge zu
erteilen.
Herr Konservator John war zu jener Zeit leider
verhindert. Dagegen traf Herr Prof. Wilhelm sehr
bald nach der Verständigung, am 2. Juli, in Eger ein
und weilte daselbst einen Tag, der dazu benutzt
wurde, im Sinne der Anweisungen, welche durch
die Zentralkommission gleichzeitig gegeben worden
waren, das Gräberfeld gemeinschaftlich weiter zu
untersuchen.
Fig. 16 Grabplatte 52, aus Phyllit