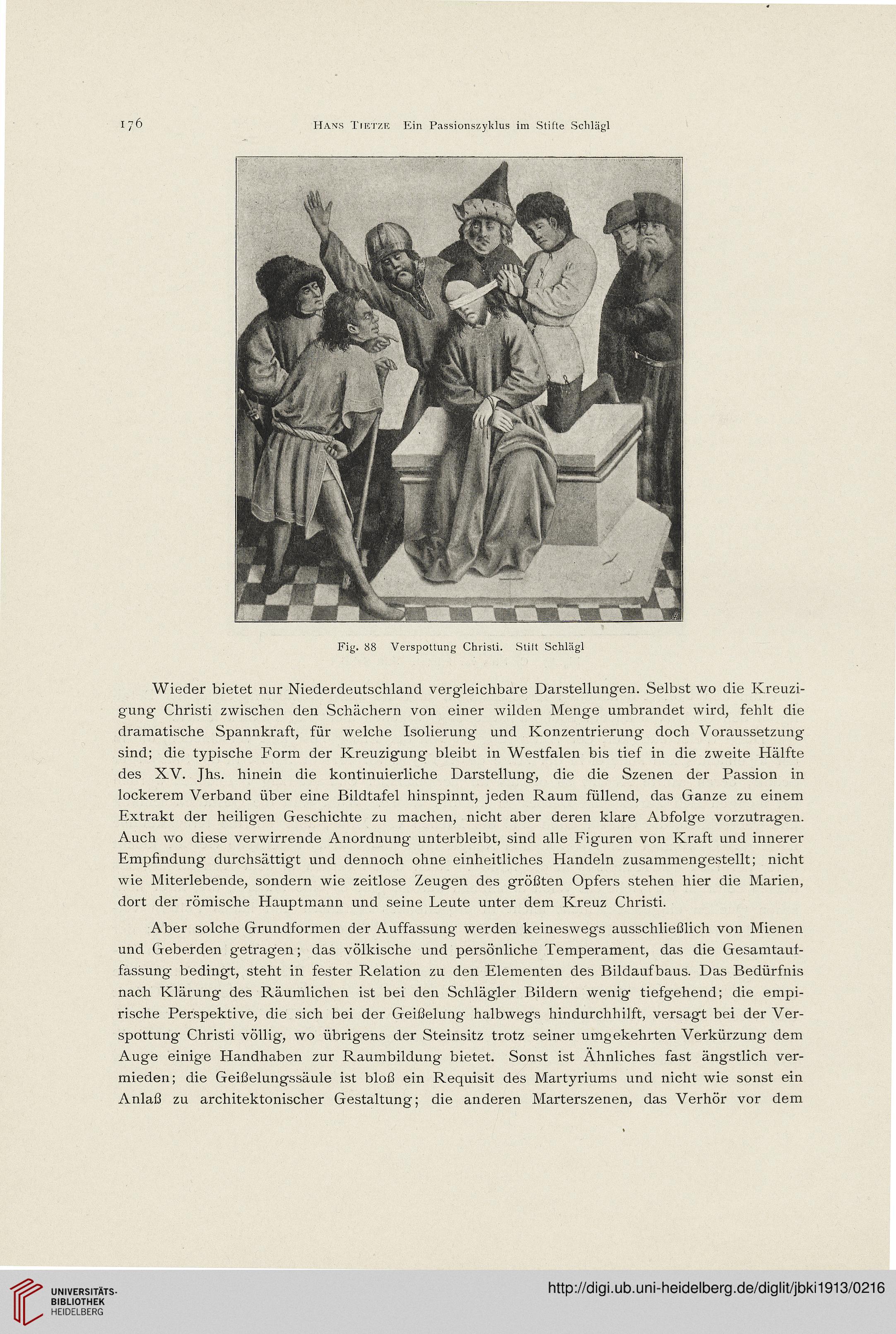176
Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Schlägl
Fig. 88 Verspottung Christi. Stilt Schlägl
Wieder bietet nur Niederdeutschland vergleichbare Darstellungen. Selbst wo die Kreuzi-
gung Christi zwischen den Schächern von einer wilden Menge umbrandet wird, fehlt die
dramatische Spannkraft, für welche Isolierung und Konzentrierung doch Voraussetzung
sind; die typische Form der Kreuzigung bleibt in Westfalen bis tief in die zweite Hälfte
des XV. Jhs. hinein die kontinuierliche Darstellung, die die Szenen der Passion in
lockerem Verband über eine Bildtafel hinspinnt, jeden Raum füllend, das Ganze zu einem
Extrakt der heiligen Geschichte zu machen, nicht aber deren klare Abfolge vorzutragen.
Auch wo diese verwirrende Anordnung unterbleibt, sind alle Figuren von Kraft und innerer
Empfindung durchsättigt und dennoch ohne einheitliches Handeln zusammengestellt; nicht
wie Miterlebende, sondern wie zeitlose Zeugen des größten Opfers stehen hier die Marien,
dort der römische Hauptmann und seine Leute unter dem Kreuz Christi.
Aber solche Grundformen der Auffassung werden keineswegs ausschließlich von Mienen
und Geberden getragen; das völkische und persönliche Temperament, das die Gesamtauf-
fassung bedingt, steht in fester Relation zu den Elementen des Bildaufbaus. Das Bedürfnis
nach Klärung des Räumlichen ist bei den Schlägler Bildern wenig tiefgehend; die empi-
rische Perspektive, die sich bei der Geißelung halbwegs hindurchhilft, versagt bei der Ver-
spottung Christi völlig, wo übrigens der Steinsitz trotz seiner umgekehrten Verkürzung dem
Auge einige Handhaben zur Raumbildung bietet. Sonst ist Ähnliches fast ängstlich ver-
mieden; die Geißelungssäule ist bloß ein Requisit des Martyriums und nicht wie sonst ein
Anlaß zu architektonischer Gestaltung; die anderen Marterszenen, das Verhör vor dem
Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Schlägl
Fig. 88 Verspottung Christi. Stilt Schlägl
Wieder bietet nur Niederdeutschland vergleichbare Darstellungen. Selbst wo die Kreuzi-
gung Christi zwischen den Schächern von einer wilden Menge umbrandet wird, fehlt die
dramatische Spannkraft, für welche Isolierung und Konzentrierung doch Voraussetzung
sind; die typische Form der Kreuzigung bleibt in Westfalen bis tief in die zweite Hälfte
des XV. Jhs. hinein die kontinuierliche Darstellung, die die Szenen der Passion in
lockerem Verband über eine Bildtafel hinspinnt, jeden Raum füllend, das Ganze zu einem
Extrakt der heiligen Geschichte zu machen, nicht aber deren klare Abfolge vorzutragen.
Auch wo diese verwirrende Anordnung unterbleibt, sind alle Figuren von Kraft und innerer
Empfindung durchsättigt und dennoch ohne einheitliches Handeln zusammengestellt; nicht
wie Miterlebende, sondern wie zeitlose Zeugen des größten Opfers stehen hier die Marien,
dort der römische Hauptmann und seine Leute unter dem Kreuz Christi.
Aber solche Grundformen der Auffassung werden keineswegs ausschließlich von Mienen
und Geberden getragen; das völkische und persönliche Temperament, das die Gesamtauf-
fassung bedingt, steht in fester Relation zu den Elementen des Bildaufbaus. Das Bedürfnis
nach Klärung des Räumlichen ist bei den Schlägler Bildern wenig tiefgehend; die empi-
rische Perspektive, die sich bei der Geißelung halbwegs hindurchhilft, versagt bei der Ver-
spottung Christi völlig, wo übrigens der Steinsitz trotz seiner umgekehrten Verkürzung dem
Auge einige Handhaben zur Raumbildung bietet. Sonst ist Ähnliches fast ängstlich ver-
mieden; die Geißelungssäule ist bloß ein Requisit des Martyriums und nicht wie sonst ein
Anlaß zu architektonischer Gestaltung; die anderen Marterszenen, das Verhör vor dem