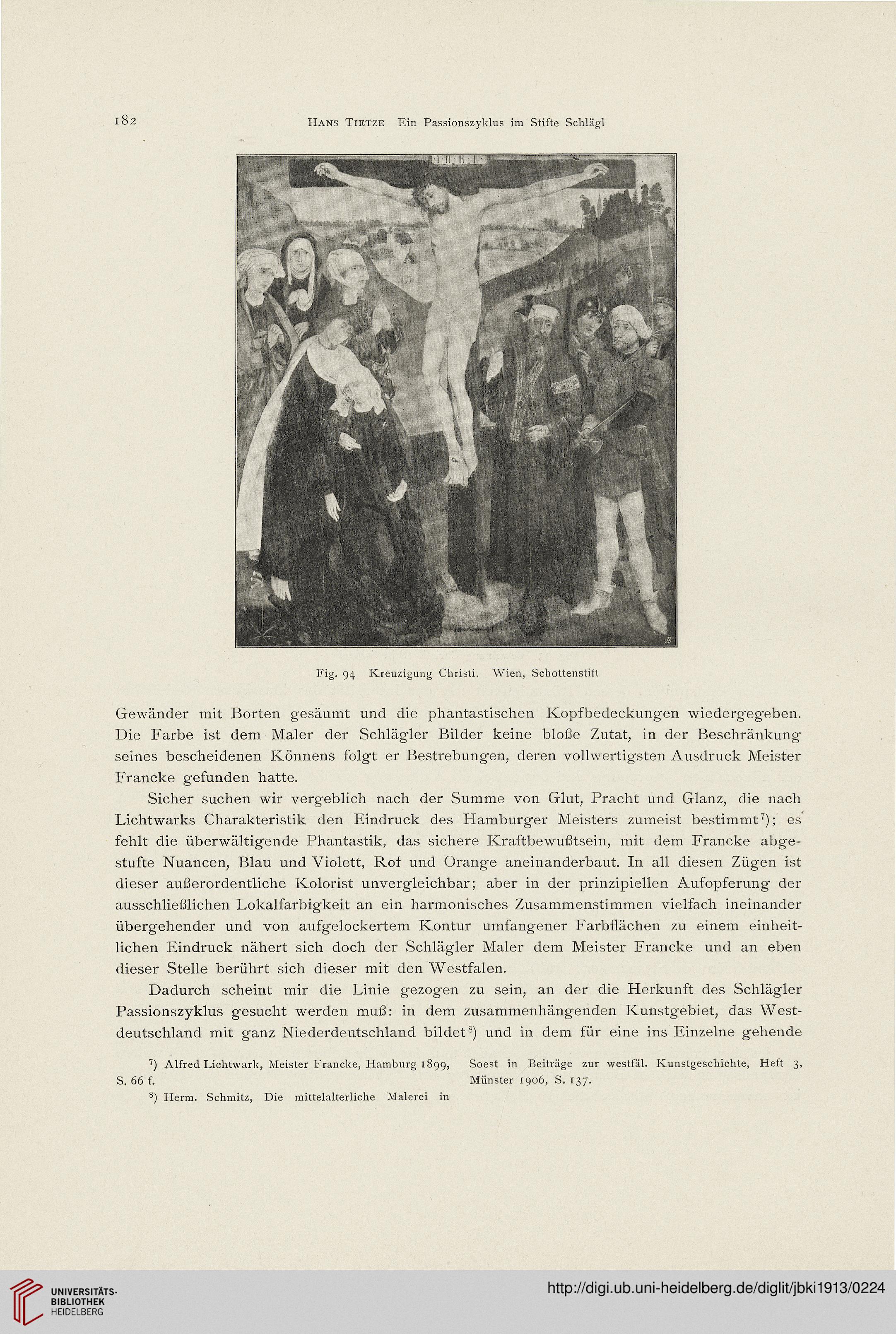182
Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Scliliigl
Fig. 94 Kreuzigung Christi. Wien, Schottenstitt
Gewänder mit Borten gesäumt und die phantastischen Kopfbedeckungen wiedergegeben.
Die Farbe ist dem Maler der Schlägler Bilder keine bloße Zutat, in der Beschränkung
seines bescheidenen Könnens folgt er Bestrebungen, deren vollwertigsten Ausdruck Meister
Francke gefunden hatte.
Sicher suchen wir vergeblich nach der Summe von Glut, Pracht und Glanz, die nach
Lichtwarks Charakteristik den Eindruck des Hamburger Meisters zumeist bestimmt7); es
fehlt die überwältigende Phantastik, das sichere Kraftbewußtsein, mit dem Francke abge-
stufte Nuancen, Blau und Violett, Rof und Orange aneinanderbaut. In all diesen Zügen ist
dieser außerordentliche Kolorist unvergleichbar; aber in der prinzipiellen Aufopferung der
ausschließlichen Lokalfarbigkeit an ein harmonisches Zusammenstimmen vielfach ineinander
übergehender und von aufgelockertem Kontur umfangener Farbflächen zu einem einheit-
lichen Eindruck nähert sich doch der Schlägler Maler dem Meister Francke und an eben
dieser Stelle berührt sich dieser mit den Westfalen.
Dadurch scheint mir die Linie gezogen zu sein, an der die Herkunft des Schlägler
Passionszyklus gesucht werden muß: in dem zusammenhängenden Kunstgebiet, das West-
deutschland mit ganz Niederdeutschland bildet8) und in dem für eine ins Einzelne gehende
7) Alfred Lichtwark, Meister Francke, Hamburg 1899, Soest in Beiträge zur westfäl. Kunstgeschichte, Heft 3,
S. 66 f. Münster 1906, S. 137.
8) Herrn. Schmitz, Die mittelalterliche Malerei in
Hans Tietze Ein Passionszyklus im Stifte Scliliigl
Fig. 94 Kreuzigung Christi. Wien, Schottenstitt
Gewänder mit Borten gesäumt und die phantastischen Kopfbedeckungen wiedergegeben.
Die Farbe ist dem Maler der Schlägler Bilder keine bloße Zutat, in der Beschränkung
seines bescheidenen Könnens folgt er Bestrebungen, deren vollwertigsten Ausdruck Meister
Francke gefunden hatte.
Sicher suchen wir vergeblich nach der Summe von Glut, Pracht und Glanz, die nach
Lichtwarks Charakteristik den Eindruck des Hamburger Meisters zumeist bestimmt7); es
fehlt die überwältigende Phantastik, das sichere Kraftbewußtsein, mit dem Francke abge-
stufte Nuancen, Blau und Violett, Rof und Orange aneinanderbaut. In all diesen Zügen ist
dieser außerordentliche Kolorist unvergleichbar; aber in der prinzipiellen Aufopferung der
ausschließlichen Lokalfarbigkeit an ein harmonisches Zusammenstimmen vielfach ineinander
übergehender und von aufgelockertem Kontur umfangener Farbflächen zu einem einheit-
lichen Eindruck nähert sich doch der Schlägler Maler dem Meister Francke und an eben
dieser Stelle berührt sich dieser mit den Westfalen.
Dadurch scheint mir die Linie gezogen zu sein, an der die Herkunft des Schlägler
Passionszyklus gesucht werden muß: in dem zusammenhängenden Kunstgebiet, das West-
deutschland mit ganz Niederdeutschland bildet8) und in dem für eine ins Einzelne gehende
7) Alfred Lichtwark, Meister Francke, Hamburg 1899, Soest in Beiträge zur westfäl. Kunstgeschichte, Heft 3,
S. 66 f. Münster 1906, S. 137.
8) Herrn. Schmitz, Die mittelalterliche Malerei in