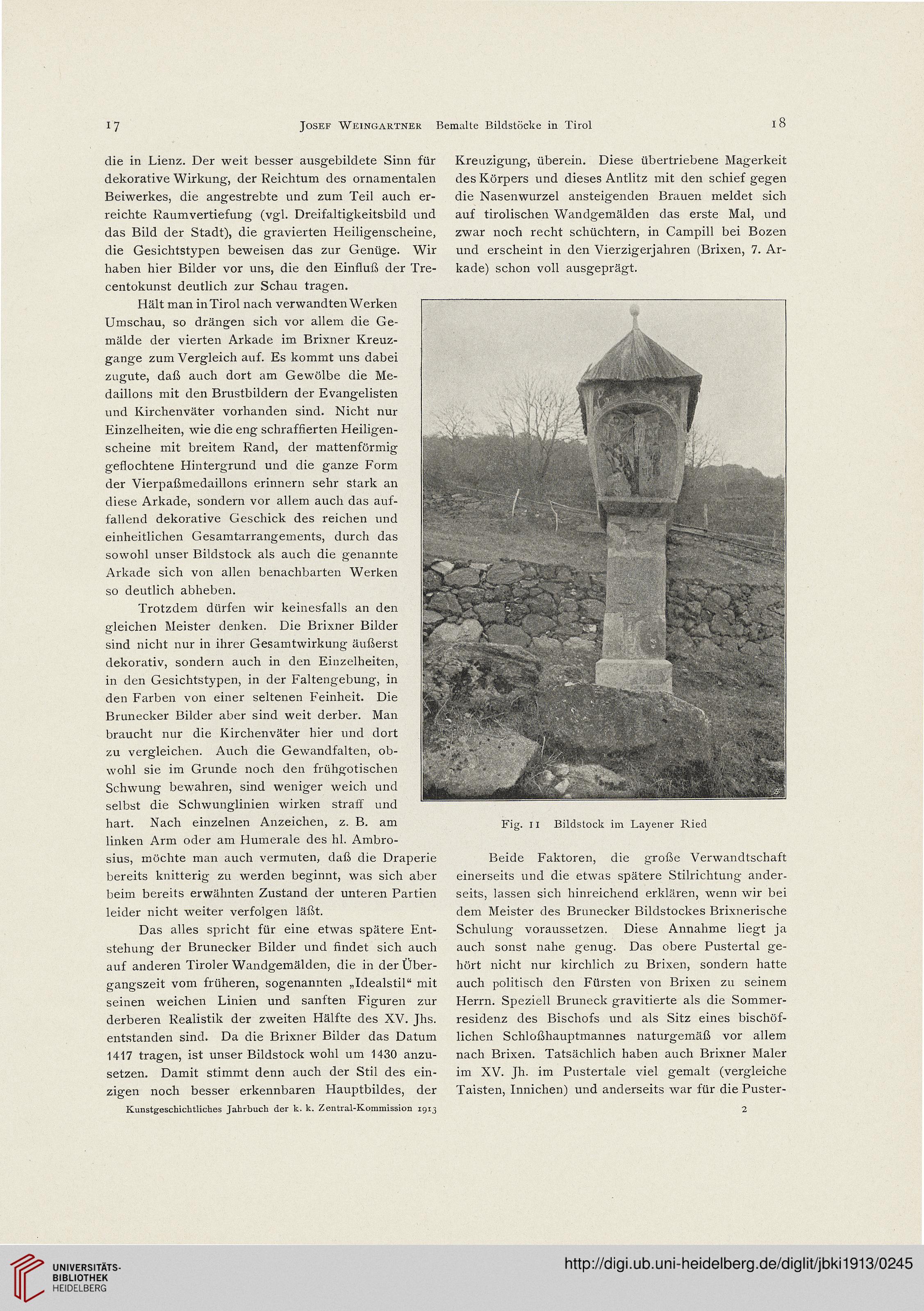17
Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol
I 8
die in Lienz. Der weit besser ausgebildete Sinn für
dekorative Wirkung, der Reichtum des ornamentalen
Beiwerkes, die angestrebte und zum Teil auch er-
reichte Raumvertiefung (vgl. Dreifaltigkeitsbild und
das Bild der Stadt), die gravierten Heiligenscheine,
die Gesichtstypen beweisen das zur Genüge. Wir
haben hier Bilder vor uns, die den Einfluß der Tre-
centokunst deutlich zur Schau tragen.
Hält man in Tirol nach verwandten Werken
Umschau, so drängen sich vor allem die Ge-
mälde der vierten Arkade im Brixner Kreuz-
gange zum Vergleich auf. Es kommt uns dabei
zugute, daß auch dort am Gewölbe die Me-
daillons mit den Brustbildern der Evangelisten
und Kirchenväter vorhanden sind. Nicht nur
Einzelheiten, wie die eng schraffierten Heiligen-
scheine mit breitem Rand, der mattenförmig
geflochtene Hintergrund und die ganze Form
der Vierpaßmedaillons erinnern sehr stark an
diese Arkade, sondern vor allem auch das auf-
fallend dekorative Geschick des reichen und
einheitlichen Gesamtarrangements, durch das
sowohl unser Bildstock als auch die genannte
Arkade sich von allen benachbarten Werken
so deutlich abheben.
Trotzdem dürfen wir keinesfalls an den
gleichen Meister denken. Die Brixner Bilder
sind nicht nur in ihrer Gesamtwirkung äußerst
dekorativ, sondern auch in den Einzelheiten,
in den Gesichtstypen, in der Faltengebung, in
den Farben von einer seltenen Feinheit. Die
Brunecker Bilder aber sind weit derber. Man
braucht nur die Kirchenväter hier und dort
zu vergleichen. Auch die Gewandfalten, ob-
wohl sie im Grunde noch den frühgotischen
Schwung bewahren, sind weniger weich und
selbst die Schwunglinien wirken straff und
hart. Nach einzelnen Anzeichen, z. B. am
linken Arm oder am Humerale des hl. Ambro-
sius, möchte man auch vermuten, daß die Draperie
bereits knitterig zu werden beginnt, was sich aber
beim bereits erwähnten Zustand der unteren Partien
leider nicht weiter verfolgen läßt.
Das alles spricht für eine etwas spätere Ent-
stehung der Brunecker Bilder und findet sich auch
auf anderen Tiroler Wandgemälden, die in der Über-
gangszeit vom früheren, sogenannten „Idealstil“ mit
seinen weichen Linien und sanften Figuren zur
derberen Realistik der zweiten Hälfte des XV. Jhs.
entstanden sind. Da die Brixner Bilder das Datum
1417 tragen, ist unser Bildstock wohl um 1430 anzu-
setzen. Damit stimmt denn auch der Stil des ein-
zigen noch besser erkennbaren Hauptbildes, der
Kunstgeschiclitliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 1913
Kreuzigung, überein. Diese übertriebene Magerkeit
des Körpers und dieses Antlitz mit den schief gegen
die Nasenwurzel ansteigenden Brauen meldet sich
auf tirolischen Wandgemälden das erste Mal, und
zwar noch recht schüchtern, in Campill bei Bozen
und erscheint in den Vierzigerjahren (Brixen, 7. Ar-
kade) schon voll ausgeprägt.
Beide Faktoren, die große Verwandtschaft
einerseits und die etwas spätere Stilrichtung ander-
seits, lassen sich hinreichend erklären, wenn wir bei
dem Meister des Brunecker Bildstockes Brixnerische
Schulung voraussetzen. Diese Annahme liegt ja
auch sonst nahe genug. Das obere Pustertal ge-
hört nicht nur kirchlich zu Brixen, sondern hatte
auch politisch den Fürsten von Brixen zu seinem
Herrn. Speziell Bruneck gravitierte als die Sommer-
residenz des Bischofs und als Sitz eines bischöf-
lichen Schloßhauptmannes naturgemäß vor allem
nach Brixen. Tatsächlich haben auch Brixner Maler
im XV. Jh. im Pustertale viel gemalt (vergleiche
Taisten, Innichen) und anderseits war für die Puster-
2
Fig. II Bildstock im Layener Ried
Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol
I 8
die in Lienz. Der weit besser ausgebildete Sinn für
dekorative Wirkung, der Reichtum des ornamentalen
Beiwerkes, die angestrebte und zum Teil auch er-
reichte Raumvertiefung (vgl. Dreifaltigkeitsbild und
das Bild der Stadt), die gravierten Heiligenscheine,
die Gesichtstypen beweisen das zur Genüge. Wir
haben hier Bilder vor uns, die den Einfluß der Tre-
centokunst deutlich zur Schau tragen.
Hält man in Tirol nach verwandten Werken
Umschau, so drängen sich vor allem die Ge-
mälde der vierten Arkade im Brixner Kreuz-
gange zum Vergleich auf. Es kommt uns dabei
zugute, daß auch dort am Gewölbe die Me-
daillons mit den Brustbildern der Evangelisten
und Kirchenväter vorhanden sind. Nicht nur
Einzelheiten, wie die eng schraffierten Heiligen-
scheine mit breitem Rand, der mattenförmig
geflochtene Hintergrund und die ganze Form
der Vierpaßmedaillons erinnern sehr stark an
diese Arkade, sondern vor allem auch das auf-
fallend dekorative Geschick des reichen und
einheitlichen Gesamtarrangements, durch das
sowohl unser Bildstock als auch die genannte
Arkade sich von allen benachbarten Werken
so deutlich abheben.
Trotzdem dürfen wir keinesfalls an den
gleichen Meister denken. Die Brixner Bilder
sind nicht nur in ihrer Gesamtwirkung äußerst
dekorativ, sondern auch in den Einzelheiten,
in den Gesichtstypen, in der Faltengebung, in
den Farben von einer seltenen Feinheit. Die
Brunecker Bilder aber sind weit derber. Man
braucht nur die Kirchenväter hier und dort
zu vergleichen. Auch die Gewandfalten, ob-
wohl sie im Grunde noch den frühgotischen
Schwung bewahren, sind weniger weich und
selbst die Schwunglinien wirken straff und
hart. Nach einzelnen Anzeichen, z. B. am
linken Arm oder am Humerale des hl. Ambro-
sius, möchte man auch vermuten, daß die Draperie
bereits knitterig zu werden beginnt, was sich aber
beim bereits erwähnten Zustand der unteren Partien
leider nicht weiter verfolgen läßt.
Das alles spricht für eine etwas spätere Ent-
stehung der Brunecker Bilder und findet sich auch
auf anderen Tiroler Wandgemälden, die in der Über-
gangszeit vom früheren, sogenannten „Idealstil“ mit
seinen weichen Linien und sanften Figuren zur
derberen Realistik der zweiten Hälfte des XV. Jhs.
entstanden sind. Da die Brixner Bilder das Datum
1417 tragen, ist unser Bildstock wohl um 1430 anzu-
setzen. Damit stimmt denn auch der Stil des ein-
zigen noch besser erkennbaren Hauptbildes, der
Kunstgeschiclitliches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission 1913
Kreuzigung, überein. Diese übertriebene Magerkeit
des Körpers und dieses Antlitz mit den schief gegen
die Nasenwurzel ansteigenden Brauen meldet sich
auf tirolischen Wandgemälden das erste Mal, und
zwar noch recht schüchtern, in Campill bei Bozen
und erscheint in den Vierzigerjahren (Brixen, 7. Ar-
kade) schon voll ausgeprägt.
Beide Faktoren, die große Verwandtschaft
einerseits und die etwas spätere Stilrichtung ander-
seits, lassen sich hinreichend erklären, wenn wir bei
dem Meister des Brunecker Bildstockes Brixnerische
Schulung voraussetzen. Diese Annahme liegt ja
auch sonst nahe genug. Das obere Pustertal ge-
hört nicht nur kirchlich zu Brixen, sondern hatte
auch politisch den Fürsten von Brixen zu seinem
Herrn. Speziell Bruneck gravitierte als die Sommer-
residenz des Bischofs und als Sitz eines bischöf-
lichen Schloßhauptmannes naturgemäß vor allem
nach Brixen. Tatsächlich haben auch Brixner Maler
im XV. Jh. im Pustertale viel gemalt (vergleiche
Taisten, Innichen) und anderseits war für die Puster-
2
Fig. II Bildstock im Layener Ried