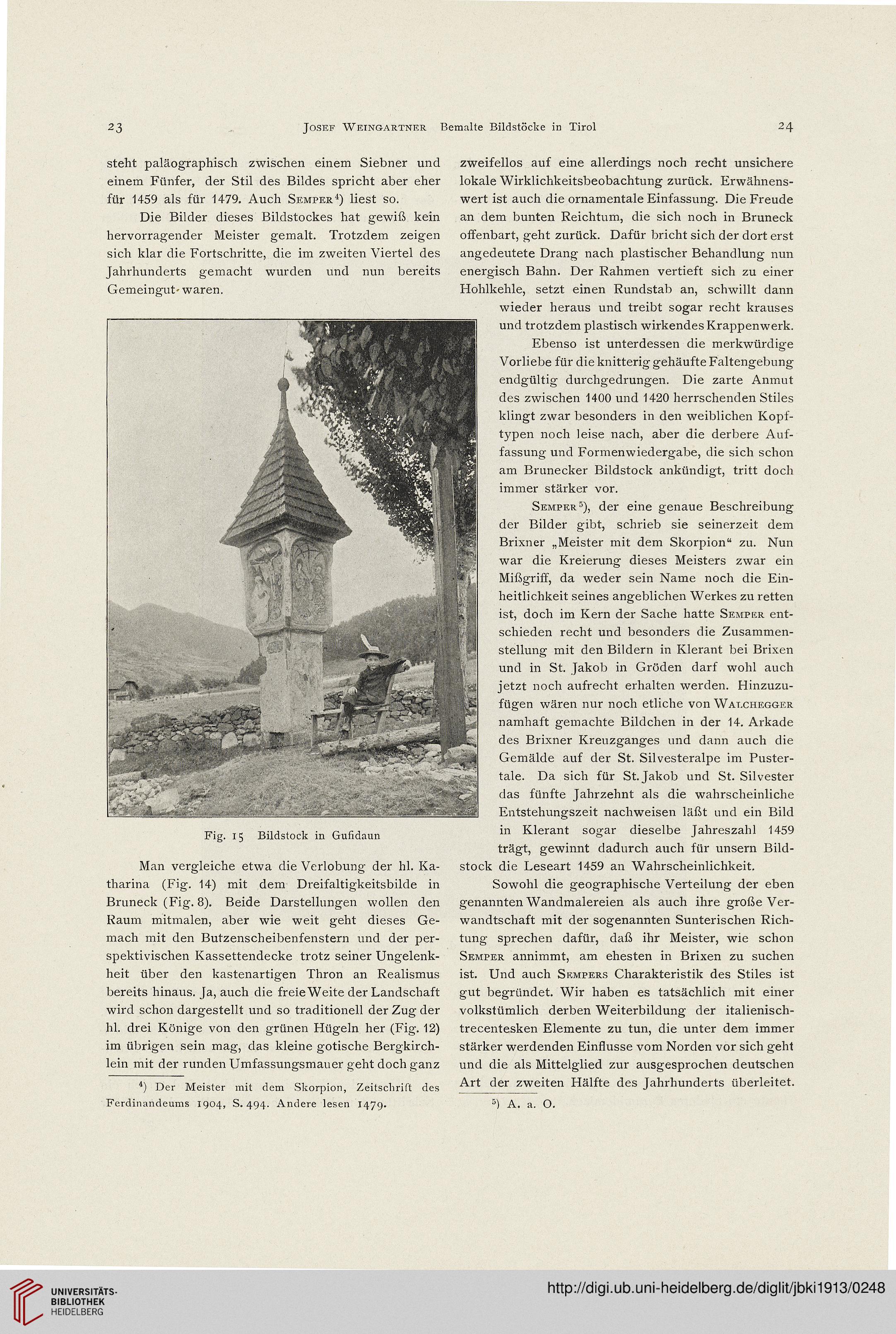23
Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol
2 4
steht paläographisch zwischen einem Siebner und
einem Fünfer, der Stil des Bildes spricht aber eher
für 1459 als für 1479. Auch Semper4) liest so.
Die Bilder dieses Bildstockes hat gewiß kein
hervorragender Meister gemalt. Trotzdem zeigen
sich klar die Fortschritte, die im zweiten Viertel des
Jahrhunderts gemacht wurden und nun bereits
Gemeingut- waren.
Man vergleiche etwa die Verlobung der hl. Ka-
tharina (Fig. 14) mit dem Dreifaltigkeitsbilde in
Bruneck (Fig. 8). Beide Darstellungen wollen den
Raum mitmalen, aber wie weit geht dieses Ge-
mach mit den Butzenscheibenfenstern und der per-
spektivischen Kassettendecke trotz seiner Ungelenk-
heit über den kastenartigen Thron an Realismus
bereits hinaus. Ja, auch die freie Weite der Landschaft
wird schon dargestellt und so traditionell der Zug der
hl. drei Könige von den grünen Hügeln her (Fig. 12)
im übrigen sein mag, das kleine gotische Bergkirch-
lein mit der runden Umfassungsmauer geht doch ganz
4) Der Meister mit dem Skorpion, Zeitschrift des
Ferdinandeums 1904, S. 494. Andere lesen 1479.
zweifellos auf eine allerdings noch recht unsichere
lokale Wirklichkeitsbeobachtung zurück. Erwähnens-
wert ist auch die ornamentale Einfassung. Die Freude
an dem bunten Reichtum, die sich noch in Bruneck
offenbart, geht zurück. Dafür bricht sich der dort erst
angedeutete Drang nach plastischer Behandlung nun
energisch Bahn. Der Rahmen vertieft sich zu einer
Hohlkehle, setzt einen Rundstab an, schwillt dann
wieder heraus und treibt sogar recht krauses
und trotzdem plastisch wirkendes Krappenwerk.
Ebenso ist unterdessen die merkwürdige
Vorliebe für die knitterig gehäufte Faltengebung
endgültig durchgedrungen. Die zarte Anmut
des zwischen 1400 und 1420 herrschenden Stiles
klingt zwar besonders in den weiblichen Kopf-
typen noch leise nach, aber die derbere Auf-
fassung und Formenwiedergabe, die sich schon
am Brunecker Bildstock ankündigt, tritt doch
immer stärker vor.
Semper5), der eine genaue Beschreibung
der Bilder gibt, schrieb sie seinerzeit dem
Brixner „Meister mit dem Skorpion“ zu. Nun
war die Kreierung dieses Meisters zwar ein
Mißgriff, da weder sein Name noch die Ein-
heitlichkeit seines angeblichen Werkes zu retten
ist, doch im Kern der Sache hatte Semper ent-
schieden recht und besonders die Zusammen-
stellung mit den Bildern in Klerant bei Brixen
und in St. Jakob in Groden darf wohl auch
jetzt noch aufrecht erhalten werden. Hinzuzu-
fügen wären nur noch etliche von Wat.chegger
namhaft gemachte Bildchen in der 14. Arkade
des Brixner Kreuzganges und dann auch die
Gemälde auf der St. Silvesteralpe im Puster-
tale. Da sich für St. Jakob und St. Silvester
das fünfte Jahrzehnt als die wahrscheinliche
Entstehungszeit nachweisen läßt und ein Bild
in Klerant sogar dieselbe Jahreszahl 1459
trägt, gewinnt dadurch auch für unsern Bild-
stock die Leseart 1459 an Wahrscheinlichkeit.
Sowohl die geographische Verteilung der eben
genannten Wandmalereien als auch ihre große Ver-
wandtschaft mit der sogenannten Sunterischen Rich-
tung sprechen dafür, daß ihr Meister, wie schon
Semper annimmt, am ehesten in Brixen zu suchen
ist. Und auch Sempers Charakteristik des Stiles ist
gut begründet. Wir haben es tatsächlich mit einer
volkstümlich derben Weiterbildung der italienisch-
trecentesken Elemente zu tun, die unter dem immer
stärker werdenden Einflüsse vom Norden vor sich geht
und die als Mittelglied zur ausgesprochen deutschen
Art der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überleitet.
5) A. a. O.
Fig. 15 Bildstock in Gufidaun
Josef Weingartner Bemalte Bildstöcke in Tirol
2 4
steht paläographisch zwischen einem Siebner und
einem Fünfer, der Stil des Bildes spricht aber eher
für 1459 als für 1479. Auch Semper4) liest so.
Die Bilder dieses Bildstockes hat gewiß kein
hervorragender Meister gemalt. Trotzdem zeigen
sich klar die Fortschritte, die im zweiten Viertel des
Jahrhunderts gemacht wurden und nun bereits
Gemeingut- waren.
Man vergleiche etwa die Verlobung der hl. Ka-
tharina (Fig. 14) mit dem Dreifaltigkeitsbilde in
Bruneck (Fig. 8). Beide Darstellungen wollen den
Raum mitmalen, aber wie weit geht dieses Ge-
mach mit den Butzenscheibenfenstern und der per-
spektivischen Kassettendecke trotz seiner Ungelenk-
heit über den kastenartigen Thron an Realismus
bereits hinaus. Ja, auch die freie Weite der Landschaft
wird schon dargestellt und so traditionell der Zug der
hl. drei Könige von den grünen Hügeln her (Fig. 12)
im übrigen sein mag, das kleine gotische Bergkirch-
lein mit der runden Umfassungsmauer geht doch ganz
4) Der Meister mit dem Skorpion, Zeitschrift des
Ferdinandeums 1904, S. 494. Andere lesen 1479.
zweifellos auf eine allerdings noch recht unsichere
lokale Wirklichkeitsbeobachtung zurück. Erwähnens-
wert ist auch die ornamentale Einfassung. Die Freude
an dem bunten Reichtum, die sich noch in Bruneck
offenbart, geht zurück. Dafür bricht sich der dort erst
angedeutete Drang nach plastischer Behandlung nun
energisch Bahn. Der Rahmen vertieft sich zu einer
Hohlkehle, setzt einen Rundstab an, schwillt dann
wieder heraus und treibt sogar recht krauses
und trotzdem plastisch wirkendes Krappenwerk.
Ebenso ist unterdessen die merkwürdige
Vorliebe für die knitterig gehäufte Faltengebung
endgültig durchgedrungen. Die zarte Anmut
des zwischen 1400 und 1420 herrschenden Stiles
klingt zwar besonders in den weiblichen Kopf-
typen noch leise nach, aber die derbere Auf-
fassung und Formenwiedergabe, die sich schon
am Brunecker Bildstock ankündigt, tritt doch
immer stärker vor.
Semper5), der eine genaue Beschreibung
der Bilder gibt, schrieb sie seinerzeit dem
Brixner „Meister mit dem Skorpion“ zu. Nun
war die Kreierung dieses Meisters zwar ein
Mißgriff, da weder sein Name noch die Ein-
heitlichkeit seines angeblichen Werkes zu retten
ist, doch im Kern der Sache hatte Semper ent-
schieden recht und besonders die Zusammen-
stellung mit den Bildern in Klerant bei Brixen
und in St. Jakob in Groden darf wohl auch
jetzt noch aufrecht erhalten werden. Hinzuzu-
fügen wären nur noch etliche von Wat.chegger
namhaft gemachte Bildchen in der 14. Arkade
des Brixner Kreuzganges und dann auch die
Gemälde auf der St. Silvesteralpe im Puster-
tale. Da sich für St. Jakob und St. Silvester
das fünfte Jahrzehnt als die wahrscheinliche
Entstehungszeit nachweisen läßt und ein Bild
in Klerant sogar dieselbe Jahreszahl 1459
trägt, gewinnt dadurch auch für unsern Bild-
stock die Leseart 1459 an Wahrscheinlichkeit.
Sowohl die geographische Verteilung der eben
genannten Wandmalereien als auch ihre große Ver-
wandtschaft mit der sogenannten Sunterischen Rich-
tung sprechen dafür, daß ihr Meister, wie schon
Semper annimmt, am ehesten in Brixen zu suchen
ist. Und auch Sempers Charakteristik des Stiles ist
gut begründet. Wir haben es tatsächlich mit einer
volkstümlich derben Weiterbildung der italienisch-
trecentesken Elemente zu tun, die unter dem immer
stärker werdenden Einflüsse vom Norden vor sich geht
und die als Mittelglied zur ausgesprochen deutschen
Art der zweiten Hälfte des Jahrhunderts überleitet.
5) A. a. O.
Fig. 15 Bildstock in Gufidaun