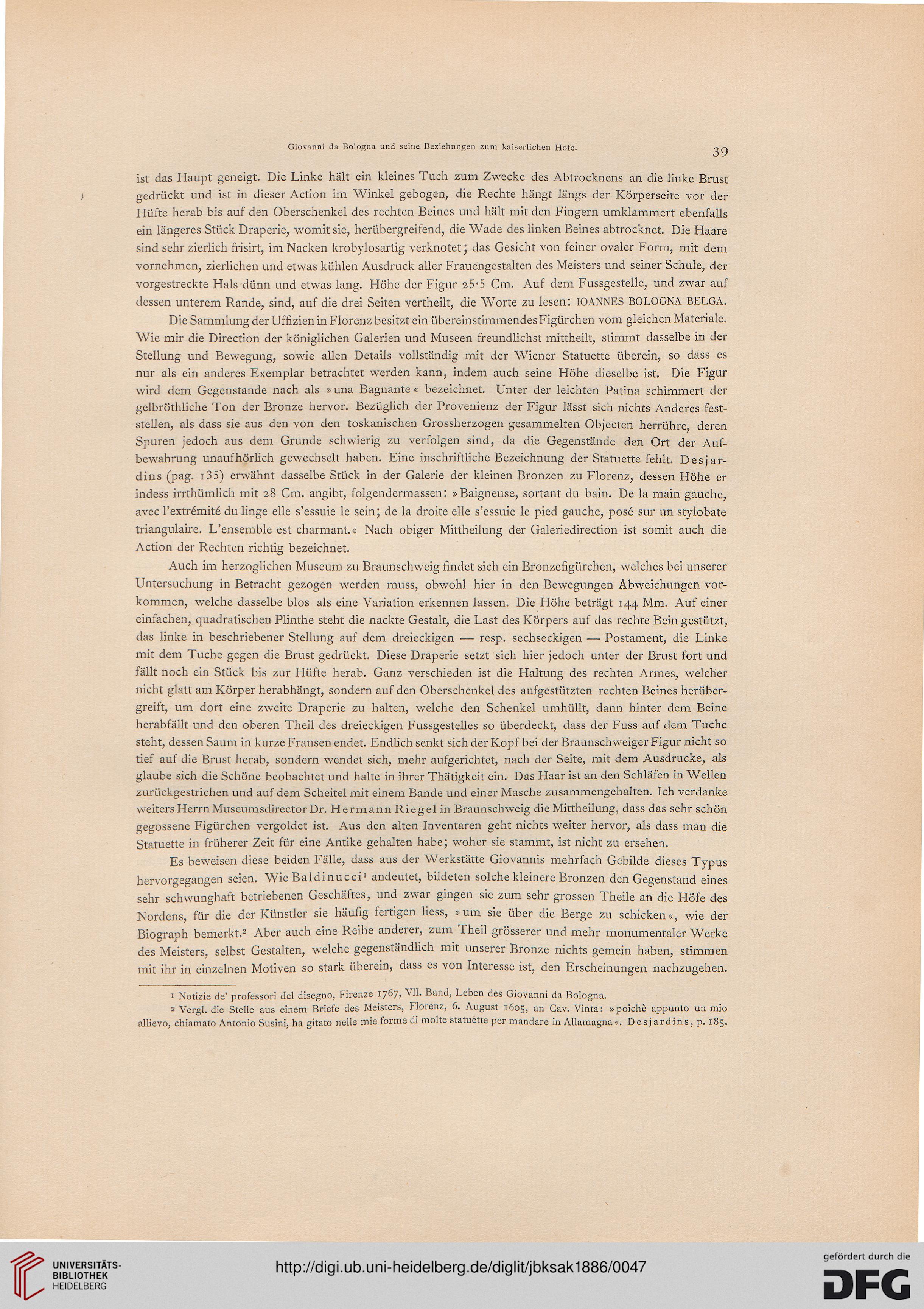Giovanni da Bologna und seine Beziehungen zum kaiserlichen Hofe. oq
ist das Haupt geneigt. Die Linke hält ein kleines Tuch zum Zwecke des Abtrocknens an die linke Brust
gedrückt und ist in dieser Action im Winkel gebogen, die Rechte hängt längs der Körperseite vor der
Hüfte herab bis auf den Oberschenkel des rechten Beines und hält mit den Fingern umklammert ebenfalls
ein längeres Stück Draperie, womit sie, herubergreifend, die Wade des linken Beines abtrocknet. Die Haare
sind sehr zierlich frisirt, im Nacken krobylosartig verknotet; das Gesicht von feiner ovaler Form, mit dem
vornehmen, zierlichen und etwas kühlen Ausdruck aller Frauengestalten des Meisters und seiner Schule, der
vorgestreckte Hals dünn und etwas lang. Höhe der Figur 25-5 Cm. Auf dem Fussgestelle, und zwar auf
dessen unterem Rande, sind, auf die drei Seiten vertheilt, die Worte zu lesen: IOANNES BOLOGNA BELGA.
Die Sammlung derUffizien in Florenz besitzt ein übereinstimmendes Figürchen vom gleichen Materiale.
Wie mir die Direction der königlichen Galerien und Museen freundlichst mittheilt, stimmt dasselbe in der
Stellung und Bewegung, sowie allen Details vollständig mit der Wiener Statuette überein, so dass es
nur als ein anderes Exemplar betrachtet werden kann, indem auch seine Höhe dieselbe ist. Die Figur
wird dem Gegenstande nach als »una Bagnante « bezeichnet. Unter der leichten Patina schimmert der
gelbröthliche Ton der Bronze hervor. Bezüglich der Provenienz der Figur lässt sich nichts Anderes fest-
stellen, als dass sie aus den von den toskanischen Grossherzogen gesammelten Objecten herrühre, deren
Spuren jedoch aus dem Grunde schwierig zu verfolgen sind, da die Gegenstände den Ort der Auf-
bewahrung unaufhörlich gewechselt haben. Eine inschriftliche Bezeichnung der Statuette fehlt. Desjar-
dins (pag. 135) erwähnt dasselbe Stück in der Galerie der kleinen Bronzen zu Florenz, dessen Höhe er
indess irrthümlich mit 28 Cm. angibt, folgendem)assen: »Baigneuse, sortant du bain. De la main gauche,
avec l'extremite du linge eile s'essuie le sein; de la droite eile s'essuie le pied gauche, pose sur un stylobate
triangulaire. L'ensemble est charmant.« Nach obiger Mittheilung der Galeriedirection ist somit auch die
Action der Rechten richtig bezeichnet.
Auch im herzoglichen Museum zu Braunschweig findet sich ein Bronzefigürchen, welches bei unserer
Untersuchung in Betracht gezogen werden muss, obwohl hier in den Bewegungen Abweichungen vor-
kommen, welche dasselbe blos als eine Variation erkennen lassen. Die Höhe beträgt 144 Mm. Auf einer
einfachen, quadratischen Plinthe steht die nackte Gestalt, die Last des Körpers auf das rechte Bein gestützt,
das linke in beschriebener Stellung auf dem dreieckigen — resp. sechseckigen — Postament, die Linke
mit dem Tuche gegen die Brust gedrückt. Diese Draperie setzt sich hier jedoch unter der Brust fort und
fällt noch ein Stück bis zur Hüfte herab. Ganz verschieden ist die Haltung des rechten Armes, welcher
nicht glatt am Körper herabhängt, sondern auf den Oberschenkel des aufgestützten rechten Beines herüber-
greift, um dort eine zweite Draperie zu halten, welche den Schenkel umhüllt, dann hinter dem Beine
herabfällt und den oberen Theil des dreieckigen Fussgestelles so überdeckt, dass der Fuss auf dem Tuche
steht, dessen Saum in kurze Fransen endet. Endlich senkt sich der Kopf bei der Braunschweiger Figur nicht so
tief auf die Brust herab, sondern wendet sich, mehr aufgerichtet, nach der Seite, mit dem Ausdrucke, als
glaube sich die Schöne beobachtet und halte in ihrer Thätigkeit ein. Das Haar ist an den Schläfen in Wellen
zurückgestrichen und auf dem Scheitel mit einem Bande und einer Masche zusammengehalten. Ich verdanke
weiters Herrn Museumsdirector Dr. Hermann Riegel in Braunschweig die Mittheilung, dass das sehr schön
gegossene Figürchen vergoldet ist. Aus den alten Inventaren geht nichts weiter hervor, als dass man die
Statuette in früherer Zeit für eine Antike gehalten habe; woher sie stammt, ist nicht zu ersehen.
Es beweisen diese beiden Fälle, dass aus der Werkstätte Giovannis mehrfach Gebilde dieses Typus
hervorgegangen seien. Wie Baldinucci1 andeutet, bildeten solche kleinere Bronzen den Gegenstand eines
sehr schwunghaft betriebenen Geschäftes, und zwar gingen sie zum sehr grossen Theile an die Hofe des
Nordens, für die der Künstler sie häufig fertigen liess, »um sie über die Berge zu schicken«, wie der
Biograph bemerkt.2 Aber auch eine Reihe anderer, zum Theil grösserer und mehr monumentaler Werke
des Meisters, selbst Gestalten, welche gegenständlich mit unserer Bronze nichts gemein haben, stimmen
mit ihr in einzelnen Motiven so stark überein, dass es von Interesse ist, den Erscheinungen nachzugehen.
1 Notizie de' professori del disegno, Firenze 1767, VII. Band, Leben des Giovanni da Bologna.
2 Vergl. die Stelle aus einem Briefe des Meisters, Florenz, 6. August 1605, an Cav. Vinta: »poiehe appunto un mio
allievo, chiamato Antonio Susini, ha gitato nelle mie forme di molte Statuette per mandare in Allamagna«. Desjardins,p. 185.
ist das Haupt geneigt. Die Linke hält ein kleines Tuch zum Zwecke des Abtrocknens an die linke Brust
gedrückt und ist in dieser Action im Winkel gebogen, die Rechte hängt längs der Körperseite vor der
Hüfte herab bis auf den Oberschenkel des rechten Beines und hält mit den Fingern umklammert ebenfalls
ein längeres Stück Draperie, womit sie, herubergreifend, die Wade des linken Beines abtrocknet. Die Haare
sind sehr zierlich frisirt, im Nacken krobylosartig verknotet; das Gesicht von feiner ovaler Form, mit dem
vornehmen, zierlichen und etwas kühlen Ausdruck aller Frauengestalten des Meisters und seiner Schule, der
vorgestreckte Hals dünn und etwas lang. Höhe der Figur 25-5 Cm. Auf dem Fussgestelle, und zwar auf
dessen unterem Rande, sind, auf die drei Seiten vertheilt, die Worte zu lesen: IOANNES BOLOGNA BELGA.
Die Sammlung derUffizien in Florenz besitzt ein übereinstimmendes Figürchen vom gleichen Materiale.
Wie mir die Direction der königlichen Galerien und Museen freundlichst mittheilt, stimmt dasselbe in der
Stellung und Bewegung, sowie allen Details vollständig mit der Wiener Statuette überein, so dass es
nur als ein anderes Exemplar betrachtet werden kann, indem auch seine Höhe dieselbe ist. Die Figur
wird dem Gegenstande nach als »una Bagnante « bezeichnet. Unter der leichten Patina schimmert der
gelbröthliche Ton der Bronze hervor. Bezüglich der Provenienz der Figur lässt sich nichts Anderes fest-
stellen, als dass sie aus den von den toskanischen Grossherzogen gesammelten Objecten herrühre, deren
Spuren jedoch aus dem Grunde schwierig zu verfolgen sind, da die Gegenstände den Ort der Auf-
bewahrung unaufhörlich gewechselt haben. Eine inschriftliche Bezeichnung der Statuette fehlt. Desjar-
dins (pag. 135) erwähnt dasselbe Stück in der Galerie der kleinen Bronzen zu Florenz, dessen Höhe er
indess irrthümlich mit 28 Cm. angibt, folgendem)assen: »Baigneuse, sortant du bain. De la main gauche,
avec l'extremite du linge eile s'essuie le sein; de la droite eile s'essuie le pied gauche, pose sur un stylobate
triangulaire. L'ensemble est charmant.« Nach obiger Mittheilung der Galeriedirection ist somit auch die
Action der Rechten richtig bezeichnet.
Auch im herzoglichen Museum zu Braunschweig findet sich ein Bronzefigürchen, welches bei unserer
Untersuchung in Betracht gezogen werden muss, obwohl hier in den Bewegungen Abweichungen vor-
kommen, welche dasselbe blos als eine Variation erkennen lassen. Die Höhe beträgt 144 Mm. Auf einer
einfachen, quadratischen Plinthe steht die nackte Gestalt, die Last des Körpers auf das rechte Bein gestützt,
das linke in beschriebener Stellung auf dem dreieckigen — resp. sechseckigen — Postament, die Linke
mit dem Tuche gegen die Brust gedrückt. Diese Draperie setzt sich hier jedoch unter der Brust fort und
fällt noch ein Stück bis zur Hüfte herab. Ganz verschieden ist die Haltung des rechten Armes, welcher
nicht glatt am Körper herabhängt, sondern auf den Oberschenkel des aufgestützten rechten Beines herüber-
greift, um dort eine zweite Draperie zu halten, welche den Schenkel umhüllt, dann hinter dem Beine
herabfällt und den oberen Theil des dreieckigen Fussgestelles so überdeckt, dass der Fuss auf dem Tuche
steht, dessen Saum in kurze Fransen endet. Endlich senkt sich der Kopf bei der Braunschweiger Figur nicht so
tief auf die Brust herab, sondern wendet sich, mehr aufgerichtet, nach der Seite, mit dem Ausdrucke, als
glaube sich die Schöne beobachtet und halte in ihrer Thätigkeit ein. Das Haar ist an den Schläfen in Wellen
zurückgestrichen und auf dem Scheitel mit einem Bande und einer Masche zusammengehalten. Ich verdanke
weiters Herrn Museumsdirector Dr. Hermann Riegel in Braunschweig die Mittheilung, dass das sehr schön
gegossene Figürchen vergoldet ist. Aus den alten Inventaren geht nichts weiter hervor, als dass man die
Statuette in früherer Zeit für eine Antike gehalten habe; woher sie stammt, ist nicht zu ersehen.
Es beweisen diese beiden Fälle, dass aus der Werkstätte Giovannis mehrfach Gebilde dieses Typus
hervorgegangen seien. Wie Baldinucci1 andeutet, bildeten solche kleinere Bronzen den Gegenstand eines
sehr schwunghaft betriebenen Geschäftes, und zwar gingen sie zum sehr grossen Theile an die Hofe des
Nordens, für die der Künstler sie häufig fertigen liess, »um sie über die Berge zu schicken«, wie der
Biograph bemerkt.2 Aber auch eine Reihe anderer, zum Theil grösserer und mehr monumentaler Werke
des Meisters, selbst Gestalten, welche gegenständlich mit unserer Bronze nichts gemein haben, stimmen
mit ihr in einzelnen Motiven so stark überein, dass es von Interesse ist, den Erscheinungen nachzugehen.
1 Notizie de' professori del disegno, Firenze 1767, VII. Band, Leben des Giovanni da Bologna.
2 Vergl. die Stelle aus einem Briefe des Meisters, Florenz, 6. August 1605, an Cav. Vinta: »poiehe appunto un mio
allievo, chiamato Antonio Susini, ha gitato nelle mie forme di molte Statuette per mandare in Allamagna«. Desjardins,p. 185.