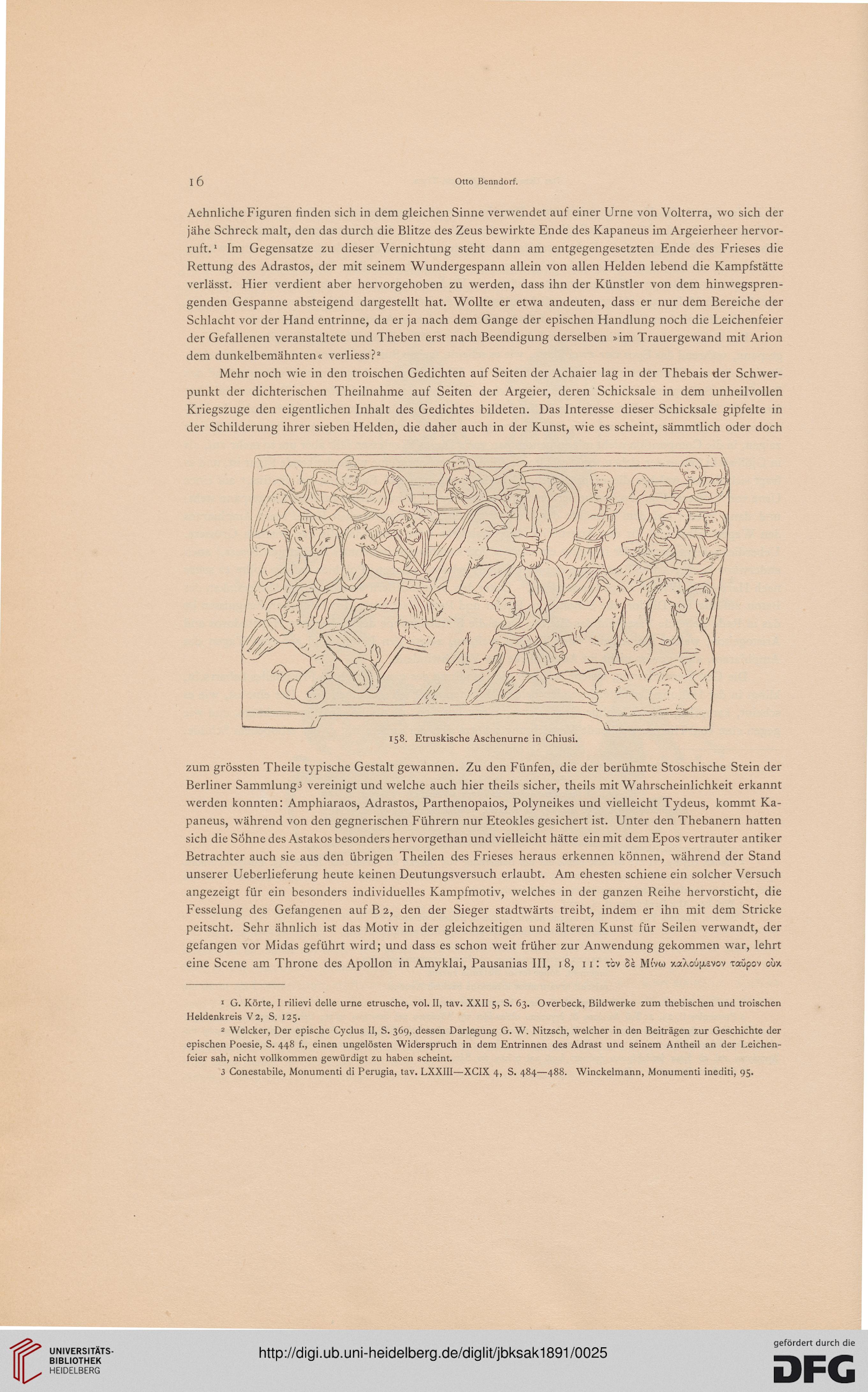i6
Otto Benndorf.
Achnliche Figuren rinden sich in dem gleichen Sinne verwendet auf einer Urne von Volterra, wo sich der
jähe Schreck malt, den das durch die Blitze des Zeus bewirkte Ende des Kapaneus im Argeierheer hervor-
ruft. 1 Im Gegensatze zu dieser Vernichtung steht dann am entgegengesetzten Ende des Frieses die
Rettung des Adrastos, der mit seinem Wundergespann allein von allen Helden lebend die Kampfstätte
verlässt. Hier verdient aber hervorgehoben zu werden, dass ihn der Künstler von dem hinwegspren-
genden Gespanne absteigend dargestellt hat. Wollte er etwa andeuten, dass er nur dem Bereiche der
Schlacht vor der Hand entrinne, da er ja nach dem Gange der epischen Handlung noch die Leichenfeier
der Gefallenen veranstaltete und Theben erst nach Beendigung derselben »im Trauergewand mit Arion
dem dunkelbemähnten« verliess?2
Mehr noch wie in den troischen Gedichten auf Seiten der Achaier lag in der Thebais der Schwer-
punkt der dichterischen Theilnahme auf Seiten der Argeier, deren Schicksale in dem unheilvollen
Kriegszuge den eigentlichen Inhalt des Gedichtes bildeten. Das Interesse dieser Schicksale gipfelte in
der Schilderung ihrer sieben Helden, die daher auch in der Kunst, wie es scheint, sämmtlich oder doch
158. Etruskische Aschenurne in Chiusi.
zum grössten Theile typische Gestalt gewannen. Zu den Fünfen, die der berühmte Stoschische Stein der
Berliner Sammlung^ vereinigt und welche auch hier theils sicher, theils mit Wahrscheinlichkeit erkannt
werden konnten: Amphiaraos, Adrastos, Parthenopaios, Polyneikes und vielleicht Tydeus, kommt Ka-
paneus, während von den gegnerischen Führern nur Eteokles gesichert ist. Unter den Thebanern hatten
sich die Söhne des Astakos besonders hervorgethan und vielleicht hätte ein mit dem Epos vertrauter antiker
Betrachter auch sie aus den übrigen Theilen des Frieses heraus erkennen können, während der Stand
unserer Ueberlieferung heute keinen Deutungsversuch erlaubt. Am ehesten schiene ein solcher Versuch
angezeigt für ein besonders individuelles Kampfmotiv, welches in der ganzen Reihe hervorsticht, die
Fesselung des Gefangenen auf B 2, den der Sieger stadtwärts treibt, indem er ihn mit dem Stricke
peitscht. Sehr ähnlich ist das Motiv in der gleichzeitigen und älteren Kunst für Seilen verwandt, der
gefangen vor Midas geführt wird; und dass es schon weit früher zur Anwendung gekommen war, lehrt
eine Scene am Throne des Apollon in Amyklai, Pausanias III, 18, 11: xbv Bk Mfvw xaXoüjj.svov xaüpov oüx
1 G. Körte, I rilievi delle urne etrusche, vol. II, tav. XXII 5, S. 63. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen
Heldenkreis V2, S. 125.
2 Welcker, Der epische Cyclus II, S. 369, dessen Darlegung G.W. Nitzsch, welcher in den Beiträgen zur Geschichte der
epischen Poesie, S. 448 f., einen ungelösten Widerspruch in dem Entrinnen des Adrast und seinem Antheil an der Leichen-
feier sah, nicht vollkommen gewürdigt zu haben scheint.
3 Conestabile, Monumenti di Perugia, tav. LXXIII—XCIX 4, S. 484—488. Winckelmann, Monumenti inediti, 95.
Otto Benndorf.
Achnliche Figuren rinden sich in dem gleichen Sinne verwendet auf einer Urne von Volterra, wo sich der
jähe Schreck malt, den das durch die Blitze des Zeus bewirkte Ende des Kapaneus im Argeierheer hervor-
ruft. 1 Im Gegensatze zu dieser Vernichtung steht dann am entgegengesetzten Ende des Frieses die
Rettung des Adrastos, der mit seinem Wundergespann allein von allen Helden lebend die Kampfstätte
verlässt. Hier verdient aber hervorgehoben zu werden, dass ihn der Künstler von dem hinwegspren-
genden Gespanne absteigend dargestellt hat. Wollte er etwa andeuten, dass er nur dem Bereiche der
Schlacht vor der Hand entrinne, da er ja nach dem Gange der epischen Handlung noch die Leichenfeier
der Gefallenen veranstaltete und Theben erst nach Beendigung derselben »im Trauergewand mit Arion
dem dunkelbemähnten« verliess?2
Mehr noch wie in den troischen Gedichten auf Seiten der Achaier lag in der Thebais der Schwer-
punkt der dichterischen Theilnahme auf Seiten der Argeier, deren Schicksale in dem unheilvollen
Kriegszuge den eigentlichen Inhalt des Gedichtes bildeten. Das Interesse dieser Schicksale gipfelte in
der Schilderung ihrer sieben Helden, die daher auch in der Kunst, wie es scheint, sämmtlich oder doch
158. Etruskische Aschenurne in Chiusi.
zum grössten Theile typische Gestalt gewannen. Zu den Fünfen, die der berühmte Stoschische Stein der
Berliner Sammlung^ vereinigt und welche auch hier theils sicher, theils mit Wahrscheinlichkeit erkannt
werden konnten: Amphiaraos, Adrastos, Parthenopaios, Polyneikes und vielleicht Tydeus, kommt Ka-
paneus, während von den gegnerischen Führern nur Eteokles gesichert ist. Unter den Thebanern hatten
sich die Söhne des Astakos besonders hervorgethan und vielleicht hätte ein mit dem Epos vertrauter antiker
Betrachter auch sie aus den übrigen Theilen des Frieses heraus erkennen können, während der Stand
unserer Ueberlieferung heute keinen Deutungsversuch erlaubt. Am ehesten schiene ein solcher Versuch
angezeigt für ein besonders individuelles Kampfmotiv, welches in der ganzen Reihe hervorsticht, die
Fesselung des Gefangenen auf B 2, den der Sieger stadtwärts treibt, indem er ihn mit dem Stricke
peitscht. Sehr ähnlich ist das Motiv in der gleichzeitigen und älteren Kunst für Seilen verwandt, der
gefangen vor Midas geführt wird; und dass es schon weit früher zur Anwendung gekommen war, lehrt
eine Scene am Throne des Apollon in Amyklai, Pausanias III, 18, 11: xbv Bk Mfvw xaXoüjj.svov xaüpov oüx
1 G. Körte, I rilievi delle urne etrusche, vol. II, tav. XXII 5, S. 63. Overbeck, Bildwerke zum thebischen und troischen
Heldenkreis V2, S. 125.
2 Welcker, Der epische Cyclus II, S. 369, dessen Darlegung G.W. Nitzsch, welcher in den Beiträgen zur Geschichte der
epischen Poesie, S. 448 f., einen ungelösten Widerspruch in dem Entrinnen des Adrast und seinem Antheil an der Leichen-
feier sah, nicht vollkommen gewürdigt zu haben scheint.
3 Conestabile, Monumenti di Perugia, tav. LXXIII—XCIX 4, S. 484—488. Winckelmann, Monumenti inediti, 95.