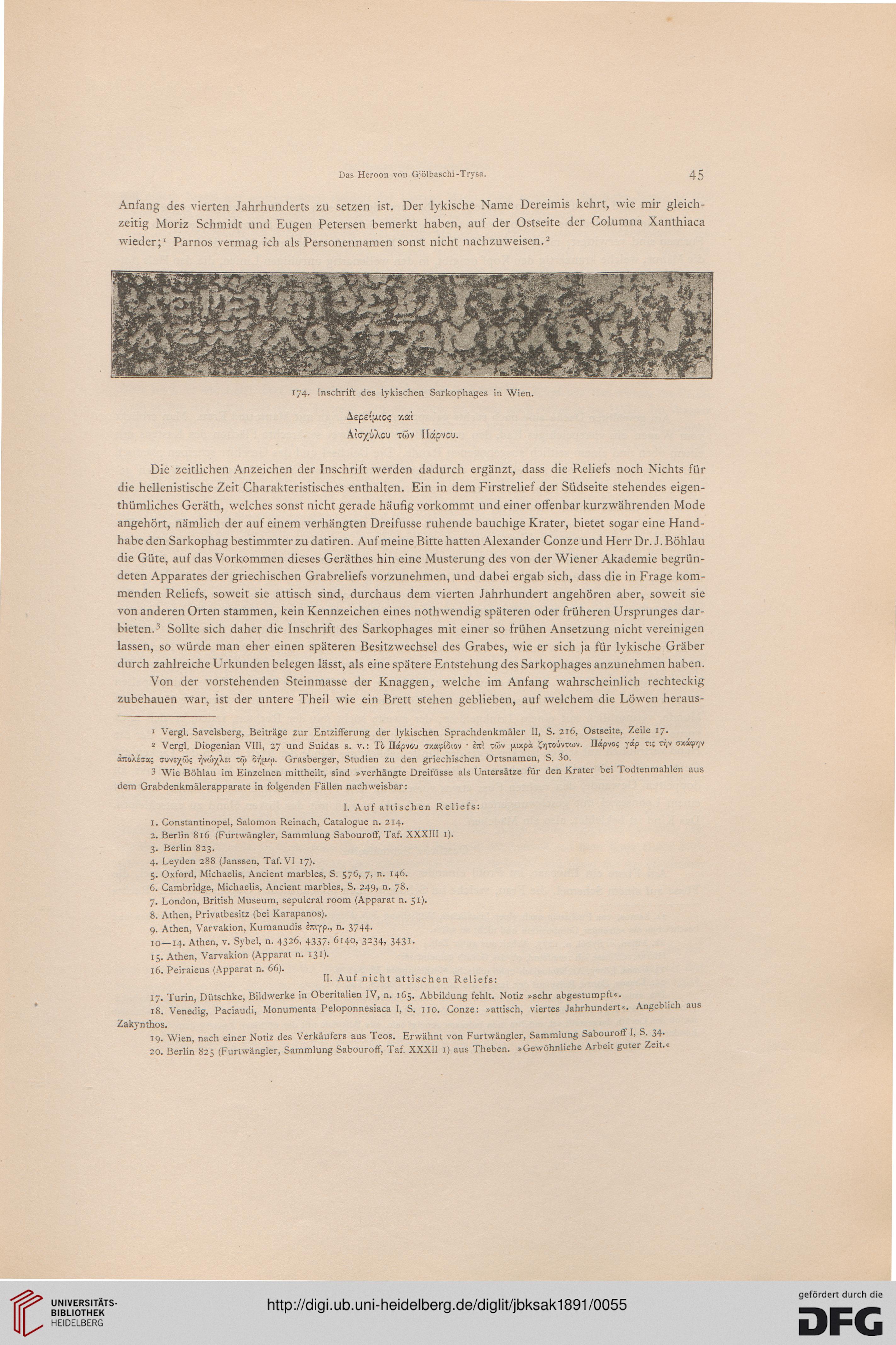Das Heroon von Gjülbaschi-Trysa.
45
Anfang des vierten Jahrhunderts zu setzen ist. Der lykische Name Dereimis kehrt, wie mir gleich-
zeitig Moriz Schmidt und Eugen Petersen bemerkt haben, auf der Ostseite der Columna Xanthiaca
wieder;1 Parnos vermag ich als Personennamen sonst nicht nachzuweisen.2
174. Inschrift des lykischen Sarkophages in Wien.
Aepst'jjuos xai
A!cr/_üXo'j töv Dipvou.
Die zeitlichen Anzeichen der Inschrift werden dadurch ergänzt, dass die Reliefs noch Nichts für
die hellenistische Zeit Charakteristisches -enthalten. Ein in dem Firstrelief der Südseite stehendes eigen-
tümliches Geräth, welches sonst nicht gerade häufig vorkommt und einer offenbar kurzwährenden Mode
angehört, nämlich der auf einem verhängten Dreifusse ruhende bauchige Krater, bietet sogar eine Hand-
habe den Sarkophag bestimmter zu datiren. Auf meine Bitte hatten Alexander Conze und Herr Dr. J. Böhlau
die Güte, auf das Vorkommen dieses Geräthes hin eine Musterung des von der Wiener Akademie begrün-
deten Apparates der griechischen Grabreliefs vorzunehmen, und dabei ergab sich, dass die in Frage kom-
menden Reliefs, soweit sie attisch sind, durchaus dem vierten Jahrhundert angehören aber, soweit sie
von anderen Orten stammen, kein Kennzeichen eines nothwendig späteren oder früheren Ursprunges dar-
bieten.- Sollte sich daher die Inschrift des Sarkophages mit einer so frühen Ansetzung nicht vereinigen
lassen, so würde man eher einen späteren Besitzwechsel des Grabes, wie er sich ja für lykische Gräber
durch zahlreiche Urkunden belegen lässt, als eine spätere Entstehung des Sarkophages anzunehmen haben.
Von der vorstehenden Steinmasse der Knaggen, welche im Anfang wahrscheinlich rechteckig
zubehauen war, ist der untere Theil wie ein Brett stehen geblieben, auf welchem die Löwen heraus-
1 Vergl. Savelsberg, Beiträge zur Entzifferung der lykischen Sprachdenkmäler II, S. 216, Ostseite, Zeile 17.
2 Vergl. Diogenian VIII, 27 und Suidas s. v.: Tb Ilipvou axc^Kiov ■ 2*; tüW (itxpä £7)ToivTtov. JJctpvo« fip ti; -rijv oxa?7)v
xioXsa«; tj'jvsj(ä); fywyXn Tai or,p.io. Grasberger, Studien zu den griechischen Ortsnamen, S. 3o.
3 Wie Böhlau im Einzelnen mittheilt, sind »verhängte Dreifüsse als Untersätze für den Krater bei Todtenmahlen aus
dem Grabdenkmälerapparate in folgenden Fällen nachweisbar:
I. Auf attischen Reliefs:
1. Constantinopel, Salomon Reinach, Catalogue n. 214.
2. Berlin 816 (Furtvvängler, Sammlung Sabouroff, Taf. XXXIII 1).
3. Berlin 823.
4. Leyden 288 (Janssen, Taf. VI 17).
5. Oxford, Michaelis, Ancient marbles, S. 576, 7, n. 146.
6. Cambridge, Michaelis, Ancient marbles, S. 249, n. 78.
7. London, British Museum, sepulcral room (Apparat n. 51).
8. Athen, Privatbesitz (bei Karapanos).
9. Athen, Varvakion, Kumanudis imyp., n. 3744.
10—14. Athen, v. Sybel, n. 4326, 4337, 6140, 3234, 3431.
15. Athen, Varvakion (Apparat n. 131).
16. Peiraieus (Apparat n. 66).
II. Auf nicht attischen Reliefs:
17. Turin, Dütschke, Bildwerke in Oberitalien IV, n. 165. Abbildung fehlt. Notiz »sehr abgestumpft«.
18. Venedig, Paciaudi, Monumenta Peloponnesiaca I, S. 110. Conze: »attisch, viertes Jahrhundert«. Angeblich aus
Zakynthos.
19. Wien, nach einer Notiz des Verkäufers aus Teos. Erwähnt von Furtwängler, Sammlung Sabouroff I, S. 34.
20. Berlin 825 (Furtwängler, Sammlung Sabouroff, Taf. XXXII 1) aus Theben. »Gewöhnliche Arbeit guter Zeit.«
45
Anfang des vierten Jahrhunderts zu setzen ist. Der lykische Name Dereimis kehrt, wie mir gleich-
zeitig Moriz Schmidt und Eugen Petersen bemerkt haben, auf der Ostseite der Columna Xanthiaca
wieder;1 Parnos vermag ich als Personennamen sonst nicht nachzuweisen.2
174. Inschrift des lykischen Sarkophages in Wien.
Aepst'jjuos xai
A!cr/_üXo'j töv Dipvou.
Die zeitlichen Anzeichen der Inschrift werden dadurch ergänzt, dass die Reliefs noch Nichts für
die hellenistische Zeit Charakteristisches -enthalten. Ein in dem Firstrelief der Südseite stehendes eigen-
tümliches Geräth, welches sonst nicht gerade häufig vorkommt und einer offenbar kurzwährenden Mode
angehört, nämlich der auf einem verhängten Dreifusse ruhende bauchige Krater, bietet sogar eine Hand-
habe den Sarkophag bestimmter zu datiren. Auf meine Bitte hatten Alexander Conze und Herr Dr. J. Böhlau
die Güte, auf das Vorkommen dieses Geräthes hin eine Musterung des von der Wiener Akademie begrün-
deten Apparates der griechischen Grabreliefs vorzunehmen, und dabei ergab sich, dass die in Frage kom-
menden Reliefs, soweit sie attisch sind, durchaus dem vierten Jahrhundert angehören aber, soweit sie
von anderen Orten stammen, kein Kennzeichen eines nothwendig späteren oder früheren Ursprunges dar-
bieten.- Sollte sich daher die Inschrift des Sarkophages mit einer so frühen Ansetzung nicht vereinigen
lassen, so würde man eher einen späteren Besitzwechsel des Grabes, wie er sich ja für lykische Gräber
durch zahlreiche Urkunden belegen lässt, als eine spätere Entstehung des Sarkophages anzunehmen haben.
Von der vorstehenden Steinmasse der Knaggen, welche im Anfang wahrscheinlich rechteckig
zubehauen war, ist der untere Theil wie ein Brett stehen geblieben, auf welchem die Löwen heraus-
1 Vergl. Savelsberg, Beiträge zur Entzifferung der lykischen Sprachdenkmäler II, S. 216, Ostseite, Zeile 17.
2 Vergl. Diogenian VIII, 27 und Suidas s. v.: Tb Ilipvou axc^Kiov ■ 2*; tüW (itxpä £7)ToivTtov. JJctpvo« fip ti; -rijv oxa?7)v
xioXsa«; tj'jvsj(ä); fywyXn Tai or,p.io. Grasberger, Studien zu den griechischen Ortsnamen, S. 3o.
3 Wie Böhlau im Einzelnen mittheilt, sind »verhängte Dreifüsse als Untersätze für den Krater bei Todtenmahlen aus
dem Grabdenkmälerapparate in folgenden Fällen nachweisbar:
I. Auf attischen Reliefs:
1. Constantinopel, Salomon Reinach, Catalogue n. 214.
2. Berlin 816 (Furtvvängler, Sammlung Sabouroff, Taf. XXXIII 1).
3. Berlin 823.
4. Leyden 288 (Janssen, Taf. VI 17).
5. Oxford, Michaelis, Ancient marbles, S. 576, 7, n. 146.
6. Cambridge, Michaelis, Ancient marbles, S. 249, n. 78.
7. London, British Museum, sepulcral room (Apparat n. 51).
8. Athen, Privatbesitz (bei Karapanos).
9. Athen, Varvakion, Kumanudis imyp., n. 3744.
10—14. Athen, v. Sybel, n. 4326, 4337, 6140, 3234, 3431.
15. Athen, Varvakion (Apparat n. 131).
16. Peiraieus (Apparat n. 66).
II. Auf nicht attischen Reliefs:
17. Turin, Dütschke, Bildwerke in Oberitalien IV, n. 165. Abbildung fehlt. Notiz »sehr abgestumpft«.
18. Venedig, Paciaudi, Monumenta Peloponnesiaca I, S. 110. Conze: »attisch, viertes Jahrhundert«. Angeblich aus
Zakynthos.
19. Wien, nach einer Notiz des Verkäufers aus Teos. Erwähnt von Furtwängler, Sammlung Sabouroff I, S. 34.
20. Berlin 825 (Furtwängler, Sammlung Sabouroff, Taf. XXXII 1) aus Theben. »Gewöhnliche Arbeit guter Zeit.«