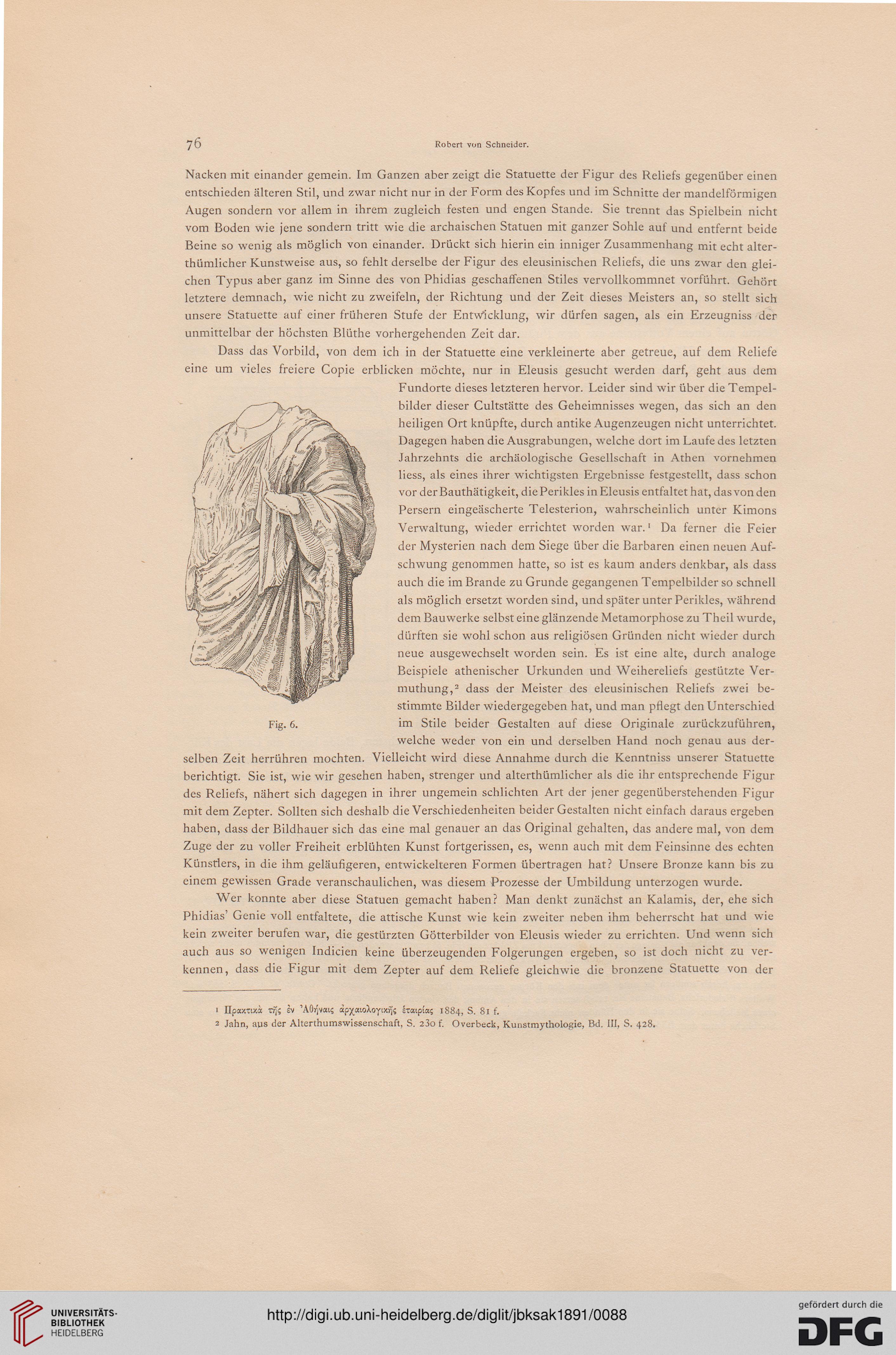76
Robert von Schneider.
Nacken mit einander gemein. Im Ganzen aber zeigt die Statuette der Figur des Reliefs gegenüber einen
entschieden älteren Stil, und zwar nicht nur in der Form des Kopfes und im Schnitte der mandelförmigen
Augen sondern vor allem in ihrem zugleich festen und engen Stande. Sie trennt das Spielbein nicht
vom Boden wie jene sondern tritt wie die archaischen Statuen mit ganzer Sohle auf und entfernt beide
Beine so wenig als möglich von einander. Drückt sich hierin ein inniger Zusammenhang mit echt alter-
thümlicher Kunstweise aus, so fehlt derselbe der Figur des eleusinischen Reliefs, die uns zwar den glei-
chen Typus aber ganz im Sinne des von Phidias geschaffenen Stiles vervollkommnet vorführt. Gehört
letztere demnach, wie nicht zu zweifeln, der Richtung und der Zeit dieses Meisters an, so stellt sich
unsere Statuette auf einer früheren Stufe der Entwicklung, wir dürfen sagen, als ein Erzeugniss der
unmittelbar der höchsten Blüthe vorhergehenden Zeit dar.
Dass das Vorbild, von dem ich in der Statuette eine verkleinerte aber getreue, auf dem Reliefe
eine um vieles freiere Copie erblicken möchte, nur in Eleusis gesucht werden darf, geht aus dem
Fundorte dieses letzteren hervor. Leider sind wir über die Tempel-
bilder dieser Cultstätte des Geheimnisses wegen, das sich an den
heiligen Ort knüpfte, durch antike Augenzeugen nicht unterrichtet.
Dagegen haben die Ausgrabungen, welche dort im Laufe des letzten
Jahrzehnts die archäologische Gesellschaft in Athen vornehmen
Hess, als eines ihrer wichtigsten Ergebnisse festgestellt, dass schon
vor der Bauthätigkeit, die Perikles in Eleusis entfaltet hat, das von den
Persern eingeäscherte Telesterion, wahrscheinlich unter Kimons
Verwaltung, wieder errichtet worden war.1 Da ferner die Feier
der Mysterien nach dem Siege über die Barbaren einen neuen Auf-
schwung genommen hatte, so ist es kaum anders denkbar, als dass
auch die im Brande zu Grunde gegangenen Tempelbilder so schnell
als möglich ersetzt worden sind, und später unter Perikles, während
dem Bauwerke selbst eine glänzende Metamorphose zu Theil wurde,
dürften sie wohl schon aus religiösen Gründen nicht wieder durch
neue ausgewechselt worden sein. Es ist eine alte, durch analoge
Beispiele athenischer Urkunden und Weihereliefs gestützte Ver-
muthung,2 dass der Meister des eleusinischen Reliefs zwei be-
stimmte Bilder wiedergegeben hat, und man pflegt den Unterschied
im Stile beider Gestalten auf diese Originale zurückzuführen,
welche weder von ein und derselben Hand noch genau aus der-
selben Zeit herrühren mochten. Vielleicht wird diese Annahme durch die Kenntniss unserer Statuette
berichtigt. Sie ist, wie wir gesehen haben, strenger und alterthümlicher als die ihr entsprechende Figur
des Reliefs, nähert sich dagegen in ihrer ungemein schlichten Art der jener gegenüberstehenden Figur
mit dem Zepter. Sollten sich deshalb die Verschiedenheiten beider Gestalten nicht einfach daraus ergeben
haben, dass der Bildhauer sich das eine mal genauer an das Original gehalten, das andere mal, von dem
Zuge der zu voller Freiheit erblühten Kunst fortgerissen, es, wenn auch mit dem Feinsinne des echten
Künstlers, in die ihm geläufigeren, entwickelteren Formen übertragen hat? Unsere Bronze kann bis zu
einem gewissen Grade veranschaulichen, was diesem Prozesse der Umbildung unterzogen wurde.
Wer konnte aber diese Statuen gemacht haben? Man denkt zunächst an Kaiamis, der, ehe sich
Phidias' Genie voll entfaltete, die attische Kunst wie kein zweiter neben ihm beherrscht hat und wie
kein zweiter berufen war, die gestürzten Götterbilder von Eleusis wieder zu errichten. Und wenn sich
auch aus so wenigen Indicien keine überzeugenden Folgerungen ergeben, so ist doch nicht zu ver-
kennen, dass die Figur mit dem Zepter auf dem Reliefe gleichwie die bronzene Statuette von der
1 IIpoKTixi 1% *v 'AOrjvats ctpxaioXoyixrjs kaipia; 1884, S. 81 f.
2 Jahn, aus der Alterthumswissenschaft, S. 23o f. Overbeck, Kunstmythologie, Bd. III, S. 428.
Robert von Schneider.
Nacken mit einander gemein. Im Ganzen aber zeigt die Statuette der Figur des Reliefs gegenüber einen
entschieden älteren Stil, und zwar nicht nur in der Form des Kopfes und im Schnitte der mandelförmigen
Augen sondern vor allem in ihrem zugleich festen und engen Stande. Sie trennt das Spielbein nicht
vom Boden wie jene sondern tritt wie die archaischen Statuen mit ganzer Sohle auf und entfernt beide
Beine so wenig als möglich von einander. Drückt sich hierin ein inniger Zusammenhang mit echt alter-
thümlicher Kunstweise aus, so fehlt derselbe der Figur des eleusinischen Reliefs, die uns zwar den glei-
chen Typus aber ganz im Sinne des von Phidias geschaffenen Stiles vervollkommnet vorführt. Gehört
letztere demnach, wie nicht zu zweifeln, der Richtung und der Zeit dieses Meisters an, so stellt sich
unsere Statuette auf einer früheren Stufe der Entwicklung, wir dürfen sagen, als ein Erzeugniss der
unmittelbar der höchsten Blüthe vorhergehenden Zeit dar.
Dass das Vorbild, von dem ich in der Statuette eine verkleinerte aber getreue, auf dem Reliefe
eine um vieles freiere Copie erblicken möchte, nur in Eleusis gesucht werden darf, geht aus dem
Fundorte dieses letzteren hervor. Leider sind wir über die Tempel-
bilder dieser Cultstätte des Geheimnisses wegen, das sich an den
heiligen Ort knüpfte, durch antike Augenzeugen nicht unterrichtet.
Dagegen haben die Ausgrabungen, welche dort im Laufe des letzten
Jahrzehnts die archäologische Gesellschaft in Athen vornehmen
Hess, als eines ihrer wichtigsten Ergebnisse festgestellt, dass schon
vor der Bauthätigkeit, die Perikles in Eleusis entfaltet hat, das von den
Persern eingeäscherte Telesterion, wahrscheinlich unter Kimons
Verwaltung, wieder errichtet worden war.1 Da ferner die Feier
der Mysterien nach dem Siege über die Barbaren einen neuen Auf-
schwung genommen hatte, so ist es kaum anders denkbar, als dass
auch die im Brande zu Grunde gegangenen Tempelbilder so schnell
als möglich ersetzt worden sind, und später unter Perikles, während
dem Bauwerke selbst eine glänzende Metamorphose zu Theil wurde,
dürften sie wohl schon aus religiösen Gründen nicht wieder durch
neue ausgewechselt worden sein. Es ist eine alte, durch analoge
Beispiele athenischer Urkunden und Weihereliefs gestützte Ver-
muthung,2 dass der Meister des eleusinischen Reliefs zwei be-
stimmte Bilder wiedergegeben hat, und man pflegt den Unterschied
im Stile beider Gestalten auf diese Originale zurückzuführen,
welche weder von ein und derselben Hand noch genau aus der-
selben Zeit herrühren mochten. Vielleicht wird diese Annahme durch die Kenntniss unserer Statuette
berichtigt. Sie ist, wie wir gesehen haben, strenger und alterthümlicher als die ihr entsprechende Figur
des Reliefs, nähert sich dagegen in ihrer ungemein schlichten Art der jener gegenüberstehenden Figur
mit dem Zepter. Sollten sich deshalb die Verschiedenheiten beider Gestalten nicht einfach daraus ergeben
haben, dass der Bildhauer sich das eine mal genauer an das Original gehalten, das andere mal, von dem
Zuge der zu voller Freiheit erblühten Kunst fortgerissen, es, wenn auch mit dem Feinsinne des echten
Künstlers, in die ihm geläufigeren, entwickelteren Formen übertragen hat? Unsere Bronze kann bis zu
einem gewissen Grade veranschaulichen, was diesem Prozesse der Umbildung unterzogen wurde.
Wer konnte aber diese Statuen gemacht haben? Man denkt zunächst an Kaiamis, der, ehe sich
Phidias' Genie voll entfaltete, die attische Kunst wie kein zweiter neben ihm beherrscht hat und wie
kein zweiter berufen war, die gestürzten Götterbilder von Eleusis wieder zu errichten. Und wenn sich
auch aus so wenigen Indicien keine überzeugenden Folgerungen ergeben, so ist doch nicht zu ver-
kennen, dass die Figur mit dem Zepter auf dem Reliefe gleichwie die bronzene Statuette von der
1 IIpoKTixi 1% *v 'AOrjvats ctpxaioXoyixrjs kaipia; 1884, S. 81 f.
2 Jahn, aus der Alterthumswissenschaft, S. 23o f. Overbeck, Kunstmythologie, Bd. III, S. 428.