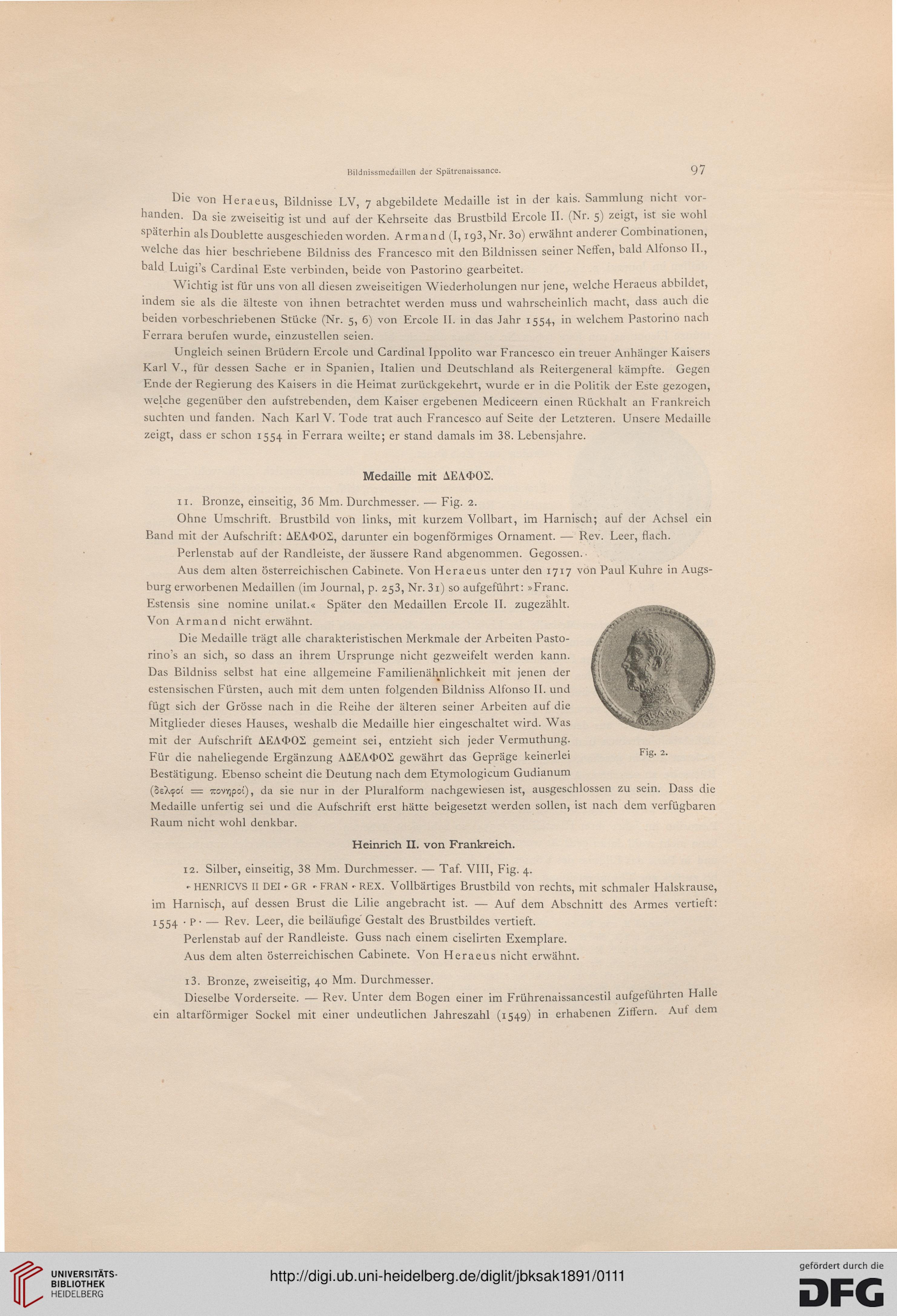Bildnissmeduillon der Spätrenaissancc.
97
Die von Heraeus, Bildnisse LV, 7 abgebildete Medaille ist in der kais. Sammlung nicht vor-
handen. Da sie zweiseitig ist und auf der Kehrseite das Brustbild Ercole II. (Nr. 5) zeigt, ist sie wohl
späterhin alsDoublette ausgeschieden worden. Armand (I, ig3,Nr.3o) erwähnt anderer Combinationen,
welche das hier beschriebene Bildniss des Francesco mit den Bildnissen seiner Neffen, bald Alfonso II.,
bald Luigi's Cardinal Este verbinden, beide von Pastorino gearbeitet.
Wichtig ist für uns von all diesen zweiseitigen Wiederholungen nur jene, welche Heraeus abbildet,
indem sie als die älteste von ihnen betrachtet werden muss und wahrscheinlich macht, dass auch die
beiden vorbeschriebenen Stücke (Nr. 5, 6) von Ercole II. in das Jahr 1554, in welchem Pastorino nach
Ferrara berufen wurde, einzustellen seien.
Ungleich seinen Brüdern Ercole und Cardinal Ippolito war Francesco ein treuer Anhänger Kaisers
Karl V., für dessen Sache er in Spanien, Italien und Deutschland als Reitergeneral kämpfte. Gegen
Ende der Regierung des Kaisers in die Heimat zurückgekehrt, wurde er in die Politik der Este gezogen,
welche gegenüber den aufstrebenden, dem Kaiser ergebenen Mediceern einen Rückhalt an Frankreich
suchten und fanden. Nach Karl V. Tode trat auch Francesco auf Seite der Letzteren. Unsere Medaille
zeigt, dass er schon 1554 in Ferrara weilte; er stand damals im 38. Lebensjahre.
Medaille mit AEA4>02.
11. Bronze, einseitig, 36 Mm. Durchmesser. — Fig. 2.
Ohne Umschrift. Brustbild von links, mit kurzem Vollbart, im Harnisch; auf der Achsel ein
Band mit der Aufschrift: AEA<I>02, darunter ein bogenförmiges Ornament. — Rev. Leer, flach.
Perlenstab auf der Randleiste, der äussere Rand abgenommen. Gegossen. ■
Aus dem alten österreichischen Cabinete. Von Heraeus unter den 1717 von Paul Kuhre in Augs-
burg erworbenen Medaillen (im Journal, p. 253, Nr. 3i) so aufgeführt: »Franc.
Estensis sine nomine unilat.« Später den Medaillen Ercole II. zugezählt.
Von Armand nicht erwähnt.
Die Medaille trägt alle charakteristischen Merkmale der Arbeiten Pasto-
rino's an sich, so dass an ihrem Ursprünge nicht gezweifelt werden kann.
Das Bildniss selbst hat eine allgemeine Familienähnlichkeit mit jenen der
estensischen Fürsten, auch mit dem unten folgenden Bildniss Alfonso II. und
fügt sich der Grösse nach in die Reihe der älteren seiner Arbeiten auf die
Mitglieder dieses Hauses, weshalb die Medaille hier eingeschaltet wird. Was
mit der Aufschrift AEA<1>02 gemeint sei, entzieht sich jeder Vermuthung.
Für die naheliegende Ergänzung AAEA<t>02 gewährt das Gepräge keinerlei
Bestätigung. Ebenso scheint die Deutung nach dem Etymologicum Gudianuni
(oeXipoi = TOvripo!), da sie nur in der Pluralform nachgewiesen ist, ausgeschlossen zu sein. Dass die
Medaille unfertig sei und die Aufschrift erst hätte beigesetzt werden sollen, ist nach dem verfügbaren
Raum nicht wohl denkbar.
Heinrich II. von Frankreich.
12. Silber, einseitig, 38 Mm. Durchmesser. — Taf. VIII, Fig. 4.
- HENRICVS II DEI - GR - FRAN - REX. Vollbärtiges Brustbild von rechts, mit schmaler Halskrause,
im Harnisch, auf dessen Brust die Lilie angebracht ist. — Auf dem Abschnitt des Armes vertieft:
1554 • P • — Rev. Leer, die beiläufige Gestalt des Brustbildes vertieft.
Perlenstab auf der Randleiste. Guss nach einem ciselirten Exemplare.
Aus dem alten österreichischen Cabinete. Von Heraeus nicht erwähnt.
13. Bronze, zweiseitig, 40 Mm. Durchmesser.
Dieselbe Vorderseite. — Rev. Unter dem Bogen einer im Frührenaissancestil aufgeführten Halle
ein altarförmiger Sockel mit einer undeutlichen Jahreszahl (1549) in erhabenen Ziffern. Auf dem
Fig. 2.
97
Die von Heraeus, Bildnisse LV, 7 abgebildete Medaille ist in der kais. Sammlung nicht vor-
handen. Da sie zweiseitig ist und auf der Kehrseite das Brustbild Ercole II. (Nr. 5) zeigt, ist sie wohl
späterhin alsDoublette ausgeschieden worden. Armand (I, ig3,Nr.3o) erwähnt anderer Combinationen,
welche das hier beschriebene Bildniss des Francesco mit den Bildnissen seiner Neffen, bald Alfonso II.,
bald Luigi's Cardinal Este verbinden, beide von Pastorino gearbeitet.
Wichtig ist für uns von all diesen zweiseitigen Wiederholungen nur jene, welche Heraeus abbildet,
indem sie als die älteste von ihnen betrachtet werden muss und wahrscheinlich macht, dass auch die
beiden vorbeschriebenen Stücke (Nr. 5, 6) von Ercole II. in das Jahr 1554, in welchem Pastorino nach
Ferrara berufen wurde, einzustellen seien.
Ungleich seinen Brüdern Ercole und Cardinal Ippolito war Francesco ein treuer Anhänger Kaisers
Karl V., für dessen Sache er in Spanien, Italien und Deutschland als Reitergeneral kämpfte. Gegen
Ende der Regierung des Kaisers in die Heimat zurückgekehrt, wurde er in die Politik der Este gezogen,
welche gegenüber den aufstrebenden, dem Kaiser ergebenen Mediceern einen Rückhalt an Frankreich
suchten und fanden. Nach Karl V. Tode trat auch Francesco auf Seite der Letzteren. Unsere Medaille
zeigt, dass er schon 1554 in Ferrara weilte; er stand damals im 38. Lebensjahre.
Medaille mit AEA4>02.
11. Bronze, einseitig, 36 Mm. Durchmesser. — Fig. 2.
Ohne Umschrift. Brustbild von links, mit kurzem Vollbart, im Harnisch; auf der Achsel ein
Band mit der Aufschrift: AEA<I>02, darunter ein bogenförmiges Ornament. — Rev. Leer, flach.
Perlenstab auf der Randleiste, der äussere Rand abgenommen. Gegossen. ■
Aus dem alten österreichischen Cabinete. Von Heraeus unter den 1717 von Paul Kuhre in Augs-
burg erworbenen Medaillen (im Journal, p. 253, Nr. 3i) so aufgeführt: »Franc.
Estensis sine nomine unilat.« Später den Medaillen Ercole II. zugezählt.
Von Armand nicht erwähnt.
Die Medaille trägt alle charakteristischen Merkmale der Arbeiten Pasto-
rino's an sich, so dass an ihrem Ursprünge nicht gezweifelt werden kann.
Das Bildniss selbst hat eine allgemeine Familienähnlichkeit mit jenen der
estensischen Fürsten, auch mit dem unten folgenden Bildniss Alfonso II. und
fügt sich der Grösse nach in die Reihe der älteren seiner Arbeiten auf die
Mitglieder dieses Hauses, weshalb die Medaille hier eingeschaltet wird. Was
mit der Aufschrift AEA<1>02 gemeint sei, entzieht sich jeder Vermuthung.
Für die naheliegende Ergänzung AAEA<t>02 gewährt das Gepräge keinerlei
Bestätigung. Ebenso scheint die Deutung nach dem Etymologicum Gudianuni
(oeXipoi = TOvripo!), da sie nur in der Pluralform nachgewiesen ist, ausgeschlossen zu sein. Dass die
Medaille unfertig sei und die Aufschrift erst hätte beigesetzt werden sollen, ist nach dem verfügbaren
Raum nicht wohl denkbar.
Heinrich II. von Frankreich.
12. Silber, einseitig, 38 Mm. Durchmesser. — Taf. VIII, Fig. 4.
- HENRICVS II DEI - GR - FRAN - REX. Vollbärtiges Brustbild von rechts, mit schmaler Halskrause,
im Harnisch, auf dessen Brust die Lilie angebracht ist. — Auf dem Abschnitt des Armes vertieft:
1554 • P • — Rev. Leer, die beiläufige Gestalt des Brustbildes vertieft.
Perlenstab auf der Randleiste. Guss nach einem ciselirten Exemplare.
Aus dem alten österreichischen Cabinete. Von Heraeus nicht erwähnt.
13. Bronze, zweiseitig, 40 Mm. Durchmesser.
Dieselbe Vorderseite. — Rev. Unter dem Bogen einer im Frührenaissancestil aufgeführten Halle
ein altarförmiger Sockel mit einer undeutlichen Jahreszahl (1549) in erhabenen Ziffern. Auf dem
Fig. 2.