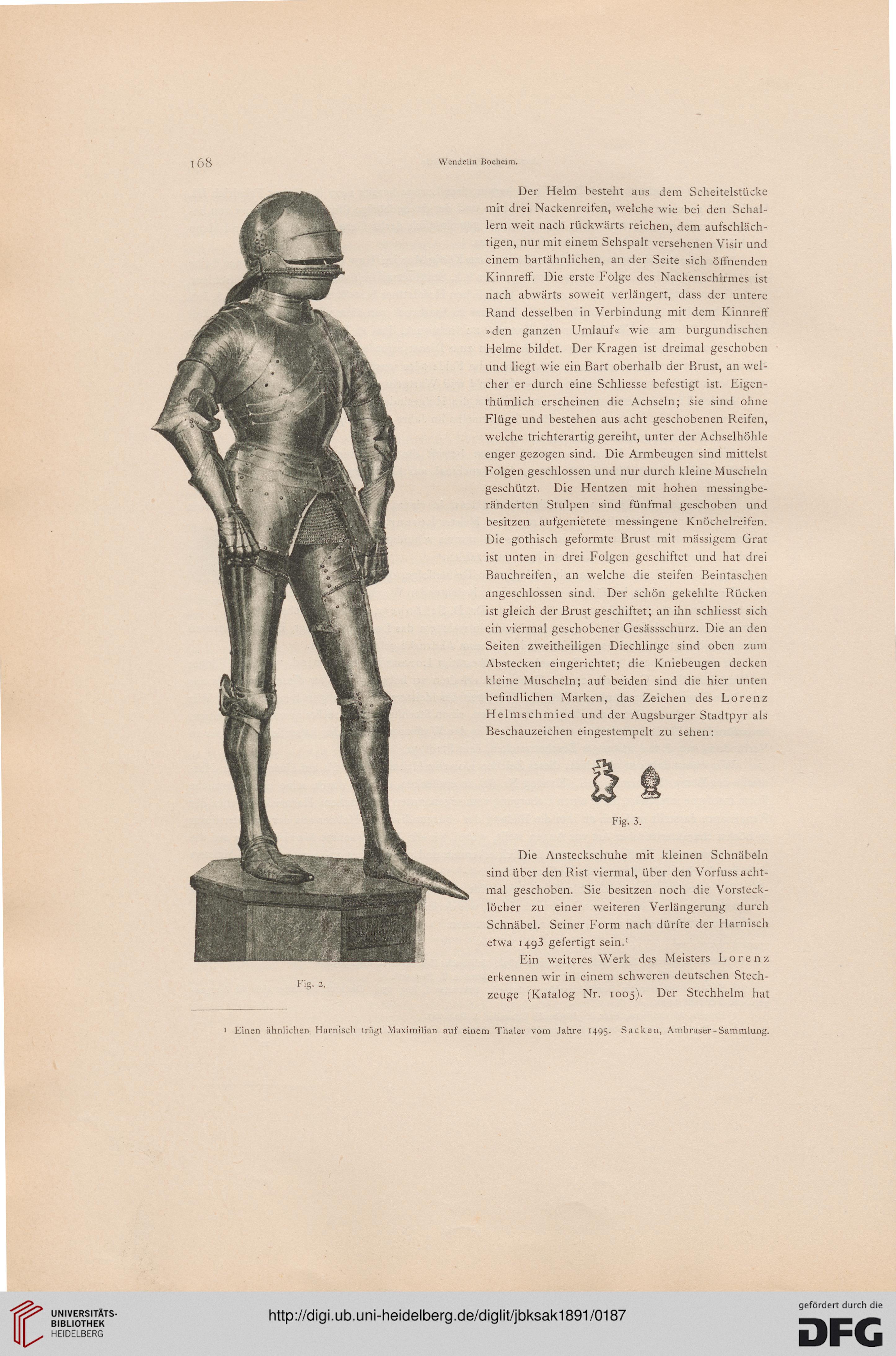i68
Wendeln] liocheim.
Der Helm besteht aus dem Seheitelstücke
mit drei Nackenreifen, welche wie bei den Schal-
lern weit nach rückwärts reichen, dem aufschläch-
tigen, nur mit einem Sehspalt versehenen Visir und
einem bartähnlichen, an der Seite sich öffnenden
Kinnreff. Die erste Folge des Nackenschirmes ist
nach abwärts soweit verlängert, dass der untere
Rand desselben in Verbindung mit dem Kinnreff
»den ganzen Umlauf« wie am burgundischen
Helme bildet. Der Kragen ist dreimal geschoben
und liegt wie ein Bart oberhalb der Brust, an wel-
cher er durch eine Schliesse befestigt ist. Eigen-
thümlich erscheinen die Achseln; sie sind ohne
Flüge und bestehen aus acht geschobenen Reifen,
welche trichterartig gereiht, unter der Achselhöhle
enger gezogen sind. Die Armbeugen sind mittelst
Folgen geschlossen und nur durch kleine Muscheln
geschützt. Die Hentzen mit hohen messingbe-
ränderten Stulpen sind fünfmal geschoben und
besitzen aufgenietete messingene Knöchelreifen.
Die gothisch geformte Brust mit mässigem Grat
ist unten in drei Folgen geschiftet und hat drei
Bauchreifen, an welche die steifen Beintaschen
angeschlossen sind. Der schön gekehlte Rücken
ist gleich der Brust geschiftet; an ihn schliesst sich
ein viermal geschobener Gesässschurz. Die an den
Seiten zweitheiligen Diechlinge sind oben zum
Abstecken eingerichtet; die Kniebeugen decken
kleine Muscheln; auf beiden sind die hier unten
befindlichen Marken, das Zeichen des Lorenz
Helmschmied und der Augsburger Stadtpyr als
Beschauzeichen eingestempelt zu sehen:
Fig. 2.
Hg. 3.
Die Ansteckschuhe mit kleinen Schnäbeln
sind über den Rist viermal, über den Vorfuss acht-
mal geschoben. Sie besitzen noch die Vorsteck-
löcher zu einer weiteren Verlängerung durch
Schnäbel. Seiner Form nach dürfte der Harnisch
etwa 1493 gefertigt sein.'
Ein weiteres Werk des Meisters Lorenz
erkennen wir in einem schweren deutschen Stech-
zeuge (Katalog Nr. 1005). Der Stechhelm hat
1 Einen ähnlichen Harnisch trügt Maximilian auf einem Thaler vom Jahre 1495. Sacken, Ambraser-Sammlung.
Wendeln] liocheim.
Der Helm besteht aus dem Seheitelstücke
mit drei Nackenreifen, welche wie bei den Schal-
lern weit nach rückwärts reichen, dem aufschläch-
tigen, nur mit einem Sehspalt versehenen Visir und
einem bartähnlichen, an der Seite sich öffnenden
Kinnreff. Die erste Folge des Nackenschirmes ist
nach abwärts soweit verlängert, dass der untere
Rand desselben in Verbindung mit dem Kinnreff
»den ganzen Umlauf« wie am burgundischen
Helme bildet. Der Kragen ist dreimal geschoben
und liegt wie ein Bart oberhalb der Brust, an wel-
cher er durch eine Schliesse befestigt ist. Eigen-
thümlich erscheinen die Achseln; sie sind ohne
Flüge und bestehen aus acht geschobenen Reifen,
welche trichterartig gereiht, unter der Achselhöhle
enger gezogen sind. Die Armbeugen sind mittelst
Folgen geschlossen und nur durch kleine Muscheln
geschützt. Die Hentzen mit hohen messingbe-
ränderten Stulpen sind fünfmal geschoben und
besitzen aufgenietete messingene Knöchelreifen.
Die gothisch geformte Brust mit mässigem Grat
ist unten in drei Folgen geschiftet und hat drei
Bauchreifen, an welche die steifen Beintaschen
angeschlossen sind. Der schön gekehlte Rücken
ist gleich der Brust geschiftet; an ihn schliesst sich
ein viermal geschobener Gesässschurz. Die an den
Seiten zweitheiligen Diechlinge sind oben zum
Abstecken eingerichtet; die Kniebeugen decken
kleine Muscheln; auf beiden sind die hier unten
befindlichen Marken, das Zeichen des Lorenz
Helmschmied und der Augsburger Stadtpyr als
Beschauzeichen eingestempelt zu sehen:
Fig. 2.
Hg. 3.
Die Ansteckschuhe mit kleinen Schnäbeln
sind über den Rist viermal, über den Vorfuss acht-
mal geschoben. Sie besitzen noch die Vorsteck-
löcher zu einer weiteren Verlängerung durch
Schnäbel. Seiner Form nach dürfte der Harnisch
etwa 1493 gefertigt sein.'
Ein weiteres Werk des Meisters Lorenz
erkennen wir in einem schweren deutschen Stech-
zeuge (Katalog Nr. 1005). Der Stechhelm hat
1 Einen ähnlichen Harnisch trügt Maximilian auf einem Thaler vom Jahre 1495. Sacken, Ambraser-Sammlung.