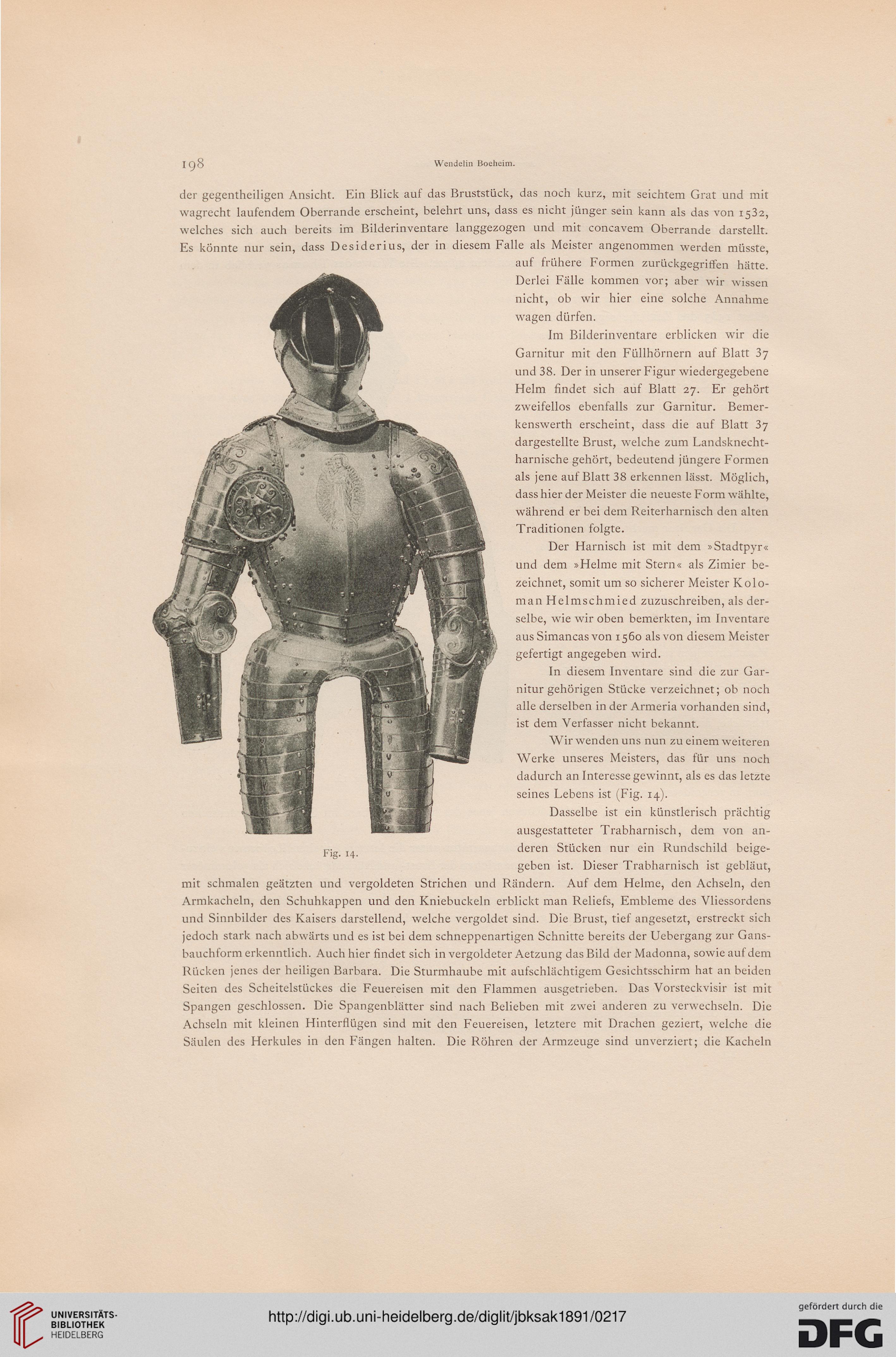Wendelin Boeheim.
der gegentheiligen Ansicht. Ein Blick auf das Bruststück, das noch kurz, mit seichtem Grat und mit
wagrecht laufendem Oberrande erscheint, belehrt uns, dass es nicht jünger sein kann als das von 1532,
welches sich auch bereits im Bilderinventare langgezogen und mit concavem Oberrande darstellt.
Es könnte nur sein, dass Desiderius, der in diesem Falle als Meister angenommen werden müsste,
auf frühere Formen zurückgegriffen hätte.
Derlei Fülle kommen vor; aber wir wissen
nicht, ob wir hier eine solche Annahme
wagen dürfen.
Im Bilderinventare erblicken wir die
Garnitur mit den Füllhörnern auf Blatt 37
und 38. Der in unserer Figur wiedergegebene
Helm findet sich auf Blatt 27. Er gehört
zweifellos ebenfalls zur Garnitur. Bemer-
kenswerth erscheint, dass die auf Blatt 37
dargestellte Brust, welche zum Landsknecht-
harnische gehört, bedeutend jüngere Formen
als jene auf Blatt 38 erkennen lässt. Möglich,
dass hier der Meister die neueste Form wählte,
während er bei dem Reiterharnisch den alten
Traditionen folgte.
Der Harnisch ist mit dem »Stadtpyr«
und dem »Helme mit Stern« als Zimier be-
zeichnet, somit um so sicherer Meister Kolo-
man Helmschmied zuzuschreiben, als der-
selbe, wie wir oben bemerkten, im Inventare
aus Simancas von 1560 als von diesem Meister
gefertigt angegeben wird.
In diesem Inventare sind die zur Gar-
nitur gehörigen Stücke verzeichnet; ob noch
alle derselben in der Armeria vorhanden sind,
ist dem Verfasser nicht bekannt.
Wir wenden uns nun zu einem weiteren
Werke unseres Meisters, das für uns noch
dadurch an Interesse gewinnt, als es das letzte
seines Lebens ist (Fig. 14).
Dasselbe ist ein künstlerisch prächtig
ausgestatteter Trabharnisch, dem von an-
deren Stücken nur ein Rundschild beige-
geben ist. Dieser Trabharnisch ist gebläut,
mit schmalen geätzten und vergoldeten Strichen und Rändern. Auf dem Helme, den Achseln, den
Armkacheln, den Schuhkappen und den Kniebuckeln erblickt man Reliefs, Embleme des Vliessordens
und Sinnbilder des Kaisers darstellend, welche vergoldet sind. Die Brust, tief angesetzt, erstreckt sich
jedoch stark nach abwärts und es ist bei dem schneppenartigen Schnitte bereits der Uebergang zur Gans-
bauchform erkenntlich. Auch hier findet sich in vergoldeter Aetzung das Bild der Madonna, sowie auf dem
Rücken jenes der heiligen Barbara. Die Sturmhaube mit aufschlächtigem Gesichtsschirm hat an beiden
Seiten des Scheitelstückes die Feuereisen mit den Flammen ausgetrieben. Das Vorsteckvisir ist mit
Spangen geschlossen. Die Spangenblätter sind nach Belieben mit zwei anderen zu verwechseln. Die
Achseln mit kleinen Hinterflügen sind mit den Feuereisen, letztere mit Drachen geziert, welche die
Säulen des Herkules in den Fängen halten. Die Röhren der Armzeuge sind unverziert; die Kacheln
Fig. 14.
der gegentheiligen Ansicht. Ein Blick auf das Bruststück, das noch kurz, mit seichtem Grat und mit
wagrecht laufendem Oberrande erscheint, belehrt uns, dass es nicht jünger sein kann als das von 1532,
welches sich auch bereits im Bilderinventare langgezogen und mit concavem Oberrande darstellt.
Es könnte nur sein, dass Desiderius, der in diesem Falle als Meister angenommen werden müsste,
auf frühere Formen zurückgegriffen hätte.
Derlei Fülle kommen vor; aber wir wissen
nicht, ob wir hier eine solche Annahme
wagen dürfen.
Im Bilderinventare erblicken wir die
Garnitur mit den Füllhörnern auf Blatt 37
und 38. Der in unserer Figur wiedergegebene
Helm findet sich auf Blatt 27. Er gehört
zweifellos ebenfalls zur Garnitur. Bemer-
kenswerth erscheint, dass die auf Blatt 37
dargestellte Brust, welche zum Landsknecht-
harnische gehört, bedeutend jüngere Formen
als jene auf Blatt 38 erkennen lässt. Möglich,
dass hier der Meister die neueste Form wählte,
während er bei dem Reiterharnisch den alten
Traditionen folgte.
Der Harnisch ist mit dem »Stadtpyr«
und dem »Helme mit Stern« als Zimier be-
zeichnet, somit um so sicherer Meister Kolo-
man Helmschmied zuzuschreiben, als der-
selbe, wie wir oben bemerkten, im Inventare
aus Simancas von 1560 als von diesem Meister
gefertigt angegeben wird.
In diesem Inventare sind die zur Gar-
nitur gehörigen Stücke verzeichnet; ob noch
alle derselben in der Armeria vorhanden sind,
ist dem Verfasser nicht bekannt.
Wir wenden uns nun zu einem weiteren
Werke unseres Meisters, das für uns noch
dadurch an Interesse gewinnt, als es das letzte
seines Lebens ist (Fig. 14).
Dasselbe ist ein künstlerisch prächtig
ausgestatteter Trabharnisch, dem von an-
deren Stücken nur ein Rundschild beige-
geben ist. Dieser Trabharnisch ist gebläut,
mit schmalen geätzten und vergoldeten Strichen und Rändern. Auf dem Helme, den Achseln, den
Armkacheln, den Schuhkappen und den Kniebuckeln erblickt man Reliefs, Embleme des Vliessordens
und Sinnbilder des Kaisers darstellend, welche vergoldet sind. Die Brust, tief angesetzt, erstreckt sich
jedoch stark nach abwärts und es ist bei dem schneppenartigen Schnitte bereits der Uebergang zur Gans-
bauchform erkenntlich. Auch hier findet sich in vergoldeter Aetzung das Bild der Madonna, sowie auf dem
Rücken jenes der heiligen Barbara. Die Sturmhaube mit aufschlächtigem Gesichtsschirm hat an beiden
Seiten des Scheitelstückes die Feuereisen mit den Flammen ausgetrieben. Das Vorsteckvisir ist mit
Spangen geschlossen. Die Spangenblätter sind nach Belieben mit zwei anderen zu verwechseln. Die
Achseln mit kleinen Hinterflügen sind mit den Feuereisen, letztere mit Drachen geziert, welche die
Säulen des Herkules in den Fängen halten. Die Röhren der Armzeuge sind unverziert; die Kacheln
Fig. 14.