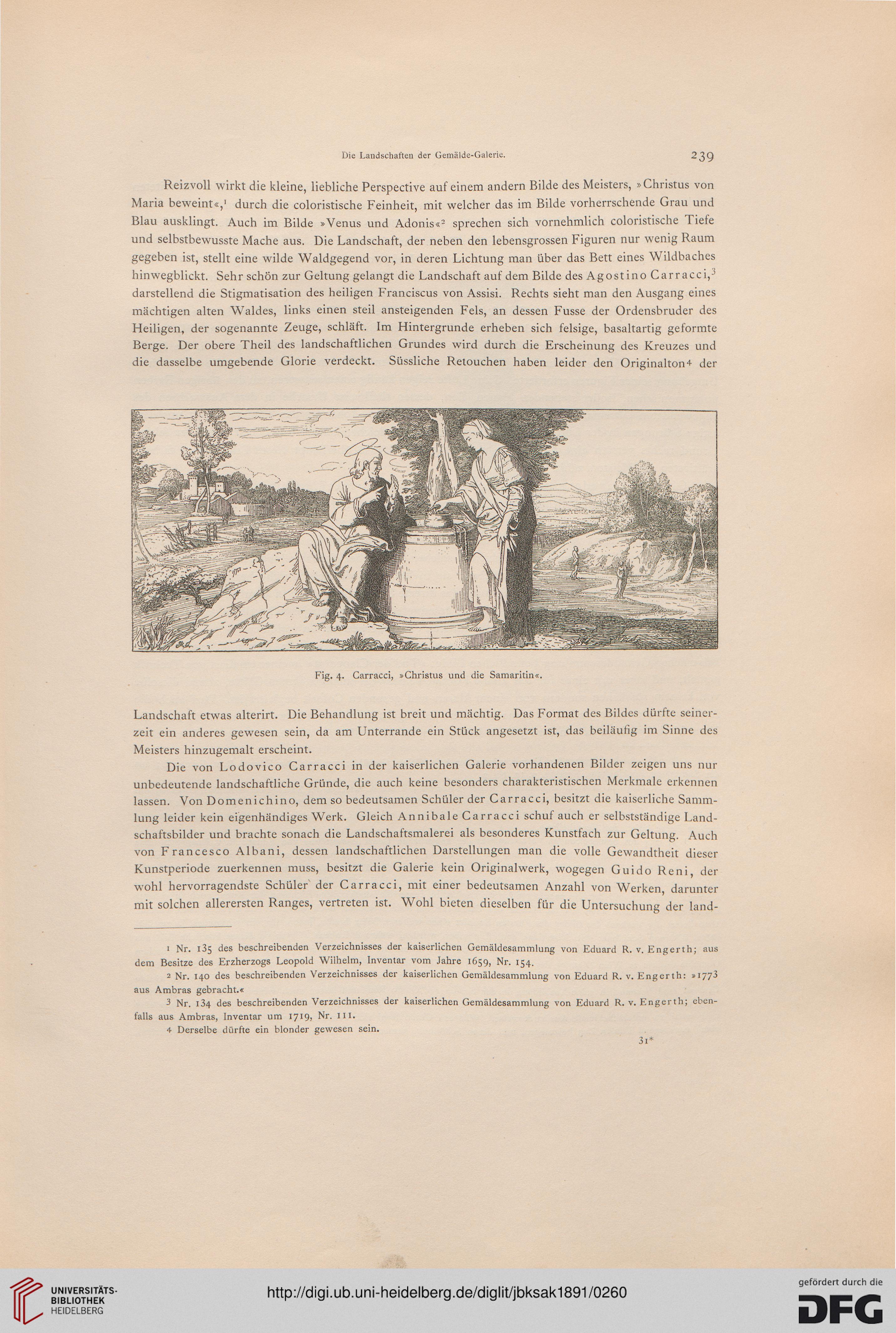Die Landschaften der Gemälde-Galerie.
239
Reizvoll wirkt die kleine, liebliche Perspective auf einem andern Bilde des Meisters, »Christus von
Maria beweint«,' durch die coloristische Feinheit, mit welcher das im Bilde vorherrschende Grau und
Blau ausklingt. Auch im Bilde »Venus und Adonis«2 sprechen sich vornehmlich coloristische Tiefe
und selbstbewusste Mache aus. Die Landschaft, der neben den lebensgrossen Figuren nur wenig Raum
gegeben ist, stellt eine wilde Waldgegend vor, in deren Lichtung man über das Bett eines Wildbaches
hinwegblickt. Sehr schön zur Geltung gelangt die Landschaft auf dem Bilde des Agostino Carracci,-'
darstellend die Stigmatisation des heiligen Franciscus von Assisi. Rechts sieht man den Ausgang eines
mächtigen alten Waldes, links einen steil ansteigenden Fels, an dessen Fusse der Ordensbruder des
Heiligen, der sogenannte Zeuge, schläft. Im Hintergrunde erheben sich felsige, basaltartig geformte
Berge. Der obere Theil des landschaftlichen Grundes wird durch die Erscheinung des Kreuzes und
die dasselbe umgebende Glorie verdeckt. Süssliche Retouchen haben leider den Originalton* der
Fig. 4. Carracci, »Christus und die Samaritin«.
Landschaft etwas alterirt. Die Behandlung ist breit und mächtig. Das Format des Bildes dürfte seiner-
zeit ein anderes gewesen sein, da am Unterrande ein Stück angesetzt ist, das beiläufig im Sinne des
Meisters hinzugemalt erscheint.
Die von Lodovico Carracci in der kaiserlichen Galerie vorhandenen Bilder zeigen uns nur
unbedeutende landschaftliche Gründe, die auch keine besonders charakteristischen Merkmale erkennen
lassen. Von Domenichino, dem so bedeutsamen Schüler der Carracci, besitzt die kaiserliche Samm-
lung leider kein eigenhändiges Werk. Gleich Annibale Carracci schuf auch er selbstständige Land-
schaftsbilder und brachte sonach die Landschaftsmalerei als besonderes Kunstfach zur Geltung. Auch
von Francesco Albani, dessen landschaftlichen Darstellungen man die volle Gewandtheit dieser
Kunstperiode zuerkennen muss, besitzt die Galerie kein Originalwerk, wogegen Guido Reni, der
wohl hervorragendste Schüler der Carracci, mit einer bedeutsamen Anzahl von Werken, darunter
mit solchen allerersten Ranges, vertreten ist. Wohl bieten dieselben für die Untersuchung der land-
1 Nr. l35 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; aus
dem Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm, Inventar vom Jahre 1659, Nr. 154.
2 Nr. 140 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1773
aus Ambras gebracht.«
3 Nr. 134 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; eben-
falls aus Ambras, Inventar um 1719, Nr. III.
4 Derselbe dürfte ein blonder gewesen sein.
3i*
239
Reizvoll wirkt die kleine, liebliche Perspective auf einem andern Bilde des Meisters, »Christus von
Maria beweint«,' durch die coloristische Feinheit, mit welcher das im Bilde vorherrschende Grau und
Blau ausklingt. Auch im Bilde »Venus und Adonis«2 sprechen sich vornehmlich coloristische Tiefe
und selbstbewusste Mache aus. Die Landschaft, der neben den lebensgrossen Figuren nur wenig Raum
gegeben ist, stellt eine wilde Waldgegend vor, in deren Lichtung man über das Bett eines Wildbaches
hinwegblickt. Sehr schön zur Geltung gelangt die Landschaft auf dem Bilde des Agostino Carracci,-'
darstellend die Stigmatisation des heiligen Franciscus von Assisi. Rechts sieht man den Ausgang eines
mächtigen alten Waldes, links einen steil ansteigenden Fels, an dessen Fusse der Ordensbruder des
Heiligen, der sogenannte Zeuge, schläft. Im Hintergrunde erheben sich felsige, basaltartig geformte
Berge. Der obere Theil des landschaftlichen Grundes wird durch die Erscheinung des Kreuzes und
die dasselbe umgebende Glorie verdeckt. Süssliche Retouchen haben leider den Originalton* der
Fig. 4. Carracci, »Christus und die Samaritin«.
Landschaft etwas alterirt. Die Behandlung ist breit und mächtig. Das Format des Bildes dürfte seiner-
zeit ein anderes gewesen sein, da am Unterrande ein Stück angesetzt ist, das beiläufig im Sinne des
Meisters hinzugemalt erscheint.
Die von Lodovico Carracci in der kaiserlichen Galerie vorhandenen Bilder zeigen uns nur
unbedeutende landschaftliche Gründe, die auch keine besonders charakteristischen Merkmale erkennen
lassen. Von Domenichino, dem so bedeutsamen Schüler der Carracci, besitzt die kaiserliche Samm-
lung leider kein eigenhändiges Werk. Gleich Annibale Carracci schuf auch er selbstständige Land-
schaftsbilder und brachte sonach die Landschaftsmalerei als besonderes Kunstfach zur Geltung. Auch
von Francesco Albani, dessen landschaftlichen Darstellungen man die volle Gewandtheit dieser
Kunstperiode zuerkennen muss, besitzt die Galerie kein Originalwerk, wogegen Guido Reni, der
wohl hervorragendste Schüler der Carracci, mit einer bedeutsamen Anzahl von Werken, darunter
mit solchen allerersten Ranges, vertreten ist. Wohl bieten dieselben für die Untersuchung der land-
1 Nr. l35 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; aus
dem Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm, Inventar vom Jahre 1659, Nr. 154.
2 Nr. 140 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth: »1773
aus Ambras gebracht.«
3 Nr. 134 des beschreibenden Verzeichnisses der kaiserlichen Gemäldesammlung von Eduard R. v. Engerth; eben-
falls aus Ambras, Inventar um 1719, Nr. III.
4 Derselbe dürfte ein blonder gewesen sein.
3i*