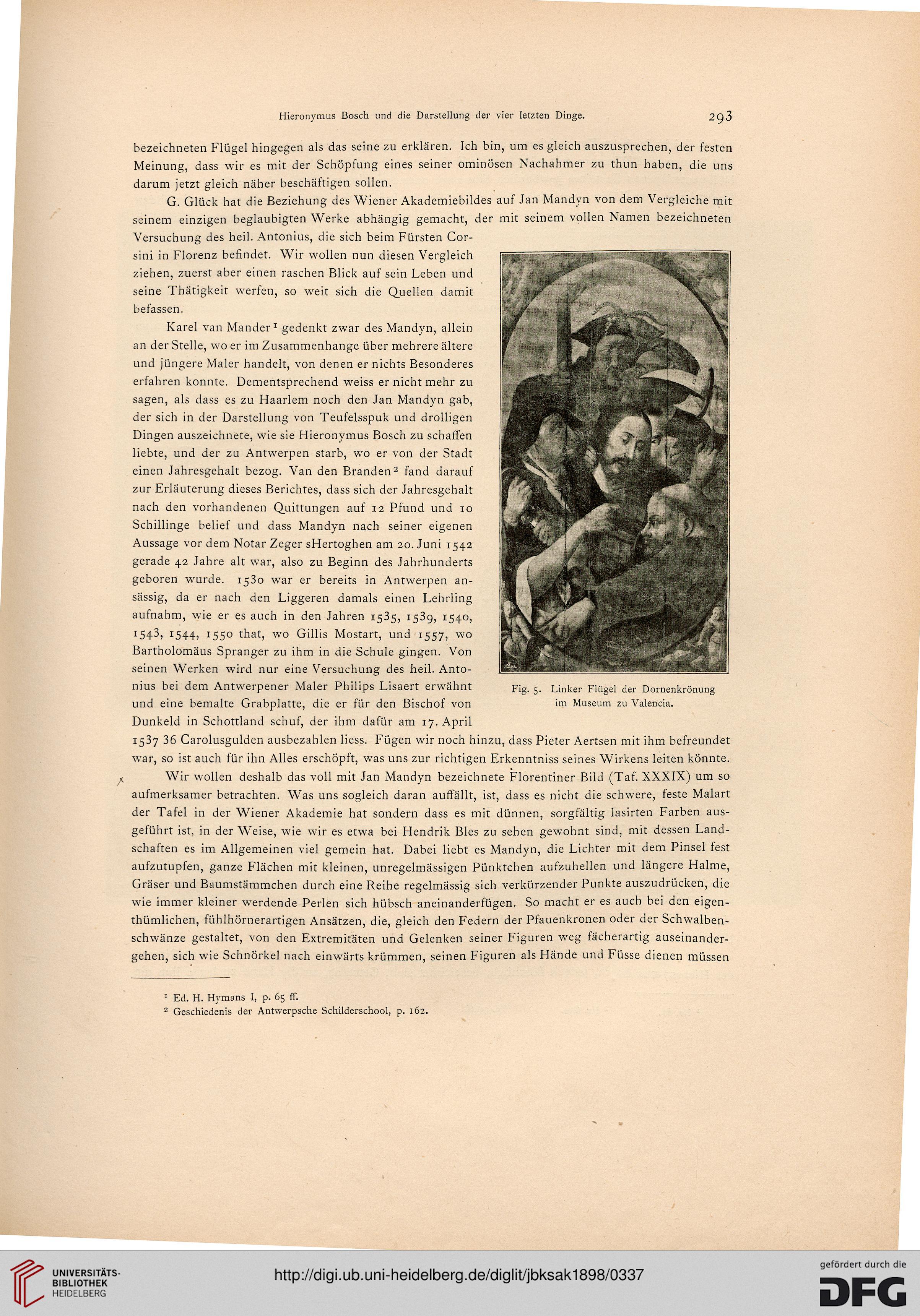Hieronymus Bosch und die Darstellung der vier letzten Dinge.
293
bezeichneten Flügel hingegen als das seine zu erklären. Ich bin, um es gleich auszusprechen, der festen
Meinung, dass wir es mit der Schöpfung eines seiner ominösen Nachahmer zu thun haben, die uns
darum jetzt gleich näher beschäftigen sollen.
G. Glück hat die Beziehung des Wiener Akademiebildes auf Jan Mandyn von dem Vergleiche mit
seinem einzigen beglaubigten Werke abhängig gemacht, der mit seinem vollen Namen bezeichneten
Versuchung des heil. Antonius, die sich beim Fürsten Cor-
sini in Florenz befindet. Wir wollen nun diesen Vergleich
ziehen, zuerst aber einen raschen Blick auf sein Leben und
seine Thätigkeit werfen, so weit sich die Quellen damit
befassen.
Karel van Mander1 gedenkt zwar des Mandyn, allein
an der Stelle, wo er im Zusammenhange über mehrere ältere
und jüngere Maler handelt, von denen er nichts Besonderes
erfahren konnte. Dementsprechend weiss er nicht mehr zu
sagen, ab dass es zu Haarlem noch den Jan Mandyn gab,
der sich in der Darstellung von Teufelsspuk und drolligen
Dingen auszeichnete, wie sie Hieronymus Bosch zu schaffen
liebte, und der zu Antwerpen starb, wo er von der Stadt
einen Jahresgehalt bezog. Van den Branden2 fand darauf
zur Erläuterung dieses Berichtes, dass sich der Jahresgehalt
nach den vorhandenen Quittungen auf 12 Pfund und 10
Schillinge belief und dass Mandyn nach seiner eigenen
Aussage vor dem Notar Zeger sHertoghen am 20. Juni 1542
gerade 42 Jahre alt war, also zu Beginn des Jahrhunderts
geboren wurde. 1530 war er bereits in Antwerpen an-
sässig, da er nach den Liggeren damals einen Lehrling
aufnahm, wie er es auch in den Jahren 1535, 153g, 1540,
1543, 1544, 1550 that, wo Gillis Mostart, und 1557, wo
Bartholomäus Spranger zu ihm in die Schule gingen. Von
seinen Werken wird nur eine Versuchung des heil. Anto-
nius bei dem Antwerpener Maler Philips Lisaert erwähnt pjg. 5. Linker Flügel der Dornenkrönung
und eine bemalte Grabplatte, die er für den Bischof von im Museum zu Valencia.
Dunkeid in Schottland schuf, der ihm dafür am 17. April
1537 36 Carolusgulden ausbezahlen Hess. Fügen wir noch hinzu, dass Pieter Aertsen mit ihm befreundet
war, so ist auch für ihn Alles erschöpft, was uns zur richtigen Erkenntniss seines Wirkens leiten könnte.
Wir wollen deshalb das voll mit Jan Mandyn bezeichnete Florentiner Bild (Taf. XXXIX) um so
aufmerksamer betrachten. Was uns sogleich daran auffällt, ist, dass es nicht die schwere, feste Malart
der Tafel in der Wiener Akademie hat sondern dass es mit dünnen, sorgfältig lasirten Farben aus-
geführt ist, in der Weise, wie wir es etwa bei Hendrik Bles zu sehen gewohnt sind, mit dessen Land-
schaften es im Allgemeinen viel gemein hat. Dabei liebt es Mandyn, die Lichter mit dem Pinsel fest
aufzutupfen, ganze Flächen mit kleinen, unregelmässigen Pünktchen aufzuhellen und längere Halme,
Gräser und Baumstämmchen durch eine Reihe regelmässig sich verkürzender Punkte auszudrücken, die
wie immer kleiner werdende Perlen sich hübsch aneinanderfügen. So macht er es auch bei den eigen-
thümlichen, fühlhörnerartigen Ansätzen, die, gleich den Federn der Pfauenkronen oder der Schwalben-
schwänze gestaltet, von den Extremitäten und Gelenken seiner Figuren weg fächerartig auseinander-
gehen, sich wie Schnörkel nach einwärts krümmen, seinen Figuren als Hände und Füsse dienen müssen
1 Ed. H. Hymans I, p. 65 ff.
2 Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, p. 162.
293
bezeichneten Flügel hingegen als das seine zu erklären. Ich bin, um es gleich auszusprechen, der festen
Meinung, dass wir es mit der Schöpfung eines seiner ominösen Nachahmer zu thun haben, die uns
darum jetzt gleich näher beschäftigen sollen.
G. Glück hat die Beziehung des Wiener Akademiebildes auf Jan Mandyn von dem Vergleiche mit
seinem einzigen beglaubigten Werke abhängig gemacht, der mit seinem vollen Namen bezeichneten
Versuchung des heil. Antonius, die sich beim Fürsten Cor-
sini in Florenz befindet. Wir wollen nun diesen Vergleich
ziehen, zuerst aber einen raschen Blick auf sein Leben und
seine Thätigkeit werfen, so weit sich die Quellen damit
befassen.
Karel van Mander1 gedenkt zwar des Mandyn, allein
an der Stelle, wo er im Zusammenhange über mehrere ältere
und jüngere Maler handelt, von denen er nichts Besonderes
erfahren konnte. Dementsprechend weiss er nicht mehr zu
sagen, ab dass es zu Haarlem noch den Jan Mandyn gab,
der sich in der Darstellung von Teufelsspuk und drolligen
Dingen auszeichnete, wie sie Hieronymus Bosch zu schaffen
liebte, und der zu Antwerpen starb, wo er von der Stadt
einen Jahresgehalt bezog. Van den Branden2 fand darauf
zur Erläuterung dieses Berichtes, dass sich der Jahresgehalt
nach den vorhandenen Quittungen auf 12 Pfund und 10
Schillinge belief und dass Mandyn nach seiner eigenen
Aussage vor dem Notar Zeger sHertoghen am 20. Juni 1542
gerade 42 Jahre alt war, also zu Beginn des Jahrhunderts
geboren wurde. 1530 war er bereits in Antwerpen an-
sässig, da er nach den Liggeren damals einen Lehrling
aufnahm, wie er es auch in den Jahren 1535, 153g, 1540,
1543, 1544, 1550 that, wo Gillis Mostart, und 1557, wo
Bartholomäus Spranger zu ihm in die Schule gingen. Von
seinen Werken wird nur eine Versuchung des heil. Anto-
nius bei dem Antwerpener Maler Philips Lisaert erwähnt pjg. 5. Linker Flügel der Dornenkrönung
und eine bemalte Grabplatte, die er für den Bischof von im Museum zu Valencia.
Dunkeid in Schottland schuf, der ihm dafür am 17. April
1537 36 Carolusgulden ausbezahlen Hess. Fügen wir noch hinzu, dass Pieter Aertsen mit ihm befreundet
war, so ist auch für ihn Alles erschöpft, was uns zur richtigen Erkenntniss seines Wirkens leiten könnte.
Wir wollen deshalb das voll mit Jan Mandyn bezeichnete Florentiner Bild (Taf. XXXIX) um so
aufmerksamer betrachten. Was uns sogleich daran auffällt, ist, dass es nicht die schwere, feste Malart
der Tafel in der Wiener Akademie hat sondern dass es mit dünnen, sorgfältig lasirten Farben aus-
geführt ist, in der Weise, wie wir es etwa bei Hendrik Bles zu sehen gewohnt sind, mit dessen Land-
schaften es im Allgemeinen viel gemein hat. Dabei liebt es Mandyn, die Lichter mit dem Pinsel fest
aufzutupfen, ganze Flächen mit kleinen, unregelmässigen Pünktchen aufzuhellen und längere Halme,
Gräser und Baumstämmchen durch eine Reihe regelmässig sich verkürzender Punkte auszudrücken, die
wie immer kleiner werdende Perlen sich hübsch aneinanderfügen. So macht er es auch bei den eigen-
thümlichen, fühlhörnerartigen Ansätzen, die, gleich den Federn der Pfauenkronen oder der Schwalben-
schwänze gestaltet, von den Extremitäten und Gelenken seiner Figuren weg fächerartig auseinander-
gehen, sich wie Schnörkel nach einwärts krümmen, seinen Figuren als Hände und Füsse dienen müssen
1 Ed. H. Hymans I, p. 65 ff.
2 Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, p. 162.