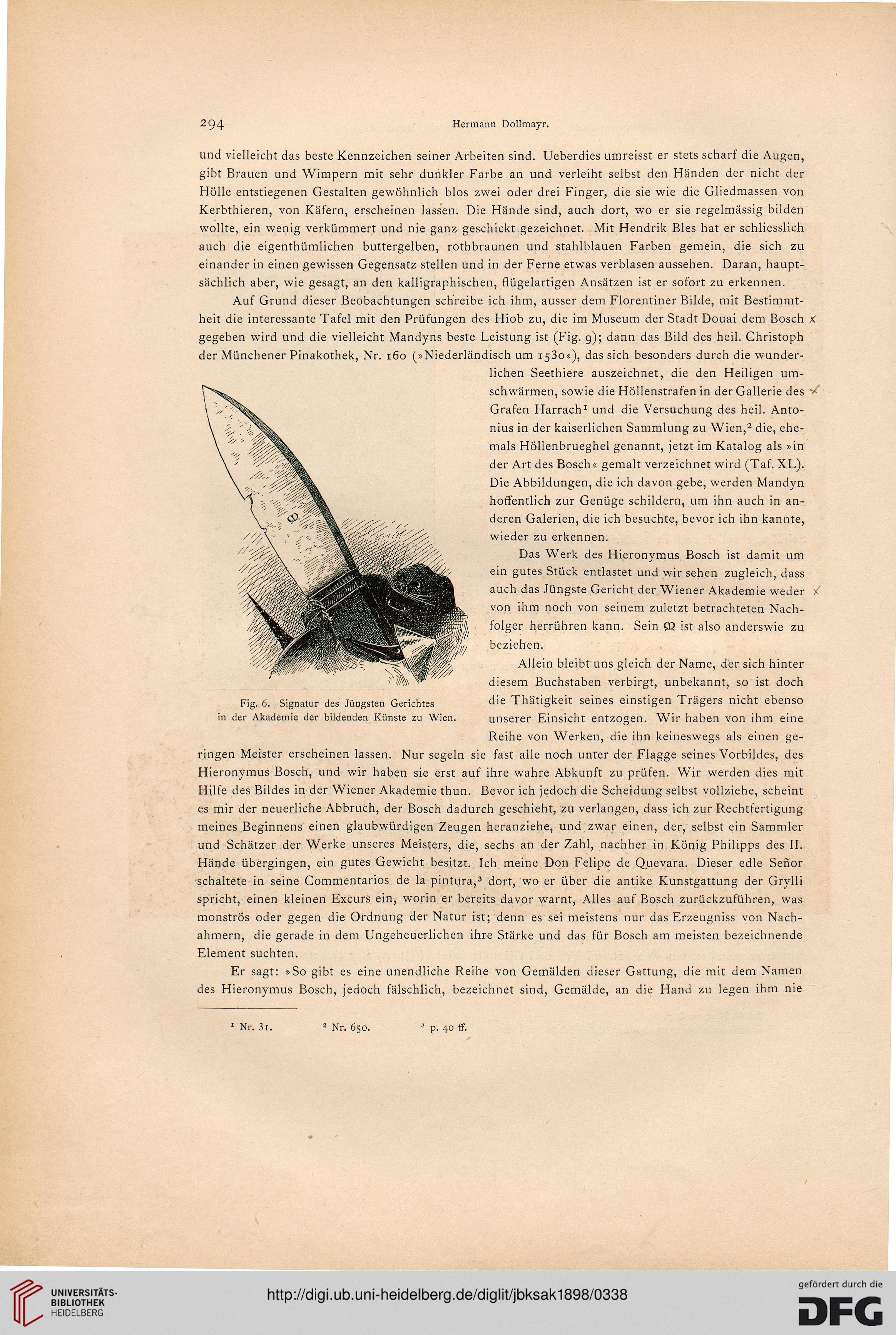294
Hermann Dollmayr.
und vielleicht das beste Kennzeichen seiner Arbeiten sind. Ueberdies umreisst er stets scharf die Augen,
gibt Brauen und Wimpern mit sehr dunkler Farbe an und verleiht selbst den Händen der nicht der
Hölle entstiegenen Gestalten gewöhnlich blos zwei oder drei Finger, die sie wie die Gliedmassen von
Kerbthieren, von Käfern, erscheinen lassen. Die Hände sind, auch dort, wo er sie regelmässig bilden
wollte, ein wenig verkümmert und nie ganz geschickt gezeichnet. Mit Hendrik Bles hat er schliesslich
auch die eigenthümlichen buttergelben, rothbraunen und stahlblauen Farben gemein, die sich zu
einander in einen gewissen Gegensatz stellen und in der Ferne etwas verblasen aussehen. Daran, haupt-
sächlich aber, wie gesagt, an den kalligraphischen, fiügelartigen Ansätzen ist er sofort zu erkennen.
Auf Grund dieser Beobachtungen schreibe ich ihm, ausser dem Florentiner Bilde, mit Bestimmt-
heit die interessante Tafel mit den Prüfungen des Hiob zu, die im Museum der Stadt Douai dem Bosch x
gegeben wird und die vielleicht Mandyns beste Leistung ist (Fig. g); dann das Bild des heil. Christoph
der Münchener Pinakothek, Nr. 160 (»Niederländisch um 1530«), das sich besonders durch die wunder-
lichen Seethiere auszeichnet, die den Heiligen um-
schwärmen, sowie die Höllenstrafen in der Gallerie des V
Grafen Harrach1 und die Versuchung des heil. Anto-
nius in der kaiserlichen Sammlung zu Wien,2 die, ehe-
mals Hollenbrueghel genannt, jetzt im Katalog als »in
der Art des Bosch« gemalt verzeichnet wird (Taf. XL).
Die Abbildungen, die ich davon gebe, werden Mandyn
hoffentlich zur Genüge schildern, um ihn auch in an-
deren Galerien, die ich besuchte, bevor ich ihn kannte,
wieder zu erkennen.
Das Werk des Hieronymus Bosch ist damit um
ein gutes Stück entlastet und wir sehen zugleich, dass
auch das Jüngste Gericht der Wiener Akademie weder X
von ihm noch von seinem zuletzt betrachteten Nach-
folger herrühren kann. Sein 03 ist also anderswie zu
beziehen.
Allein bleibt uns gleich der Name, der sich hinter
diesem Buchstaben verbirgt, unbekannt, so ist doch
die Thätigkeit seines einstigen Trägers nicht ebenso
unserer Einsicht entzogen. Wir haben von ihm eine
Reihe von Werken, die ihn keineswegs als einen ge-
ringen Meister erscheinen lassen. Nur segeln sie fast alle noch unter der Flagge seines Vorbildes, des
Hieronymus Bosch, und wir haben sie erst auf ihre wahre Abkunft zu prüfen. Wir werden dies mit
Hilfe des Bildes in der Wiener Akademie thun. Bevor ich jedoch die Scheidung selbst vollziehe, scheint
es mir der neuerliche Abbruch, der Bosch dadurch geschieht, zu verlangen, dass ich zur Rechtfertigung
meines Beginnens einen glaubwürdigen Zeugen heranziehe, und; zwar einen, der, selbst ein Sammler
und Schätzer der Werke unseres Meisters, die, sechs an der Zahl, nachher in König Philipps des II.
Hände übergingen, ein gutes Gewicht besitzt. Ich meine Don Felipe de Quevara. Dieser edle Senor
schaltete in seine Commentarios de la pintura,3 dort, wo er über die antike Kunstgattung der Grylli
spricht, einen kleinen Excurs ein, worin er bereits davor warnt, Alles auf Bosch zurückzuführen, was
monströs oder gegen die Ordnung der Natur ist; denn es sei meistens nur das Erzeugniss von Nach-
ahmern, die gerade in dem Ungeheuerlichen ihre Stärke und das für Bosch am meisten bezeichnende
Element suchten.
Er sagt: »So gibt es eine unendliche Reihe von Gemälden dieser Gattung, die mit dem Namen
des Hieronymus Bosch, jedoch fälschlich, bezeichnet sind, Gemälde, an die Hand zu legen ihm nie
1 Nr. 31. 3 Nr. 650. 3 p. 40 ff.
Hermann Dollmayr.
und vielleicht das beste Kennzeichen seiner Arbeiten sind. Ueberdies umreisst er stets scharf die Augen,
gibt Brauen und Wimpern mit sehr dunkler Farbe an und verleiht selbst den Händen der nicht der
Hölle entstiegenen Gestalten gewöhnlich blos zwei oder drei Finger, die sie wie die Gliedmassen von
Kerbthieren, von Käfern, erscheinen lassen. Die Hände sind, auch dort, wo er sie regelmässig bilden
wollte, ein wenig verkümmert und nie ganz geschickt gezeichnet. Mit Hendrik Bles hat er schliesslich
auch die eigenthümlichen buttergelben, rothbraunen und stahlblauen Farben gemein, die sich zu
einander in einen gewissen Gegensatz stellen und in der Ferne etwas verblasen aussehen. Daran, haupt-
sächlich aber, wie gesagt, an den kalligraphischen, fiügelartigen Ansätzen ist er sofort zu erkennen.
Auf Grund dieser Beobachtungen schreibe ich ihm, ausser dem Florentiner Bilde, mit Bestimmt-
heit die interessante Tafel mit den Prüfungen des Hiob zu, die im Museum der Stadt Douai dem Bosch x
gegeben wird und die vielleicht Mandyns beste Leistung ist (Fig. g); dann das Bild des heil. Christoph
der Münchener Pinakothek, Nr. 160 (»Niederländisch um 1530«), das sich besonders durch die wunder-
lichen Seethiere auszeichnet, die den Heiligen um-
schwärmen, sowie die Höllenstrafen in der Gallerie des V
Grafen Harrach1 und die Versuchung des heil. Anto-
nius in der kaiserlichen Sammlung zu Wien,2 die, ehe-
mals Hollenbrueghel genannt, jetzt im Katalog als »in
der Art des Bosch« gemalt verzeichnet wird (Taf. XL).
Die Abbildungen, die ich davon gebe, werden Mandyn
hoffentlich zur Genüge schildern, um ihn auch in an-
deren Galerien, die ich besuchte, bevor ich ihn kannte,
wieder zu erkennen.
Das Werk des Hieronymus Bosch ist damit um
ein gutes Stück entlastet und wir sehen zugleich, dass
auch das Jüngste Gericht der Wiener Akademie weder X
von ihm noch von seinem zuletzt betrachteten Nach-
folger herrühren kann. Sein 03 ist also anderswie zu
beziehen.
Allein bleibt uns gleich der Name, der sich hinter
diesem Buchstaben verbirgt, unbekannt, so ist doch
die Thätigkeit seines einstigen Trägers nicht ebenso
unserer Einsicht entzogen. Wir haben von ihm eine
Reihe von Werken, die ihn keineswegs als einen ge-
ringen Meister erscheinen lassen. Nur segeln sie fast alle noch unter der Flagge seines Vorbildes, des
Hieronymus Bosch, und wir haben sie erst auf ihre wahre Abkunft zu prüfen. Wir werden dies mit
Hilfe des Bildes in der Wiener Akademie thun. Bevor ich jedoch die Scheidung selbst vollziehe, scheint
es mir der neuerliche Abbruch, der Bosch dadurch geschieht, zu verlangen, dass ich zur Rechtfertigung
meines Beginnens einen glaubwürdigen Zeugen heranziehe, und; zwar einen, der, selbst ein Sammler
und Schätzer der Werke unseres Meisters, die, sechs an der Zahl, nachher in König Philipps des II.
Hände übergingen, ein gutes Gewicht besitzt. Ich meine Don Felipe de Quevara. Dieser edle Senor
schaltete in seine Commentarios de la pintura,3 dort, wo er über die antike Kunstgattung der Grylli
spricht, einen kleinen Excurs ein, worin er bereits davor warnt, Alles auf Bosch zurückzuführen, was
monströs oder gegen die Ordnung der Natur ist; denn es sei meistens nur das Erzeugniss von Nach-
ahmern, die gerade in dem Ungeheuerlichen ihre Stärke und das für Bosch am meisten bezeichnende
Element suchten.
Er sagt: »So gibt es eine unendliche Reihe von Gemälden dieser Gattung, die mit dem Namen
des Hieronymus Bosch, jedoch fälschlich, bezeichnet sind, Gemälde, an die Hand zu legen ihm nie
1 Nr. 31. 3 Nr. 650. 3 p. 40 ff.