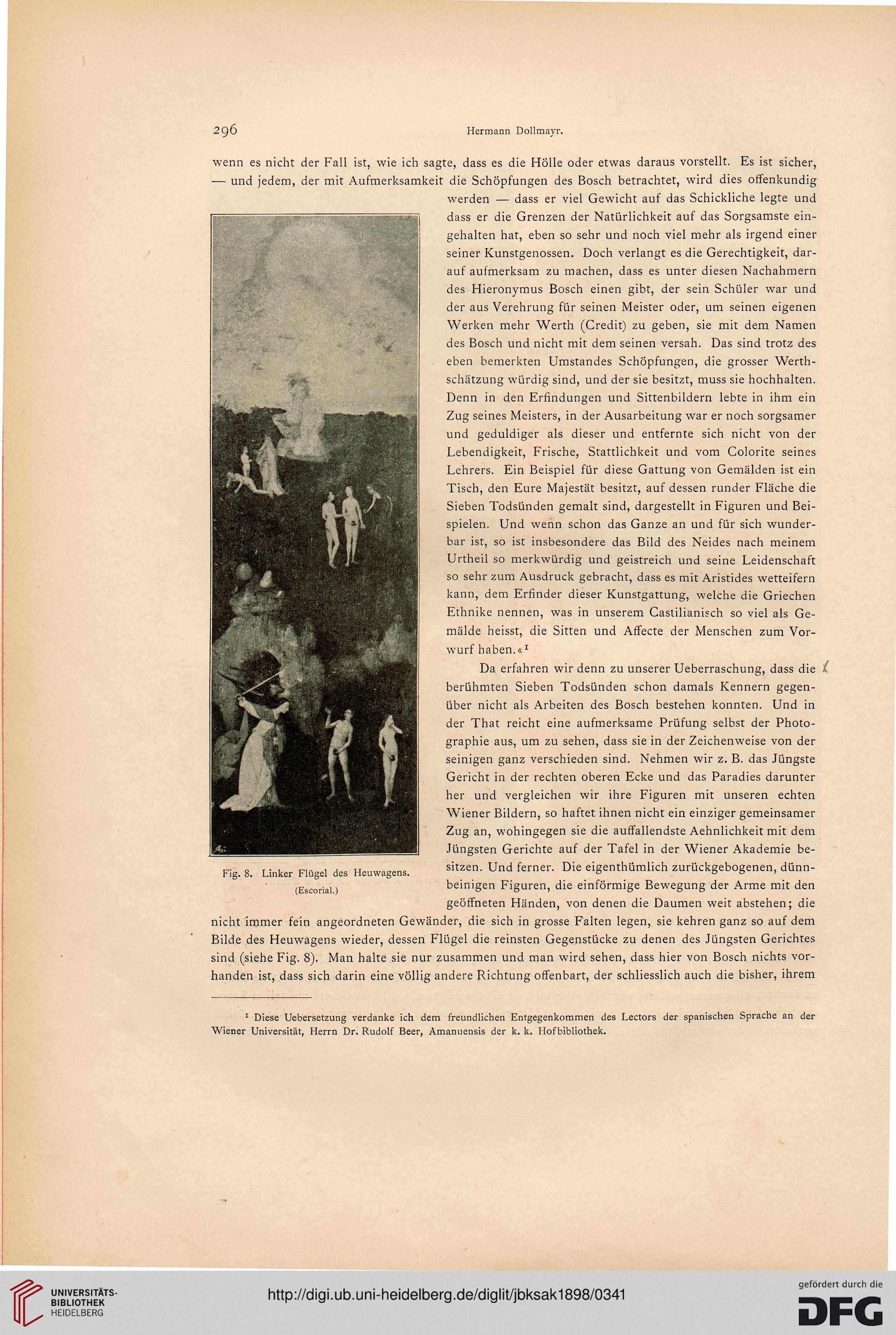2g6
Hermann Dollmayr.
wenn es nicht der Fall ist, wie ich sagte, dass es die Hölle oder etwas daraus vorstellt. Es ist sicher,
— und jedem, der mit Aufmerksamkeit die Schöpfungen des Bosch betrachtet, wird dies offenkundig
werden — dass er viel Gewicht auf das Schickliche legte und
dass er die Grenzen der Natürlichkeit auf das Sorgsamste ein-
gehalten hat, eben so sehr und noch viel mehr als irgend einer
seiner Kunstgenossen. Doch verlangt es die Gerechtigkeit, dar-
auf aufmerksam zu machen, dass es unter diesen Nachahmern
des Hieronymus Bosch einen gibt, der sein Schüler war und
der aus Verehrung für seinen Meister oder, um seinen eigenen
Werken mehr Werth (Credit) zu geben, sie mit dem Namen
des Bosch und nicht mit dem seinen versah. Das sind trotz des
eben bemerkten Umstandes Schöpfungen, die grosser Werth-
schätzung würdig sind, und der sie besitzt, muss sie hochhalten.
Denn in den Erfindungen und Sittenbildern lebte in ihm ein
Zug seines Meisters, in der Ausarbeitung war er noch sorgsamer
und geduldiger als dieser und entfernte sich nicht von der
Lebendigkeit, Frische, Stattlichkeit und vom Colorite seines
Lehrers. Ein Beispiel für diese Gattung von Gemälden ist ein
Tisch, den Eure Majestät besitzt, auf dessen runder Fläche die
Sieben Todsünden gemalt sind, dargestellt in Figuren und Bei-
spielen. Und wenn schon das Ganze an und für sich wunder-
bar ist, so ist insbesondere das Bild des Neides nach meinem
Urtheil so merkwürdig und geistreich und seine Leidenschaft
so sehr zum Ausdruck gebracht, dass es mit Aristides wetteifern
kann, dem Erfinder dieser Kunstgattung, welche die Griechen
Ethnike nennen, was in unserem Castilianisch so viel als Ge-
mälde heisst, die Sitten und Affecte der Menschen zum Vor-
wurf haben.«1
Da erfahren wir denn zu unserer Ueberraschung, dass die {
berühmten Sieben Todsünden schon damals Kennern gegen-
über nicht als Arbeiten des Bosch bestehen konnten. Und in
der That reicht eine aufmerksame Prüfung selbst der Photo-
graphie aus, um zu sehen, dass sie in der Zeichenweise von der
seinigen ganz verschieden sind. Nehmen wir z. B. das Jüngste
Gericht in der rechten oberen Ecke und das Paradies darunter
her und vergleichen wir ihre Figuren mit unseren echten
Wiener Bildern, so haftet ihnen nicht ein einziger gemeinsamer
Zug an, wohingegen sie die auffallendste Aehnlichkeit mit dem
Jüngsten Gerichte auf der Tafel in der Wiener Akademie be-
sitzen. Und ferner. Die eigenthümlich zurückgebogenen, dünn-
beinigen Figuren, die einförmige Bewegung der Arme mit den
geöffneten Händen, von denen die Daumen weit abstehen; die
nicht immer fein angeordneten Gewänder, die sich in grosse Falten legen, sie kehren ganz so auf dem
Bilde des Heuwagens wieder, dessen Flügel die reinsten Gegenstücke zu denen des Jüngsten Gerichtes
sind (siehe Fig. 8). Man halte sie nur zusammen und man wird sehen, dass hier von Bosch nichts vor-
handen ist, dass sich darin eine völlig andere Richtung offenbart, der schliesslich auch die bisher, ihrem
Fig. 8.
Linker Flügel des Heuwagens.
(Escorial.)
1 Diese Uebersetzung verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Lectors der spanischen Sprache an der
Wiener Universität, Herrn Dr. Rudolf Beer, Amanuensis der k. k. Hof bibliothek.
Hermann Dollmayr.
wenn es nicht der Fall ist, wie ich sagte, dass es die Hölle oder etwas daraus vorstellt. Es ist sicher,
— und jedem, der mit Aufmerksamkeit die Schöpfungen des Bosch betrachtet, wird dies offenkundig
werden — dass er viel Gewicht auf das Schickliche legte und
dass er die Grenzen der Natürlichkeit auf das Sorgsamste ein-
gehalten hat, eben so sehr und noch viel mehr als irgend einer
seiner Kunstgenossen. Doch verlangt es die Gerechtigkeit, dar-
auf aufmerksam zu machen, dass es unter diesen Nachahmern
des Hieronymus Bosch einen gibt, der sein Schüler war und
der aus Verehrung für seinen Meister oder, um seinen eigenen
Werken mehr Werth (Credit) zu geben, sie mit dem Namen
des Bosch und nicht mit dem seinen versah. Das sind trotz des
eben bemerkten Umstandes Schöpfungen, die grosser Werth-
schätzung würdig sind, und der sie besitzt, muss sie hochhalten.
Denn in den Erfindungen und Sittenbildern lebte in ihm ein
Zug seines Meisters, in der Ausarbeitung war er noch sorgsamer
und geduldiger als dieser und entfernte sich nicht von der
Lebendigkeit, Frische, Stattlichkeit und vom Colorite seines
Lehrers. Ein Beispiel für diese Gattung von Gemälden ist ein
Tisch, den Eure Majestät besitzt, auf dessen runder Fläche die
Sieben Todsünden gemalt sind, dargestellt in Figuren und Bei-
spielen. Und wenn schon das Ganze an und für sich wunder-
bar ist, so ist insbesondere das Bild des Neides nach meinem
Urtheil so merkwürdig und geistreich und seine Leidenschaft
so sehr zum Ausdruck gebracht, dass es mit Aristides wetteifern
kann, dem Erfinder dieser Kunstgattung, welche die Griechen
Ethnike nennen, was in unserem Castilianisch so viel als Ge-
mälde heisst, die Sitten und Affecte der Menschen zum Vor-
wurf haben.«1
Da erfahren wir denn zu unserer Ueberraschung, dass die {
berühmten Sieben Todsünden schon damals Kennern gegen-
über nicht als Arbeiten des Bosch bestehen konnten. Und in
der That reicht eine aufmerksame Prüfung selbst der Photo-
graphie aus, um zu sehen, dass sie in der Zeichenweise von der
seinigen ganz verschieden sind. Nehmen wir z. B. das Jüngste
Gericht in der rechten oberen Ecke und das Paradies darunter
her und vergleichen wir ihre Figuren mit unseren echten
Wiener Bildern, so haftet ihnen nicht ein einziger gemeinsamer
Zug an, wohingegen sie die auffallendste Aehnlichkeit mit dem
Jüngsten Gerichte auf der Tafel in der Wiener Akademie be-
sitzen. Und ferner. Die eigenthümlich zurückgebogenen, dünn-
beinigen Figuren, die einförmige Bewegung der Arme mit den
geöffneten Händen, von denen die Daumen weit abstehen; die
nicht immer fein angeordneten Gewänder, die sich in grosse Falten legen, sie kehren ganz so auf dem
Bilde des Heuwagens wieder, dessen Flügel die reinsten Gegenstücke zu denen des Jüngsten Gerichtes
sind (siehe Fig. 8). Man halte sie nur zusammen und man wird sehen, dass hier von Bosch nichts vor-
handen ist, dass sich darin eine völlig andere Richtung offenbart, der schliesslich auch die bisher, ihrem
Fig. 8.
Linker Flügel des Heuwagens.
(Escorial.)
1 Diese Uebersetzung verdanke ich dem freundlichen Entgegenkommen des Lectors der spanischen Sprache an der
Wiener Universität, Herrn Dr. Rudolf Beer, Amanuensis der k. k. Hof bibliothek.