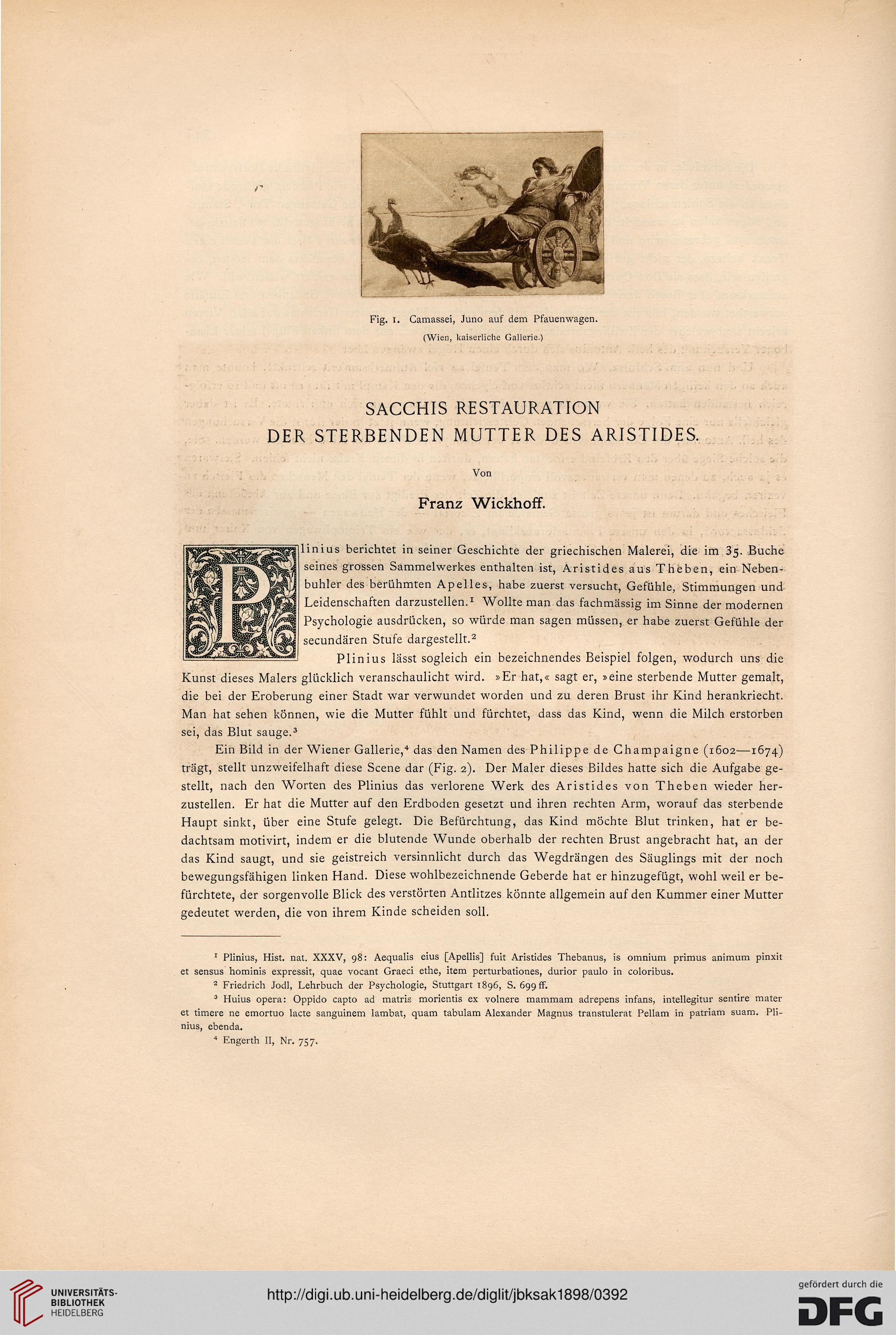Fig. i. Camassei, Juno auf dem Pfauenwagen.
(Wien, kaiserliche Gallerie.)
SACCHIS RESTAURATION
DER STERBENDEN MUTTER DES ARISTIDES.
Von
Franz Wickhoff.
linius berichtet in seiner Geschichte der griechischen Malerei, die im 35. Buche
seines grossen Sammelwerkes enthalten ist, Aristides aus Theben, ein Neben-
buhler des berühmten Apelles, habe zuerst versucht, Gefühle, Stimmungen und
Leidenschaften darzustellen.1 Wollte man das fachmässig im Sinne der modernen
Psychologie ausdrücken, so würde man sagen müssen, er habe zuerst Gefühle der
secundären Stufe dargestellt.2
Plinius lässt sogleich ein bezeichnendes Beispiel folgen, wodurch uns die
Kunst dieses Malers glücklich veranschaulicht wird. »Er hat,« sagt er, »eine sterbende Mutter gemalt,
die bei der Eroberung einer Stadt war verwundet worden und zu deren Brust ihr Kind herankriecht.
Man hat sehen können, wie die Mutter fühlt und fürchtet, dass das Kind, wenn die Milch erstorben
sei, das Blut sauge.3
Ein Bild in der Wiener Gallerie,4 das den Namen des Philippe de Champaigne (1602—1674)
trägt, stellt unzweifelhaft diese Scene dar (Fig. 2). Der Maler dieses Bildes hatte sich die Aufgabe ge-
stellt, nach den Worten des Plinius das verlorene Werk des Aristides von Theben wieder her-
zustellen. Er hat die Mutter auf den Erdboden gesetzt und ihren rechten Arm, worauf das sterbende
Haupt sinkt, über eine Stufe gelegt. Die Befürchtung, das Kind möchte Blut trinken, hat er be-
dachtsam motivirt, indem er die blutende Wunde oberhalb der rechten Brust angebracht hat, an der
das Kind saugt, und sie geistreich versinnlicht durch das Wegdrängen des Säuglings mit der noch
bewegungsfähigen linken Hand. Diese wohlbezeichnende Geberde hat er hinzugefügt, wohl weil er be-
fürchtete, der sorgenvolle Blick des verstörten Antlitzes könnte allgemein auf den Kummer einer Mutter
gedeutet werden, die von ihrem Kinde scheiden soll.
1 Plinius, Hist. nat. XXXV, 98: Aequalis eius [Apellis] fuit Aristides Thebanus, is omnium primus animum pinxit
et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ethe, item perturbationes, durior paulo in coloribus.
- Friedrich Jodl, Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart 1896, S. 699 fr'.
3 Huius opera: Oppido capto ad matris morientis ex volnere mammam adrepens infans, intellegitur sentire mater
et timere ne emortuo lacte sanguinem lambat, quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellam in patriam suam. Pli-
nius, ebenda.
4 Engerth II, Nr. 757.
(Wien, kaiserliche Gallerie.)
SACCHIS RESTAURATION
DER STERBENDEN MUTTER DES ARISTIDES.
Von
Franz Wickhoff.
linius berichtet in seiner Geschichte der griechischen Malerei, die im 35. Buche
seines grossen Sammelwerkes enthalten ist, Aristides aus Theben, ein Neben-
buhler des berühmten Apelles, habe zuerst versucht, Gefühle, Stimmungen und
Leidenschaften darzustellen.1 Wollte man das fachmässig im Sinne der modernen
Psychologie ausdrücken, so würde man sagen müssen, er habe zuerst Gefühle der
secundären Stufe dargestellt.2
Plinius lässt sogleich ein bezeichnendes Beispiel folgen, wodurch uns die
Kunst dieses Malers glücklich veranschaulicht wird. »Er hat,« sagt er, »eine sterbende Mutter gemalt,
die bei der Eroberung einer Stadt war verwundet worden und zu deren Brust ihr Kind herankriecht.
Man hat sehen können, wie die Mutter fühlt und fürchtet, dass das Kind, wenn die Milch erstorben
sei, das Blut sauge.3
Ein Bild in der Wiener Gallerie,4 das den Namen des Philippe de Champaigne (1602—1674)
trägt, stellt unzweifelhaft diese Scene dar (Fig. 2). Der Maler dieses Bildes hatte sich die Aufgabe ge-
stellt, nach den Worten des Plinius das verlorene Werk des Aristides von Theben wieder her-
zustellen. Er hat die Mutter auf den Erdboden gesetzt und ihren rechten Arm, worauf das sterbende
Haupt sinkt, über eine Stufe gelegt. Die Befürchtung, das Kind möchte Blut trinken, hat er be-
dachtsam motivirt, indem er die blutende Wunde oberhalb der rechten Brust angebracht hat, an der
das Kind saugt, und sie geistreich versinnlicht durch das Wegdrängen des Säuglings mit der noch
bewegungsfähigen linken Hand. Diese wohlbezeichnende Geberde hat er hinzugefügt, wohl weil er be-
fürchtete, der sorgenvolle Blick des verstörten Antlitzes könnte allgemein auf den Kummer einer Mutter
gedeutet werden, die von ihrem Kinde scheiden soll.
1 Plinius, Hist. nat. XXXV, 98: Aequalis eius [Apellis] fuit Aristides Thebanus, is omnium primus animum pinxit
et sensus hominis expressit, quae vocant Graeci ethe, item perturbationes, durior paulo in coloribus.
- Friedrich Jodl, Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart 1896, S. 699 fr'.
3 Huius opera: Oppido capto ad matris morientis ex volnere mammam adrepens infans, intellegitur sentire mater
et timere ne emortuo lacte sanguinem lambat, quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellam in patriam suam. Pli-
nius, ebenda.
4 Engerth II, Nr. 757.