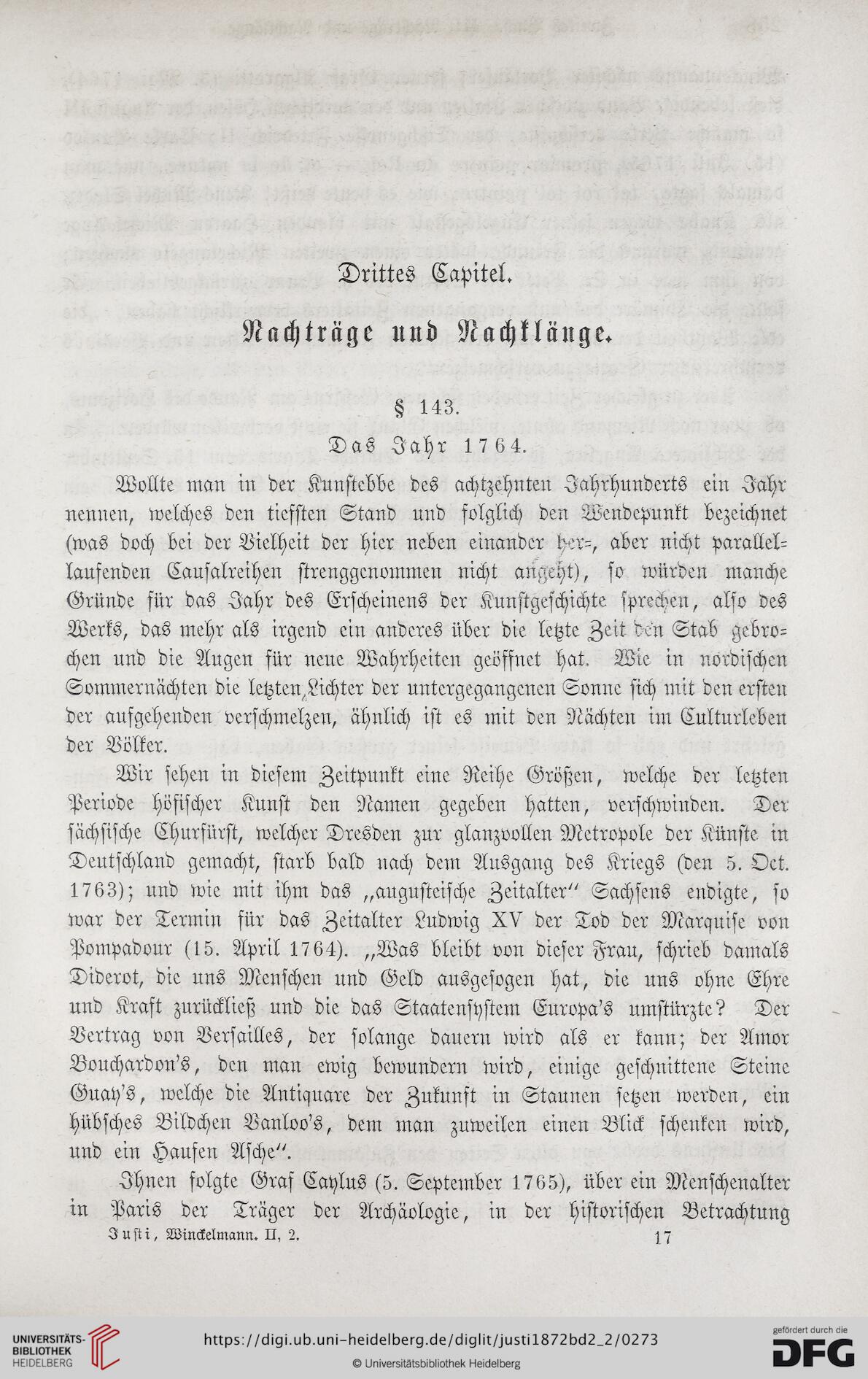Drittes Capitel.
Nachträge und Nachklänge.
§ 143.
Das Jahr 1 7 64.
Wollte man in der Kunstebbe des achtzehnten Jahrhunderts ein Jahr
nennen, welches den tiefsten Stand und folglich den Wendepunkt bezeichnet
(was doch bei der Vielheit der hier neben einander der-, aber nicht parallel-
laufenden Causalreihen strenggenommen nicht angcht), so würden manche
Gründe für das Jahr des Erfcheinens der Kunstgeschichte sprechen, also ves
Werks, das mehr als irgend ein anderes über die letzte Zeit den Stab gebro-
chen und die Augen für neue Wahrheiten geöffnet hat. Wie in nordischen
Sommernächten die letztenPichter der untergegangenen Sonne sich mit den ersten
der ausgehenden verschmelzen, ähnlich ist es mit den Nächten im Culturleben
der Völker.
Wir sehen in diesem Zeitpunkt eine Reihe Größen, welche der letzten
Periode höfischer Kunst den Namen gegeben hatten, verschwinden. Der
sächsische Churfürst, welcher Dresden zur glanzvollen Metropole der Künste in
Deutschland gemacht, starb bald nach dem Ausgang des Kriegs (den 5. Oct.
1763); und wie mit ihm das „augusteische Zeitalter" Sachsens endigte, so
war der Termin für das Zeitalter Ludwig XV der Tod der Marquise von
Pompadour (15. April 1764). „Was bleibt von dieser Frau, schrieb damals
Diderot, die uns Menschen und Geld ausgesogen hat, die uns ohne Ehre
und Kraft znrückließ und die das Staatensystem Europa's umstürzte? Der
Vertrag von Versailles, der solange dauern wird als er kann; der Amor
Bouchardon's, den man ewig bewundern wird, einige geschnittene Steine
Guay's, welche die Antiquare der Zukunft in Staunen setzen werden, ein
hübsches Bildchen Vanloo's, dem man zuweilen einen Blick schenken wird,
und ein Haufen Asche".
Ihnen folgte Graf Caylus (5. September 1765), über ein Menschenalter
in Paris der Träger der Archäologie, in der historischen Betrachtung
Iusti, Winckelmann. II, 2. 17
Nachträge und Nachklänge.
§ 143.
Das Jahr 1 7 64.
Wollte man in der Kunstebbe des achtzehnten Jahrhunderts ein Jahr
nennen, welches den tiefsten Stand und folglich den Wendepunkt bezeichnet
(was doch bei der Vielheit der hier neben einander der-, aber nicht parallel-
laufenden Causalreihen strenggenommen nicht angcht), so würden manche
Gründe für das Jahr des Erfcheinens der Kunstgeschichte sprechen, also ves
Werks, das mehr als irgend ein anderes über die letzte Zeit den Stab gebro-
chen und die Augen für neue Wahrheiten geöffnet hat. Wie in nordischen
Sommernächten die letztenPichter der untergegangenen Sonne sich mit den ersten
der ausgehenden verschmelzen, ähnlich ist es mit den Nächten im Culturleben
der Völker.
Wir sehen in diesem Zeitpunkt eine Reihe Größen, welche der letzten
Periode höfischer Kunst den Namen gegeben hatten, verschwinden. Der
sächsische Churfürst, welcher Dresden zur glanzvollen Metropole der Künste in
Deutschland gemacht, starb bald nach dem Ausgang des Kriegs (den 5. Oct.
1763); und wie mit ihm das „augusteische Zeitalter" Sachsens endigte, so
war der Termin für das Zeitalter Ludwig XV der Tod der Marquise von
Pompadour (15. April 1764). „Was bleibt von dieser Frau, schrieb damals
Diderot, die uns Menschen und Geld ausgesogen hat, die uns ohne Ehre
und Kraft znrückließ und die das Staatensystem Europa's umstürzte? Der
Vertrag von Versailles, der solange dauern wird als er kann; der Amor
Bouchardon's, den man ewig bewundern wird, einige geschnittene Steine
Guay's, welche die Antiquare der Zukunft in Staunen setzen werden, ein
hübsches Bildchen Vanloo's, dem man zuweilen einen Blick schenken wird,
und ein Haufen Asche".
Ihnen folgte Graf Caylus (5. September 1765), über ein Menschenalter
in Paris der Träger der Archäologie, in der historischen Betrachtung
Iusti, Winckelmann. II, 2. 17