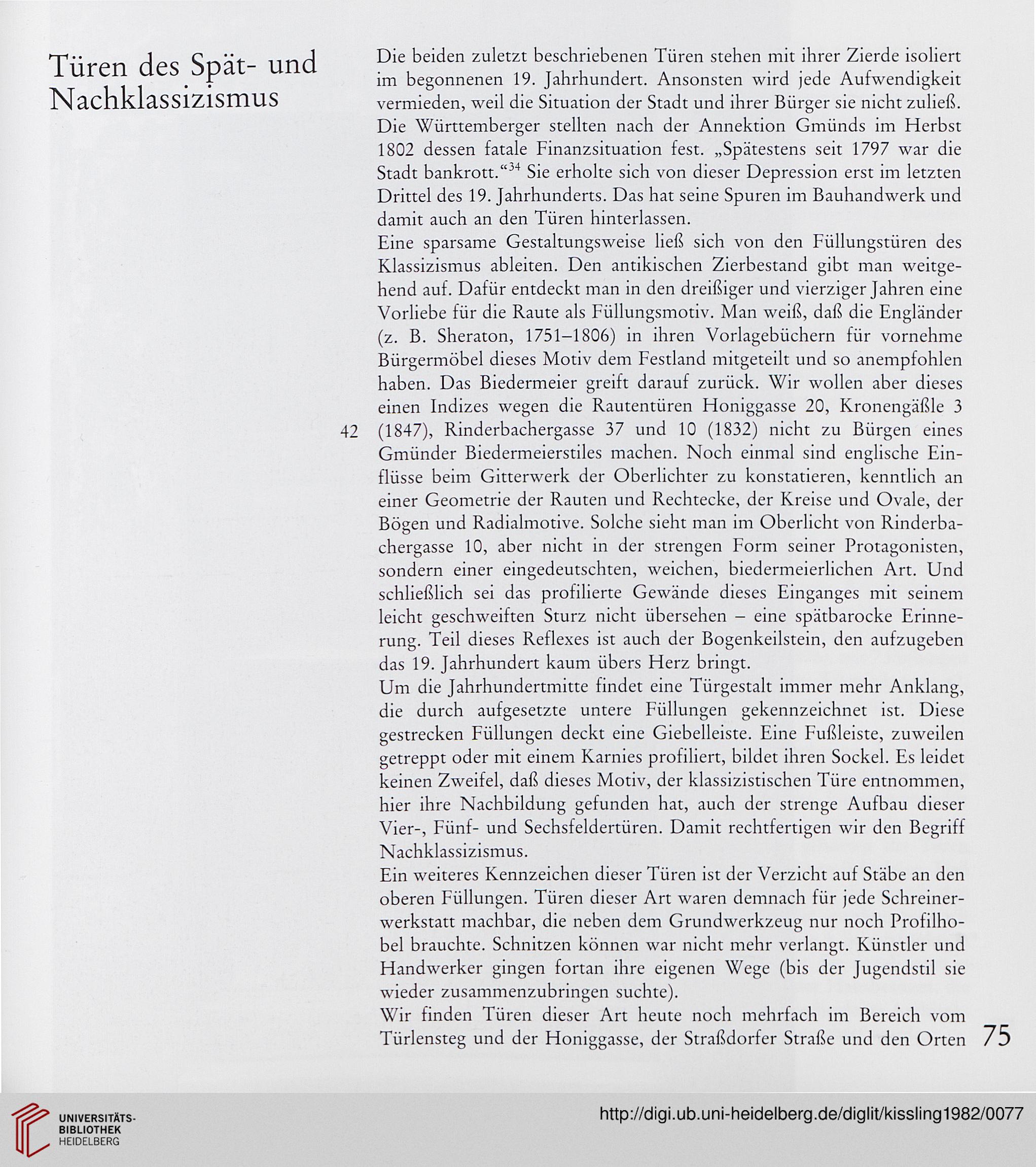Türen des Spät- und
Nachklassizismus
Die beiden zuletzt beschriebenen Türen stehen mit ihrer Zierde isoliert
im begonnenen 19. Jahrhundert. Ansonsten wird jede Aufwendigkeit
vermieden, weil die Situation der Stadt und ihrer Bürger sie nicht zuließ.
Die Württemberger stellten nach der Annektion Gmünds im Herbst
1802 dessen fatale Finanzsituation fest. „Spätestens seit 1797 war die
Stadt bankrott.'04 Sie erholte sich von dieser Depression erst im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts. Das hat seine Spuren im Bauhandwerk und
damit auch an den Türen hinterlassen.
Eine sparsame Gestaltungsweise ließ sich von den Füllungstüren des
Klassizismus ableiten. Den antikischen Zierbestand gibt man weitge-
hend auf. Dafür entdeckt man in den dreißiger und vierziger Jahren eine
Vorliebe für die Raute als Füllungsmotiv. Man weiß, daß die Engländer
(z. B. Sheraton, 1751-1806) in ihren Vorlagebüchern für vornehme
Bürgermöbel dieses Motiv dem Festland mitgeteilt und so anempfohlen
haben. Das Biedermeier greift darauf zurück. Wir wollen aber dieses
einen Indizes wegen die Rautentüren Honiggasse 20, Kronengäßle 3
42 (1847), Rinderbachergasse 37 und 10 (1832) nicht zu Bürgen eines
Gmünder Biedermeierstiles machen. Noch einmal sind englische Ein-
flüsse beim Gitterwerk der Oberlichter zu konstatieren, kenntlich an
einer Geometrie der Rauten und Rechtecke, der Kreise und Ovale, der
Bögen und Radialmotive. Solche sieht man im Oberlicht von Rinderba-
chergasse 10, aber nicht in der strengen Form seiner Protagonisten,
sondern einer eingedeutschten, weichen, biedermeierlichen Art. Und
schließlich sei das profilierte Gewände dieses Einganges mit seinem
leicht geschweiften Sturz nicht übersehen - eine spätbarocke Erinne-
rung. Teil dieses Reflexes ist auch der Bogenkeilstein, den aufzugeben
das 19. Jahrhundert kaum übers Herz bringt.
Um die Jahrhundertmitte findet eine Türgestalt immer mehr Anklang,
die durch aufgesetzte untere Füllungen gekennzeichnet ist. Diese
gestrecken Füllungen deckt eine Giebelleiste. Eine Fußleiste, zuweilen
getreppt oder mit einem Karnies profiliert, bildet ihren Sockel. Es leidet
keinen Zweifel, daß dieses Motiv, der klassizistischen Türe entnommen,
hier ihre Nachbildung gefunden hat, auch der strenge Aufbau dieser
Vier-, Fünf- und Sechsfeldertüren. Damit rechtfertigen wir den Begriff
Nachklassizismus.
Ein weiteres Kennzeichen dieser Türen ist der Verzicht auf Stäbe an den
oberen Füllungen. Türen dieser Art waren demnach für jede Schreiner-
werkstatt machbar, die neben dem Grundwerkzeug nur noch Profilho-
bel brauchte. Schnitzen können war nicht mehr verlangt. Künstler und
Handwerker gingen fortan ihre eigenen Wege (bis der Jugendstil sie
wieder zusammenzubringen suchte).
Wir finden Türen dieser Art heute noch mehrfach im Bereich vom
Türlensteg und der Honiggasse, der Straßdorfer Straße und den Orten
75
Nachklassizismus
Die beiden zuletzt beschriebenen Türen stehen mit ihrer Zierde isoliert
im begonnenen 19. Jahrhundert. Ansonsten wird jede Aufwendigkeit
vermieden, weil die Situation der Stadt und ihrer Bürger sie nicht zuließ.
Die Württemberger stellten nach der Annektion Gmünds im Herbst
1802 dessen fatale Finanzsituation fest. „Spätestens seit 1797 war die
Stadt bankrott.'04 Sie erholte sich von dieser Depression erst im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts. Das hat seine Spuren im Bauhandwerk und
damit auch an den Türen hinterlassen.
Eine sparsame Gestaltungsweise ließ sich von den Füllungstüren des
Klassizismus ableiten. Den antikischen Zierbestand gibt man weitge-
hend auf. Dafür entdeckt man in den dreißiger und vierziger Jahren eine
Vorliebe für die Raute als Füllungsmotiv. Man weiß, daß die Engländer
(z. B. Sheraton, 1751-1806) in ihren Vorlagebüchern für vornehme
Bürgermöbel dieses Motiv dem Festland mitgeteilt und so anempfohlen
haben. Das Biedermeier greift darauf zurück. Wir wollen aber dieses
einen Indizes wegen die Rautentüren Honiggasse 20, Kronengäßle 3
42 (1847), Rinderbachergasse 37 und 10 (1832) nicht zu Bürgen eines
Gmünder Biedermeierstiles machen. Noch einmal sind englische Ein-
flüsse beim Gitterwerk der Oberlichter zu konstatieren, kenntlich an
einer Geometrie der Rauten und Rechtecke, der Kreise und Ovale, der
Bögen und Radialmotive. Solche sieht man im Oberlicht von Rinderba-
chergasse 10, aber nicht in der strengen Form seiner Protagonisten,
sondern einer eingedeutschten, weichen, biedermeierlichen Art. Und
schließlich sei das profilierte Gewände dieses Einganges mit seinem
leicht geschweiften Sturz nicht übersehen - eine spätbarocke Erinne-
rung. Teil dieses Reflexes ist auch der Bogenkeilstein, den aufzugeben
das 19. Jahrhundert kaum übers Herz bringt.
Um die Jahrhundertmitte findet eine Türgestalt immer mehr Anklang,
die durch aufgesetzte untere Füllungen gekennzeichnet ist. Diese
gestrecken Füllungen deckt eine Giebelleiste. Eine Fußleiste, zuweilen
getreppt oder mit einem Karnies profiliert, bildet ihren Sockel. Es leidet
keinen Zweifel, daß dieses Motiv, der klassizistischen Türe entnommen,
hier ihre Nachbildung gefunden hat, auch der strenge Aufbau dieser
Vier-, Fünf- und Sechsfeldertüren. Damit rechtfertigen wir den Begriff
Nachklassizismus.
Ein weiteres Kennzeichen dieser Türen ist der Verzicht auf Stäbe an den
oberen Füllungen. Türen dieser Art waren demnach für jede Schreiner-
werkstatt machbar, die neben dem Grundwerkzeug nur noch Profilho-
bel brauchte. Schnitzen können war nicht mehr verlangt. Künstler und
Handwerker gingen fortan ihre eigenen Wege (bis der Jugendstil sie
wieder zusammenzubringen suchte).
Wir finden Türen dieser Art heute noch mehrfach im Bereich vom
Türlensteg und der Honiggasse, der Straßdorfer Straße und den Orten
75