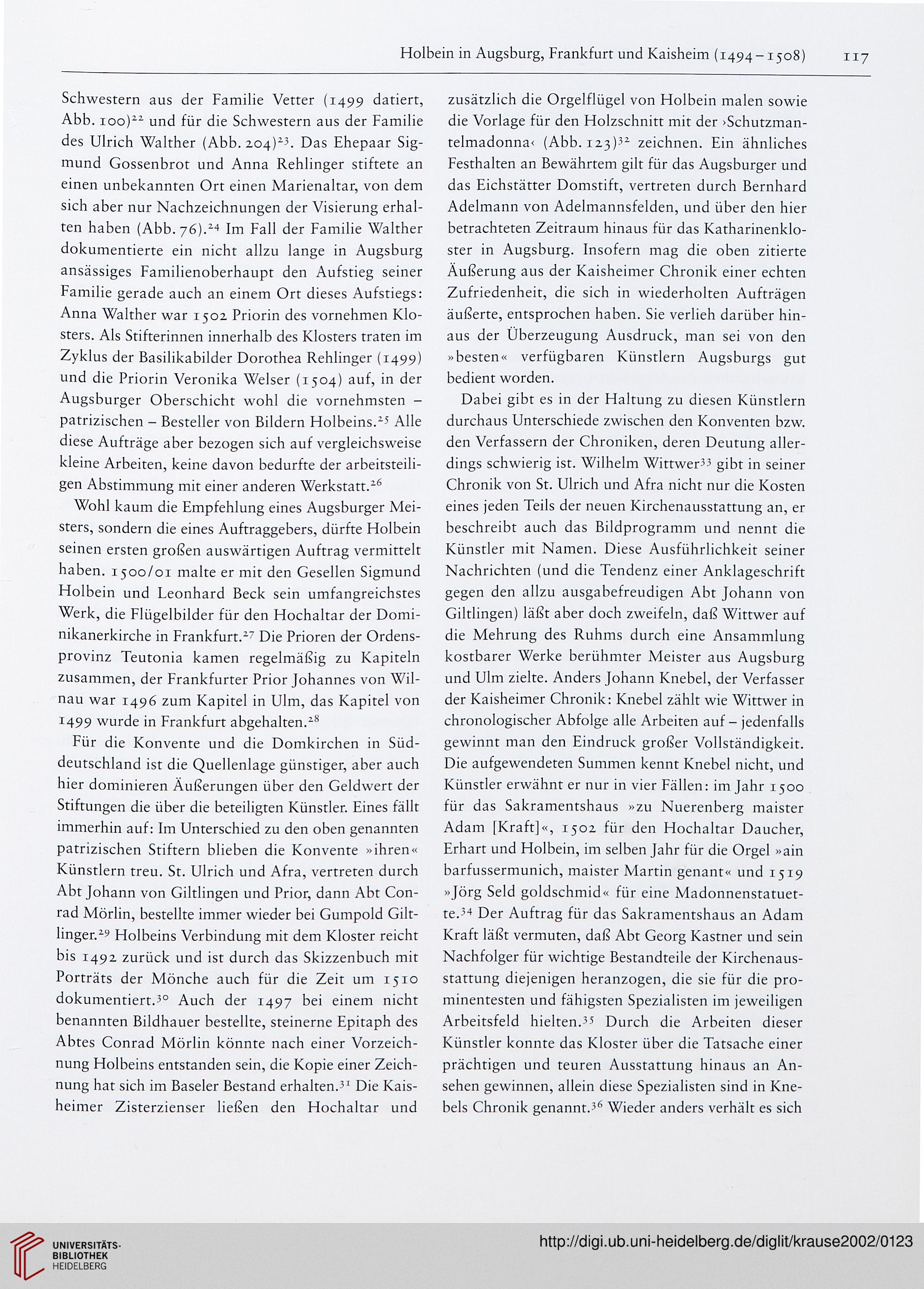Holbein in Augsburg, Frankfurt und Kaisheim (1494-1508) 117
Schwestern aus der Familie Vetter (1499 datiert,
Abb. 100)11 und für die Schwestern aus der Familie
des Ulrich Walther (Abb. 204)*'. Das Ehepaar Sig-
mund Gossenbrot und Anna Rehlinger stiftete an
einen unbekannten Ort einen Marienaltar, von dem
sich aber nur Nachzeichnungen der Visierung erhal-
ten haben (Abb. 76).14 Im Fall der Familie Walther
dokumentierte ein nicht allzu lange in Augsburg
ansässiges Familienoberhaupt den Aufstieg seiner
Familie gerade auch an einem Ort dieses Aufstiegs:
Anna Walther war 1502 Priorin des vornehmen Klo-
sters. Als Stifterinnen innerhalb des Klosters traten im
Zyklus der Basilikabilder Dorothea Rehlinger (1499)
und die Priorin Veronika Welser (1504) auf, in der
Augsburger Oberschicht wohl die vornehmsten -
patrizischen - Besteller von Bildern Holbeins.15 Alle
diese Aufträge aber bezogen sich auf vergleichsweise
kleine Arbeiten, keine davon bedurfte der arbeitsteili-
gen Abstimmung mit einer anderen Werkstatt.16
Wohl kaum die Empfehlung eines Augsburger Mei-
sters, sondern die eines Auftraggebers, dürfte Holbein
seinen ersten großen auswärtigen Auftrag vermittelt
haben. 1500/01 malte er mit den Gesellen Sigmund
Holbein und Leonhard Beck sein umfangreichstes
Werk, die Flügelbilder für den Hochaltar der Domi-
nikanerkirche in Frankfurt.17 Die Prioren der Ordens-
provinz Teutonia kamen regelmäßig zu Kapiteln
zusammen, der Frankfurter Prior Johannes von Wil-
nau war 1496 zum Kapitel in Ulm, das Kapitel von
1499 wurde in Frankfurt abgehalten.18
Für die Konvente und die Domkirchen in Süd-
deutschland ist die Quellenlage günstiger, aber auch
hier dominieren Äußerungen über den Geldwert der
Stiftungen die über die beteiligten Künstler. Eines fällt
immerhin auf: Im Unterschied zu den oben genannten
patrizischen Stiftern blieben die Konvente »ihren«
Künstlern treu. St. Ulrich und Afra, vertreten durch
Abt Johann von Giltlingen und Prior, dann Abt Con-
rad Mörlin, bestellte immer wieder bei Gumpold Gilt-
linger.19 Holbeins Verbindung mit dem Kloster reicht
bis 1492 zurück und ist durch das Skizzenbuch mit
Porträts der Mönche auch für die Zeit um 1510
dokumentiert.30 Auch der 1497 bei einem nicht
benannten Bildhauer bestellte, steinerne Epitaph des
Abtes Conrad Mörlin könnte nach einer Vorzeich-
nung Holbeins entstanden sein, die Kopie einer Zeich-
nung hat sich im Baseler Bestand erhalten." Die Kais-
heimer Zisterzienser ließen den Hochaltar und
zusätzlich die Orgelflügel von Holbein malen sowie
die Vorlage für den Holzschnitt mit der >Schutzman-
telmadonna< (Abb. 123)32 zeichnen. Ein ähnliches
Festhalten an Bewährtem gilt für das Augsburger und
das Eichstätter Domstift, vertreten durch Bernhard
Adelmann von Adelmannsfelden, und über den hier
betrachteten Zeitraum hinaus für das Katharinenklo-
ster in Augsburg. Insofern mag die oben zitierte
Äußerung aus der Kaisheimer Chronik einer echten
Zufriedenheit, die sich in wiederholten Aufträgen
äußerte, entsprochen haben. Sie verlieh darüber hin-
aus der Überzeugung Ausdruck, man sei von den
»besten« verfügbaren Künstlern Augsburgs gut
bedient worden.
Dabei gibt es in der Haltung zu diesen Künstlern
durchaus Unterschiede zwischen den Konventen bzw.
den Verfassern der Chroniken, deren Deutung aller-
dings schwierig ist. Wilhelm Wittwer'5 gibt in seiner
Chronik von St. Ulrich und Afra nicht nur die Kosten
eines jeden Teils der neuen Kirchenausstattung an, er
beschreibt auch das Bildprogramm und nennt die
Künstler mit Namen. Diese Ausführlichkeit seiner
Nachrichten (und die Tendenz einer Anklageschrift
gegen den allzu ausgabefreudigen Abt Johann von
Giltlingen) läßt aber doch zweifeln, daß Wittwer auf
die Mehrung des Ruhms durch eine Ansammlung
kostbarer Werke berühmter Meister aus Augsburg
und Ulm zielte. Anders Johann Knebel, der Verfasser
der Kaisheimer Chronik: Knebel zählt wie Wittwer in
chronologischer Abfolge alle Arbeiten auf - jedenfalls
gewinnt man den Eindruck großer Vollständigkeit.
Die aufgewendeten Summen kennt Knebel nicht, und
Künstler erwähnt er nur in vier Fällen: im Jahr 1 500
für das Sakramentshaus »zu Nuerenberg maister
Adam |Kraft]«, 1502 für den Hochaltar Daucher,
Erhart und Holbein, im selben Jahr für die Orgel »ain
barfussermunich, maister Martin genant« und 1519
»Jörg Seid goldschmid« für eine Madonnenstatuet-
te.34 Der Auftrag für das Sakramentshaus an Adam
Kraft läßt vermuten, daß Abt Georg Kastner und sein
Nachfolger für wichtige Bestandteile der Kirchenaus-
stattung diejenigen heranzogen, die sie für die pro-
minentesten und fähigsten Spezialisten im jeweiligen
Arbeitsfeld hielten.'5 Durch die Arbeiten dieser
Künstler konnte das Kloster über die Tatsache einer
prächtigen und teuren Ausstattung hinaus an An-
sehen gewinnen, allein diese Spezialisten sind in Kne-
bels Chronik genannt."1 Wieder anders verhält es sich
Schwestern aus der Familie Vetter (1499 datiert,
Abb. 100)11 und für die Schwestern aus der Familie
des Ulrich Walther (Abb. 204)*'. Das Ehepaar Sig-
mund Gossenbrot und Anna Rehlinger stiftete an
einen unbekannten Ort einen Marienaltar, von dem
sich aber nur Nachzeichnungen der Visierung erhal-
ten haben (Abb. 76).14 Im Fall der Familie Walther
dokumentierte ein nicht allzu lange in Augsburg
ansässiges Familienoberhaupt den Aufstieg seiner
Familie gerade auch an einem Ort dieses Aufstiegs:
Anna Walther war 1502 Priorin des vornehmen Klo-
sters. Als Stifterinnen innerhalb des Klosters traten im
Zyklus der Basilikabilder Dorothea Rehlinger (1499)
und die Priorin Veronika Welser (1504) auf, in der
Augsburger Oberschicht wohl die vornehmsten -
patrizischen - Besteller von Bildern Holbeins.15 Alle
diese Aufträge aber bezogen sich auf vergleichsweise
kleine Arbeiten, keine davon bedurfte der arbeitsteili-
gen Abstimmung mit einer anderen Werkstatt.16
Wohl kaum die Empfehlung eines Augsburger Mei-
sters, sondern die eines Auftraggebers, dürfte Holbein
seinen ersten großen auswärtigen Auftrag vermittelt
haben. 1500/01 malte er mit den Gesellen Sigmund
Holbein und Leonhard Beck sein umfangreichstes
Werk, die Flügelbilder für den Hochaltar der Domi-
nikanerkirche in Frankfurt.17 Die Prioren der Ordens-
provinz Teutonia kamen regelmäßig zu Kapiteln
zusammen, der Frankfurter Prior Johannes von Wil-
nau war 1496 zum Kapitel in Ulm, das Kapitel von
1499 wurde in Frankfurt abgehalten.18
Für die Konvente und die Domkirchen in Süd-
deutschland ist die Quellenlage günstiger, aber auch
hier dominieren Äußerungen über den Geldwert der
Stiftungen die über die beteiligten Künstler. Eines fällt
immerhin auf: Im Unterschied zu den oben genannten
patrizischen Stiftern blieben die Konvente »ihren«
Künstlern treu. St. Ulrich und Afra, vertreten durch
Abt Johann von Giltlingen und Prior, dann Abt Con-
rad Mörlin, bestellte immer wieder bei Gumpold Gilt-
linger.19 Holbeins Verbindung mit dem Kloster reicht
bis 1492 zurück und ist durch das Skizzenbuch mit
Porträts der Mönche auch für die Zeit um 1510
dokumentiert.30 Auch der 1497 bei einem nicht
benannten Bildhauer bestellte, steinerne Epitaph des
Abtes Conrad Mörlin könnte nach einer Vorzeich-
nung Holbeins entstanden sein, die Kopie einer Zeich-
nung hat sich im Baseler Bestand erhalten." Die Kais-
heimer Zisterzienser ließen den Hochaltar und
zusätzlich die Orgelflügel von Holbein malen sowie
die Vorlage für den Holzschnitt mit der >Schutzman-
telmadonna< (Abb. 123)32 zeichnen. Ein ähnliches
Festhalten an Bewährtem gilt für das Augsburger und
das Eichstätter Domstift, vertreten durch Bernhard
Adelmann von Adelmannsfelden, und über den hier
betrachteten Zeitraum hinaus für das Katharinenklo-
ster in Augsburg. Insofern mag die oben zitierte
Äußerung aus der Kaisheimer Chronik einer echten
Zufriedenheit, die sich in wiederholten Aufträgen
äußerte, entsprochen haben. Sie verlieh darüber hin-
aus der Überzeugung Ausdruck, man sei von den
»besten« verfügbaren Künstlern Augsburgs gut
bedient worden.
Dabei gibt es in der Haltung zu diesen Künstlern
durchaus Unterschiede zwischen den Konventen bzw.
den Verfassern der Chroniken, deren Deutung aller-
dings schwierig ist. Wilhelm Wittwer'5 gibt in seiner
Chronik von St. Ulrich und Afra nicht nur die Kosten
eines jeden Teils der neuen Kirchenausstattung an, er
beschreibt auch das Bildprogramm und nennt die
Künstler mit Namen. Diese Ausführlichkeit seiner
Nachrichten (und die Tendenz einer Anklageschrift
gegen den allzu ausgabefreudigen Abt Johann von
Giltlingen) läßt aber doch zweifeln, daß Wittwer auf
die Mehrung des Ruhms durch eine Ansammlung
kostbarer Werke berühmter Meister aus Augsburg
und Ulm zielte. Anders Johann Knebel, der Verfasser
der Kaisheimer Chronik: Knebel zählt wie Wittwer in
chronologischer Abfolge alle Arbeiten auf - jedenfalls
gewinnt man den Eindruck großer Vollständigkeit.
Die aufgewendeten Summen kennt Knebel nicht, und
Künstler erwähnt er nur in vier Fällen: im Jahr 1 500
für das Sakramentshaus »zu Nuerenberg maister
Adam |Kraft]«, 1502 für den Hochaltar Daucher,
Erhart und Holbein, im selben Jahr für die Orgel »ain
barfussermunich, maister Martin genant« und 1519
»Jörg Seid goldschmid« für eine Madonnenstatuet-
te.34 Der Auftrag für das Sakramentshaus an Adam
Kraft läßt vermuten, daß Abt Georg Kastner und sein
Nachfolger für wichtige Bestandteile der Kirchenaus-
stattung diejenigen heranzogen, die sie für die pro-
minentesten und fähigsten Spezialisten im jeweiligen
Arbeitsfeld hielten.'5 Durch die Arbeiten dieser
Künstler konnte das Kloster über die Tatsache einer
prächtigen und teuren Ausstattung hinaus an An-
sehen gewinnen, allein diese Spezialisten sind in Kne-
bels Chronik genannt."1 Wieder anders verhält es sich