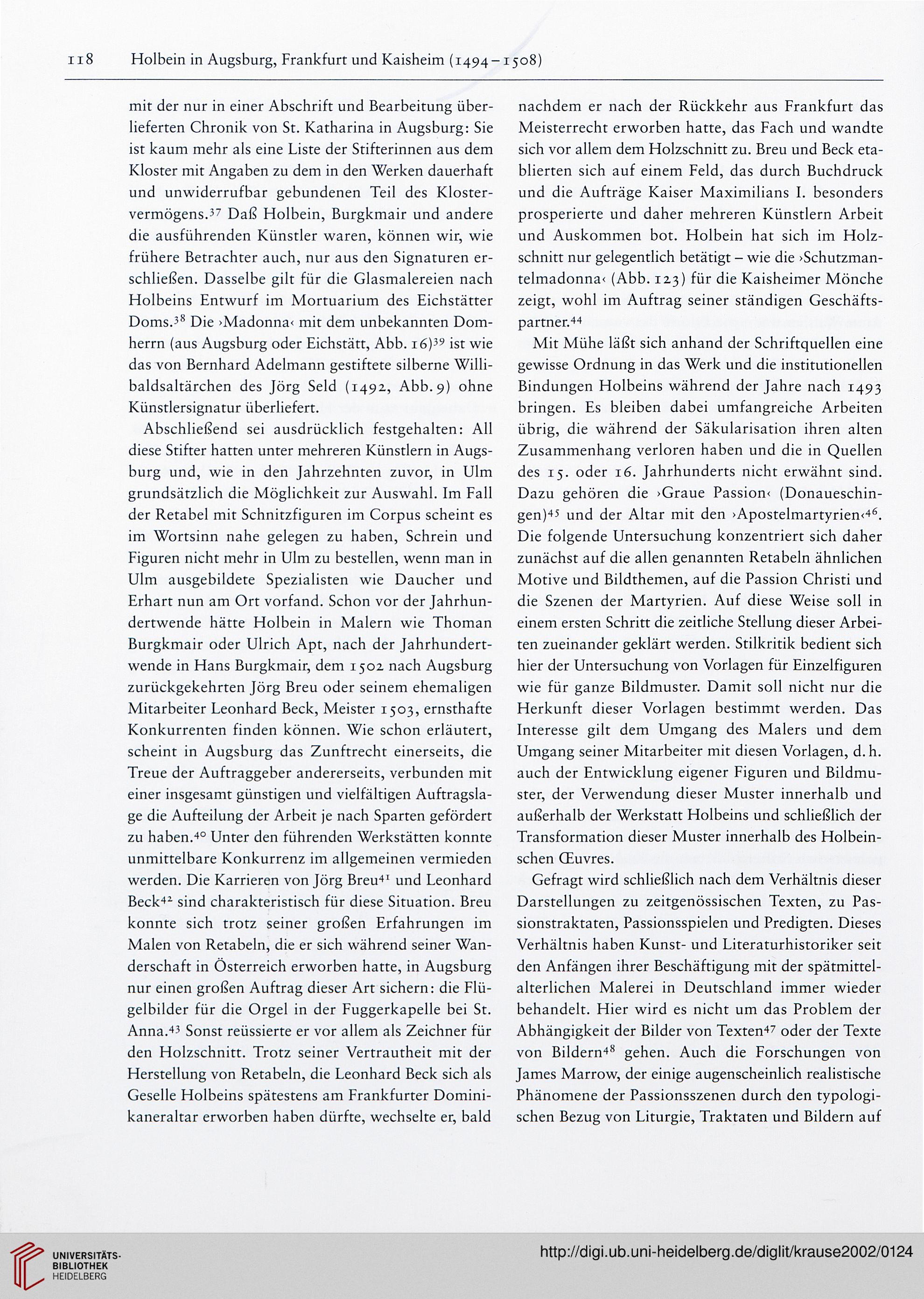118 Holbein in Augsburg, Frankfurt und Kaisheim (1494-1508)
mit der nur in einer Abschrift und Bearbeitung über-
lieferten Chronik von St. Katharina in Augsburg: Sie
ist kaum mehr als eine Liste der Stifterinnen aus dem
Kloster mit Angaben zu dem in den Werken dauerhaft
und unwiderrufbar gebundenen Teil des Kloster-
vermögens.'7 Daß Holbein, Burgkmair und andere
die ausführenden Künstler waren, können wir, wie
frühere Betrachter auch, nur aus den Signaturen er-
schließen. Dasselbe gilt für die Glasmalereien nach
Holbeins Entwurf im Mortuarium des Eichstätter
Doms.'8 Die >Madonna< mit dem unbekannten Dom-
herrn (aus Augsburg oder Eichstätt, Abb. i6)3s ist wie
das von Bernhard Adelmann gestiftete silberne Willi-
baldsaltärchen des Jörg Seid (1492, Abb. 9) ohne
Künstlersignatur überliefert.
Abschließend sei ausdrücklich festgehalten: All
diese Stifter hatten unter mehreren Künstlern in Augs-
burg und, wie in den Jahrzehnten zuvor, in Ulm
grundsätzlich die Möglichkeit zur Auswahl. Im Fall
der Retabel mit Schnitzfiguren im Corpus scheint es
im Wortsinn nahe gelegen zu haben, Schrein und
Figuren nicht mehr in Ulm zu bestellen, wenn man in
Ulm ausgebildete Spezialisten wie Daucher und
Erhart nun am Ort vorfand. Schon vor der Jahrhun-
dertwende hätte Holbein in Malern wie Thoman
Burgkmair oder Ulrich Apt, nach der Jahrhundert-
wende in Hans Burgkmair, dem 1502 nach Augsburg
zurückgekehrten Jörg Breu oder seinem ehemaligen
Mitarbeiter Leonhard Beck, Meister 1503, ernsthafte
Konkurrenten finden können. Wie schon erläutert,
scheint in Augsburg das Zunftrecht einerseits, die
Treue der Auftraggeber andererseits, verbunden mit
einer insgesamt günstigen und vielfältigen Auftragsla-
ge die Aufteilung der Arbeit je nach Sparten gefördert
zu haben.40 Unter den führenden Werkstätten konnte
unmittelbare Konkurrenz im allgemeinen vermieden
werden. Die Karrieren von Jörg Breu4' und Leonhard
Beck41 sind charakteristisch für diese Situation. Breu
konnte sich trotz seiner großen Erfahrungen im
Malen von Retabeln, die er sich während seiner Wan-
derschaft in Österreich erworben hatte, in Augsburg
nur einen großen Auftrag dieser Art sichern: die Flü-
gelbilder für die Orgel in der Fuggerkapelle bei St.
Anna.43 Sonst reüssierte er vor allem als Zeichner für
den Holzschnitt. Trotz seiner Vertrautheit mit der
Herstellung von Retabeln, die Leonhard Beck sich als
Geselle Holbeins spätestens am Frankfurter Domini-
kaneraltar erworben haben dürfte, wechselte er, bald
nachdem er nach der Rückkehr aus Frankfurt das
Meisterrecht erworben hatte, das Fach und wandte
sich vor allem dem Holzschnitt zu. Breu und Beck eta-
blierten sich auf einem Feld, das durch Buchdruck
und die Aufträge Kaiser Maximilians I. besonders
prosperierte und daher mehreren Künstlern Arbeit
und Auskommen bot. Holbein hat sich im Holz-
schnitt nur gelegentlich betätigt - wie die >Schutzman-
telmadonna< (Abb. 123) für die Kaisheimer Mönche
zeigt, wohl im Auftrag seiner ständigen Geschäfts-
partner.44
Mit Mühe läßt sich anhand der Schriftquellen eine
gewisse Ordnung in das Werk und die institutionellen
Bindungen Holbeins während der Jahre nach 1493
bringen. Es bleiben dabei umfangreiche Arbeiten
übrig, die während der Säkularisation ihren alten
Zusammenhang verloren haben und die in Quellen
des 15. oder 16. Jahrhunderts nicht erwähnt sind.
Dazu gehören die >Graue Passion< (Donaueschin-
gen)4' und der Altar mit den >Apostelmartyrien<46.
Die folgende Untersuchung konzentriert sich daher
zunächst auf die allen genannten Retabeln ähnlichen
Motive und Bildthemen, auf die Passion Christi und
die Szenen der Martyrien. Auf diese Weise soll in
einem ersten Schritt die zeitliche Stellung dieser Arbei-
ten zueinander geklärt werden. Stilkritik bedient sich
hier der Untersuchung von Vorlagen für Einzelfiguren
wie für ganze Bildmuster. Damit soll nicht nur die
Herkunft dieser Vorlagen bestimmt werden. Das
Interesse gilt dem Umgang des Malers und dem
Umgang seiner Mitarbeiter mit diesen Vorlagen, d. h.
auch der Entwicklung eigener Figuren und Bildmu-
ster, der Verwendung dieser Muster innerhalb und
außerhalb der Werkstatt Holbeins und schließlich der
Transformation dieser Muster innerhalb des Holbein-
schen (Euvres.
Gefragt wird schließlich nach dem Verhältnis dieser
Darstellungen zu zeitgenössischen Texten, zu Pas-
sionstraktaten, Passionsspielen und Predigten. Dieses
Verhältnis haben Kunst- und Literaturhistoriker seit
den Anfängen ihrer Beschäftigung mit der spätmittel-
alterlichen Malerei in Deutschland immer wieder
behandelt. Hier wird es nicht um das Problem der
Abhängigkeit der Bilder von Texten47 oder der Texte
von Bildern48 gehen. Auch die Forschungen von
James Marrow, der einige augenscheinlich realistische
Phänomene der Passionsszenen durch den typologi-
schen Bezug von Liturgie, Traktaten und Bildern auf
mit der nur in einer Abschrift und Bearbeitung über-
lieferten Chronik von St. Katharina in Augsburg: Sie
ist kaum mehr als eine Liste der Stifterinnen aus dem
Kloster mit Angaben zu dem in den Werken dauerhaft
und unwiderrufbar gebundenen Teil des Kloster-
vermögens.'7 Daß Holbein, Burgkmair und andere
die ausführenden Künstler waren, können wir, wie
frühere Betrachter auch, nur aus den Signaturen er-
schließen. Dasselbe gilt für die Glasmalereien nach
Holbeins Entwurf im Mortuarium des Eichstätter
Doms.'8 Die >Madonna< mit dem unbekannten Dom-
herrn (aus Augsburg oder Eichstätt, Abb. i6)3s ist wie
das von Bernhard Adelmann gestiftete silberne Willi-
baldsaltärchen des Jörg Seid (1492, Abb. 9) ohne
Künstlersignatur überliefert.
Abschließend sei ausdrücklich festgehalten: All
diese Stifter hatten unter mehreren Künstlern in Augs-
burg und, wie in den Jahrzehnten zuvor, in Ulm
grundsätzlich die Möglichkeit zur Auswahl. Im Fall
der Retabel mit Schnitzfiguren im Corpus scheint es
im Wortsinn nahe gelegen zu haben, Schrein und
Figuren nicht mehr in Ulm zu bestellen, wenn man in
Ulm ausgebildete Spezialisten wie Daucher und
Erhart nun am Ort vorfand. Schon vor der Jahrhun-
dertwende hätte Holbein in Malern wie Thoman
Burgkmair oder Ulrich Apt, nach der Jahrhundert-
wende in Hans Burgkmair, dem 1502 nach Augsburg
zurückgekehrten Jörg Breu oder seinem ehemaligen
Mitarbeiter Leonhard Beck, Meister 1503, ernsthafte
Konkurrenten finden können. Wie schon erläutert,
scheint in Augsburg das Zunftrecht einerseits, die
Treue der Auftraggeber andererseits, verbunden mit
einer insgesamt günstigen und vielfältigen Auftragsla-
ge die Aufteilung der Arbeit je nach Sparten gefördert
zu haben.40 Unter den führenden Werkstätten konnte
unmittelbare Konkurrenz im allgemeinen vermieden
werden. Die Karrieren von Jörg Breu4' und Leonhard
Beck41 sind charakteristisch für diese Situation. Breu
konnte sich trotz seiner großen Erfahrungen im
Malen von Retabeln, die er sich während seiner Wan-
derschaft in Österreich erworben hatte, in Augsburg
nur einen großen Auftrag dieser Art sichern: die Flü-
gelbilder für die Orgel in der Fuggerkapelle bei St.
Anna.43 Sonst reüssierte er vor allem als Zeichner für
den Holzschnitt. Trotz seiner Vertrautheit mit der
Herstellung von Retabeln, die Leonhard Beck sich als
Geselle Holbeins spätestens am Frankfurter Domini-
kaneraltar erworben haben dürfte, wechselte er, bald
nachdem er nach der Rückkehr aus Frankfurt das
Meisterrecht erworben hatte, das Fach und wandte
sich vor allem dem Holzschnitt zu. Breu und Beck eta-
blierten sich auf einem Feld, das durch Buchdruck
und die Aufträge Kaiser Maximilians I. besonders
prosperierte und daher mehreren Künstlern Arbeit
und Auskommen bot. Holbein hat sich im Holz-
schnitt nur gelegentlich betätigt - wie die >Schutzman-
telmadonna< (Abb. 123) für die Kaisheimer Mönche
zeigt, wohl im Auftrag seiner ständigen Geschäfts-
partner.44
Mit Mühe läßt sich anhand der Schriftquellen eine
gewisse Ordnung in das Werk und die institutionellen
Bindungen Holbeins während der Jahre nach 1493
bringen. Es bleiben dabei umfangreiche Arbeiten
übrig, die während der Säkularisation ihren alten
Zusammenhang verloren haben und die in Quellen
des 15. oder 16. Jahrhunderts nicht erwähnt sind.
Dazu gehören die >Graue Passion< (Donaueschin-
gen)4' und der Altar mit den >Apostelmartyrien<46.
Die folgende Untersuchung konzentriert sich daher
zunächst auf die allen genannten Retabeln ähnlichen
Motive und Bildthemen, auf die Passion Christi und
die Szenen der Martyrien. Auf diese Weise soll in
einem ersten Schritt die zeitliche Stellung dieser Arbei-
ten zueinander geklärt werden. Stilkritik bedient sich
hier der Untersuchung von Vorlagen für Einzelfiguren
wie für ganze Bildmuster. Damit soll nicht nur die
Herkunft dieser Vorlagen bestimmt werden. Das
Interesse gilt dem Umgang des Malers und dem
Umgang seiner Mitarbeiter mit diesen Vorlagen, d. h.
auch der Entwicklung eigener Figuren und Bildmu-
ster, der Verwendung dieser Muster innerhalb und
außerhalb der Werkstatt Holbeins und schließlich der
Transformation dieser Muster innerhalb des Holbein-
schen (Euvres.
Gefragt wird schließlich nach dem Verhältnis dieser
Darstellungen zu zeitgenössischen Texten, zu Pas-
sionstraktaten, Passionsspielen und Predigten. Dieses
Verhältnis haben Kunst- und Literaturhistoriker seit
den Anfängen ihrer Beschäftigung mit der spätmittel-
alterlichen Malerei in Deutschland immer wieder
behandelt. Hier wird es nicht um das Problem der
Abhängigkeit der Bilder von Texten47 oder der Texte
von Bildern48 gehen. Auch die Forschungen von
James Marrow, der einige augenscheinlich realistische
Phänomene der Passionsszenen durch den typologi-
schen Bezug von Liturgie, Traktaten und Bildern auf