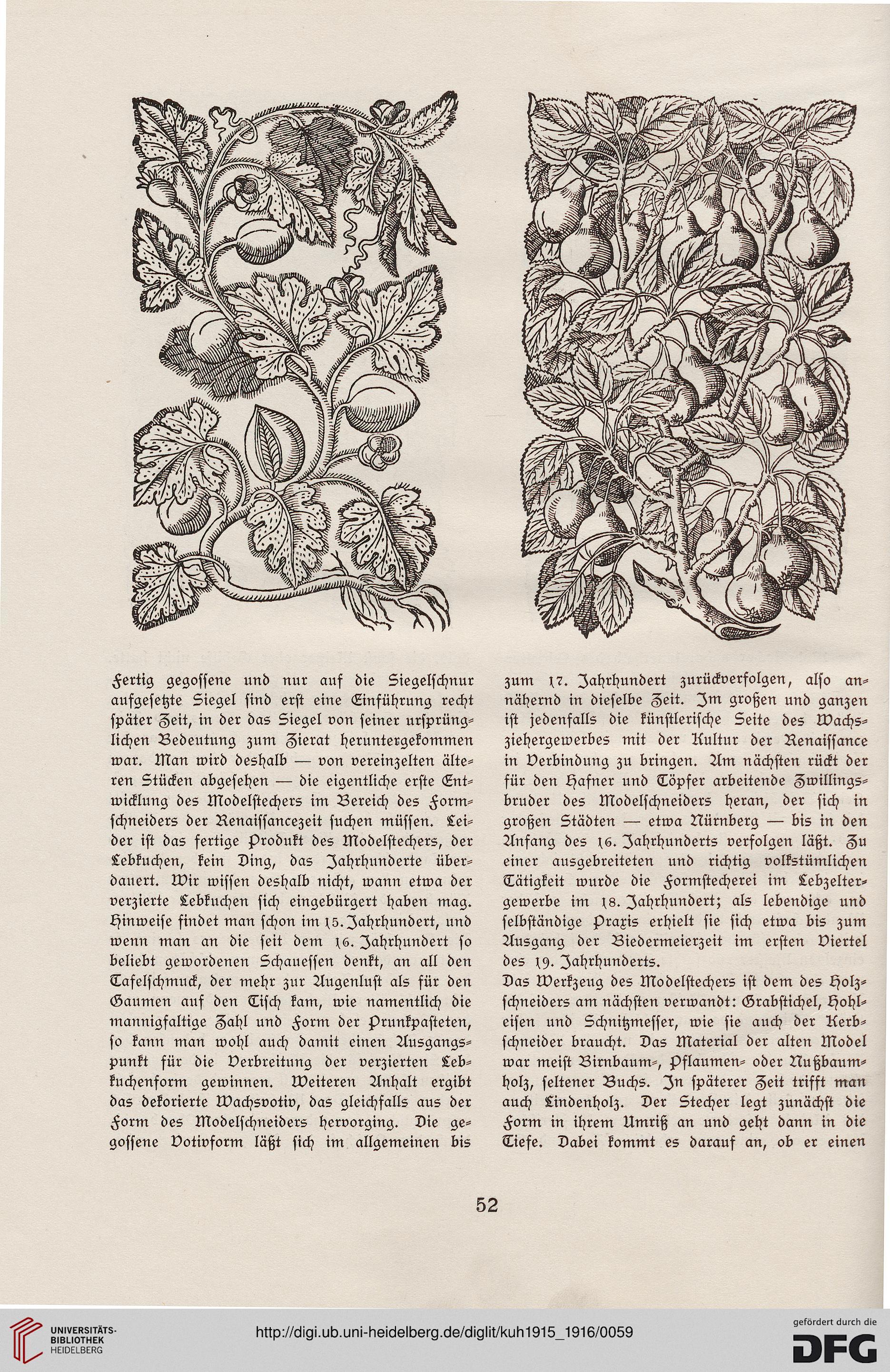Fertig gegossene und nur auf die Siegelschnur
aufgesetzte Siegel sind erst eine Einführung recht
später Zeit, in der das Siegel von seiner ursprüng-
lichen Bedeutung zum Zierat heruntergekommen
war. Man wird deshalb — von vereinzelten älte-
ren Stücken abgesehen — die eigentliche erste Ent-
wicklung des Modelstechers im Bereich des Form-
schneiders der Renaissancezeit suchen müssen. Lei-
der ist das fertige Produkt des Modelstechers, der
Lebkuchen, kein Ding, das Jahrhunderte über-
dauert. wir wissen deshalb nicht, wann etwa der
verzierte Lebkuchen sich eingebürgert haben mag.
Hinweise findet man schon im ^.Jahrhundert, und
wenn man an die seit dem t6. Jahrhundert so
beliebt gewordenen Schauessen denkt, an all den
Taselschmuck, der mehr zur Augenlust als für den
Gaumen auf den Tisch kam, wie namentlich die
inaunigfaltige Zahl und Form der Prunkpasteten,
so kann man wohl auch damit einen Ausgangs-
punkt für die Verbreitung der verzierten Leb-
kuchenform gewinnen, weiteren Anhalt ergibt
das dekorierte wachsvotiv, das gleichfalls aus der
Form des Modelschneiders hervorging. Die ge-
gossene Votivform läßt sich im allgemeinen bis
zum \7. Jahrhundert zurückverfolgen, also an-
nähernd in dieselbe Zeit. Im großen und ganzen
ist jedenfalls die künstlerische Seite des wachs-
ziehergewerbes mit der Kultur der Renaissance
in Verbindung zu bringen. Am nächsten rückt der
für den pafner und Töpfer arbeitende Zwillings-
bruder des Modelschneiders heran, der sich in
großen Städten — etwa Nürnberg — bis in den
Anfang des ;6. Jahrhunderts verfolgen läßt. Zu
einer ausgebreiteten und richtig volkstümlichen
Tätigkeit wurde die Formstecherei im Lebzelter-
gewerbe im t8. Jahrhundert; als lebendige und
selbständige Praxis erhielt sie sich etwa bis zum
Ausgang der Biedermeierzeit im ersten viertel
des zy. Jahrhunderts.
Das Werkzeug des Modelstechers ist dem des Holz-
schneiders am nächsten verwandt: Grabstichel, Hohl-
eisen und Schnitzmesser, wie sie auch der Kerb-
schneider braucht. Das Material der alten Model
war meist Birnbaum-, Pflaumen- oder Nußbaum-
holz, seltener Buchs. In späterer Zeit trifft man
auch Lindenholz. Der Stecher legt zunächst die
Form in ihrem Umriß an und geht dann in die
Tiefe. Dabei kommt es darauf an, ob er einen
52
aufgesetzte Siegel sind erst eine Einführung recht
später Zeit, in der das Siegel von seiner ursprüng-
lichen Bedeutung zum Zierat heruntergekommen
war. Man wird deshalb — von vereinzelten älte-
ren Stücken abgesehen — die eigentliche erste Ent-
wicklung des Modelstechers im Bereich des Form-
schneiders der Renaissancezeit suchen müssen. Lei-
der ist das fertige Produkt des Modelstechers, der
Lebkuchen, kein Ding, das Jahrhunderte über-
dauert. wir wissen deshalb nicht, wann etwa der
verzierte Lebkuchen sich eingebürgert haben mag.
Hinweise findet man schon im ^.Jahrhundert, und
wenn man an die seit dem t6. Jahrhundert so
beliebt gewordenen Schauessen denkt, an all den
Taselschmuck, der mehr zur Augenlust als für den
Gaumen auf den Tisch kam, wie namentlich die
inaunigfaltige Zahl und Form der Prunkpasteten,
so kann man wohl auch damit einen Ausgangs-
punkt für die Verbreitung der verzierten Leb-
kuchenform gewinnen, weiteren Anhalt ergibt
das dekorierte wachsvotiv, das gleichfalls aus der
Form des Modelschneiders hervorging. Die ge-
gossene Votivform läßt sich im allgemeinen bis
zum \7. Jahrhundert zurückverfolgen, also an-
nähernd in dieselbe Zeit. Im großen und ganzen
ist jedenfalls die künstlerische Seite des wachs-
ziehergewerbes mit der Kultur der Renaissance
in Verbindung zu bringen. Am nächsten rückt der
für den pafner und Töpfer arbeitende Zwillings-
bruder des Modelschneiders heran, der sich in
großen Städten — etwa Nürnberg — bis in den
Anfang des ;6. Jahrhunderts verfolgen läßt. Zu
einer ausgebreiteten und richtig volkstümlichen
Tätigkeit wurde die Formstecherei im Lebzelter-
gewerbe im t8. Jahrhundert; als lebendige und
selbständige Praxis erhielt sie sich etwa bis zum
Ausgang der Biedermeierzeit im ersten viertel
des zy. Jahrhunderts.
Das Werkzeug des Modelstechers ist dem des Holz-
schneiders am nächsten verwandt: Grabstichel, Hohl-
eisen und Schnitzmesser, wie sie auch der Kerb-
schneider braucht. Das Material der alten Model
war meist Birnbaum-, Pflaumen- oder Nußbaum-
holz, seltener Buchs. In späterer Zeit trifft man
auch Lindenholz. Der Stecher legt zunächst die
Form in ihrem Umriß an und geht dann in die
Tiefe. Dabei kommt es darauf an, ob er einen
52