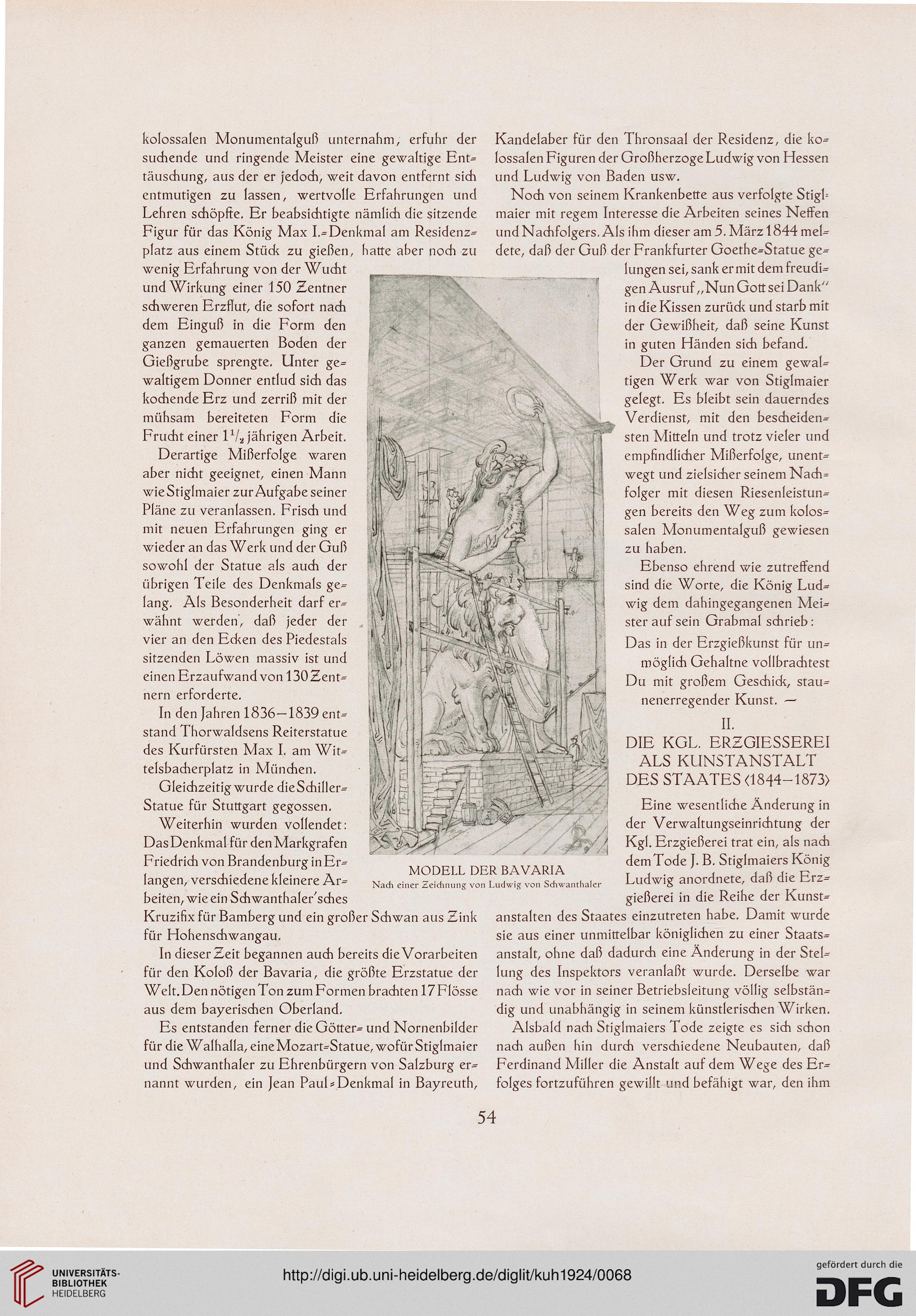kolossalen Monumentalguß unternahm, erfuhr der
suchende und ringende Meister eine gewaltige Ent»
täuschung, aus der er jedoch, weit davon entfernt sich
entmutigen zu lassen, wertvolle Erfahrungen und
Lehren schöpfte. Er beabsichtigte nämlich die sitzende
Figur für das König Max I.»Denkmal am Residenz»
platz aus einem Stück zu gießen, hatte aber noch zu
wenig Erfahrung von der Wucht
und Wirkung einer 150 Zentner
schweren Erzflut, die sofort nach
dem Einguß in die Form den
ganzen gemauerten Boden der
Gießgrube sprengte. Linter ge-
waltigem Donner entlud sich das
kochende Erz und zerriß mit der
mühsam bereiteten Form die
Frucht einer 1V2 jährigen Arbeit.
Derartige Mißerfolge waren
aber nicht geeignet, einen Mann
wieStiglmaier zur Aufgabe seiner
Pläne zu veranlassen. Frisch und
mit neuen Erfahrungen ging er
wieder an das Werk und der Guß
sowohl der Statue als auch der
übrigen Teile des Denkmals ge-
lang. Als Besonderheit darf er»
wähnt werden, daß jeder der
vier an den Ecken des Piedestals
sitzenden Löwen massiv ist und
einen Erzaufwand von 130Zent»
nern erforderte.
In den Jahren 1836—1839 ent»
stand Thorwaldsens Reiterstatue
des Kurfürsten Max I. am Wit»
telsbacherplatz in München.
Gleichzeitig wurde dieSchiller»
Statue für Stuttgart gegossen.
Weiterhin wurden vollendet:
Das Denkmal für den Markgrafen
Friedrich von Brandenburg in Er»
langen, verschiedene kleinere Ar»
beiten, wie ein Sehwanthaler'sches
Kruzifix für Bamberg und ein großer Schwan aus Zink
für Hohenschwangau.
In dieser Zeit begannen auch bereits die Vorarbeiten
für den Koloß der Bavaria, die größte Erzstatue der
Welt. Den nötigen Ton zum Formen braditen 17 Flösse
aus dem bayerischen Oberland.
Es entstanden ferner die Götter» und Nornenbilder
für die Walhalla, eineMozart=Statue, wofür Stiglmaier
und Schwanthaler zu Ehrenbürgern von Salzburg er»
nannt wurden, ein Jean Paul «Denkmal in Bayreuth,
MODELL DER BAVARIA
Nach einer Zeichnung von Ludwig von Schwanthaler
Kandelaber für den Thronsaal der Residenz, die ko-
lossalen Figuren der Großherzoge Ludwig von Hessen
und Ludwig von Baden usw.
Noch von seinem Krankenbette aus verfolgte Stigl-
maier mit regem Interesse die Arbeiten seines Neffen
und Nachfolgers. Als ihm dieser am 5. März 1844 mel»
dete, daß der Guß der Frankfurter Goethe=Statue ge»
lungen sei, sank er mit dem freudi»
gen Ausruf „Nun Gott sei Dank"
in die Kissen zurück und starb mit
der Gewißheit, daß seine Kunst
in guten Händen sich befand.
Der Grund zu einem gewal»
tigen Werk war von Stiglmaier
gelegt. Es bleibt sein dauerndes
Verdienst, mit den bescheiden»
sten Mitteln und trotz vieler und
empfindlicher Mißerfolge, unent»
wegt und zielsicher seinem Nach»
folger mit diesen Riesenleistun»
gen bereits den Weg zum kolos»
salen Monumentalguß gewiesen
zu haben.
Ebenso ehrend wie zutreffend
sind die Worte, die König Lud»
wig dem dahingegangenen Mei»
ster auf sein Grabmal schrieb:
Das in der Erzgießkunst für un»
möglidi Gehaltne vollbrachtest
Du mit großem Geschick, stau»
nenerregender Kunst. —
II.
DIE KGL. ERZGIESSEREI
ALS KUNSTANSTALT
DES STAATES (1844-1873)
Eine wesentliche Änderung in
der Verwaltungseinrichtung der
Kgl. Erzgießerei trat ein, als nach
dem Tode J. B. Stiglmaiers König
Ludwig anordnete, daß die Erz»
gießerei in die Reihe der Kunst»
anstalten des Staates einzutreten habe. Damit wurde
sie aus einer unmittelbar königlichen zu einer Staats»
anstalt, ohne daß dadurch eine Änderung in der Stel»
lung des Inspektors veranlaßt wurde. Derselbe war
nach wie vor in seiner Betriebsleitung völlig selbstän»
dig und unabhängig in seinem künstlerischen Wirken.
Alsbald nach Stiglmaiers Tode zeigte es sich schon
nach außen hin durch verschiedene Neubauten, daß
Ferdinand Miller die Anstalt auf dem Wege des Er»
folges fortzuführen gewillt und befähigt war, den ihm
54
suchende und ringende Meister eine gewaltige Ent»
täuschung, aus der er jedoch, weit davon entfernt sich
entmutigen zu lassen, wertvolle Erfahrungen und
Lehren schöpfte. Er beabsichtigte nämlich die sitzende
Figur für das König Max I.»Denkmal am Residenz»
platz aus einem Stück zu gießen, hatte aber noch zu
wenig Erfahrung von der Wucht
und Wirkung einer 150 Zentner
schweren Erzflut, die sofort nach
dem Einguß in die Form den
ganzen gemauerten Boden der
Gießgrube sprengte. Linter ge-
waltigem Donner entlud sich das
kochende Erz und zerriß mit der
mühsam bereiteten Form die
Frucht einer 1V2 jährigen Arbeit.
Derartige Mißerfolge waren
aber nicht geeignet, einen Mann
wieStiglmaier zur Aufgabe seiner
Pläne zu veranlassen. Frisch und
mit neuen Erfahrungen ging er
wieder an das Werk und der Guß
sowohl der Statue als auch der
übrigen Teile des Denkmals ge-
lang. Als Besonderheit darf er»
wähnt werden, daß jeder der
vier an den Ecken des Piedestals
sitzenden Löwen massiv ist und
einen Erzaufwand von 130Zent»
nern erforderte.
In den Jahren 1836—1839 ent»
stand Thorwaldsens Reiterstatue
des Kurfürsten Max I. am Wit»
telsbacherplatz in München.
Gleichzeitig wurde dieSchiller»
Statue für Stuttgart gegossen.
Weiterhin wurden vollendet:
Das Denkmal für den Markgrafen
Friedrich von Brandenburg in Er»
langen, verschiedene kleinere Ar»
beiten, wie ein Sehwanthaler'sches
Kruzifix für Bamberg und ein großer Schwan aus Zink
für Hohenschwangau.
In dieser Zeit begannen auch bereits die Vorarbeiten
für den Koloß der Bavaria, die größte Erzstatue der
Welt. Den nötigen Ton zum Formen braditen 17 Flösse
aus dem bayerischen Oberland.
Es entstanden ferner die Götter» und Nornenbilder
für die Walhalla, eineMozart=Statue, wofür Stiglmaier
und Schwanthaler zu Ehrenbürgern von Salzburg er»
nannt wurden, ein Jean Paul «Denkmal in Bayreuth,
MODELL DER BAVARIA
Nach einer Zeichnung von Ludwig von Schwanthaler
Kandelaber für den Thronsaal der Residenz, die ko-
lossalen Figuren der Großherzoge Ludwig von Hessen
und Ludwig von Baden usw.
Noch von seinem Krankenbette aus verfolgte Stigl-
maier mit regem Interesse die Arbeiten seines Neffen
und Nachfolgers. Als ihm dieser am 5. März 1844 mel»
dete, daß der Guß der Frankfurter Goethe=Statue ge»
lungen sei, sank er mit dem freudi»
gen Ausruf „Nun Gott sei Dank"
in die Kissen zurück und starb mit
der Gewißheit, daß seine Kunst
in guten Händen sich befand.
Der Grund zu einem gewal»
tigen Werk war von Stiglmaier
gelegt. Es bleibt sein dauerndes
Verdienst, mit den bescheiden»
sten Mitteln und trotz vieler und
empfindlicher Mißerfolge, unent»
wegt und zielsicher seinem Nach»
folger mit diesen Riesenleistun»
gen bereits den Weg zum kolos»
salen Monumentalguß gewiesen
zu haben.
Ebenso ehrend wie zutreffend
sind die Worte, die König Lud»
wig dem dahingegangenen Mei»
ster auf sein Grabmal schrieb:
Das in der Erzgießkunst für un»
möglidi Gehaltne vollbrachtest
Du mit großem Geschick, stau»
nenerregender Kunst. —
II.
DIE KGL. ERZGIESSEREI
ALS KUNSTANSTALT
DES STAATES (1844-1873)
Eine wesentliche Änderung in
der Verwaltungseinrichtung der
Kgl. Erzgießerei trat ein, als nach
dem Tode J. B. Stiglmaiers König
Ludwig anordnete, daß die Erz»
gießerei in die Reihe der Kunst»
anstalten des Staates einzutreten habe. Damit wurde
sie aus einer unmittelbar königlichen zu einer Staats»
anstalt, ohne daß dadurch eine Änderung in der Stel»
lung des Inspektors veranlaßt wurde. Derselbe war
nach wie vor in seiner Betriebsleitung völlig selbstän»
dig und unabhängig in seinem künstlerischen Wirken.
Alsbald nach Stiglmaiers Tode zeigte es sich schon
nach außen hin durch verschiedene Neubauten, daß
Ferdinand Miller die Anstalt auf dem Wege des Er»
folges fortzuführen gewillt und befähigt war, den ihm
54