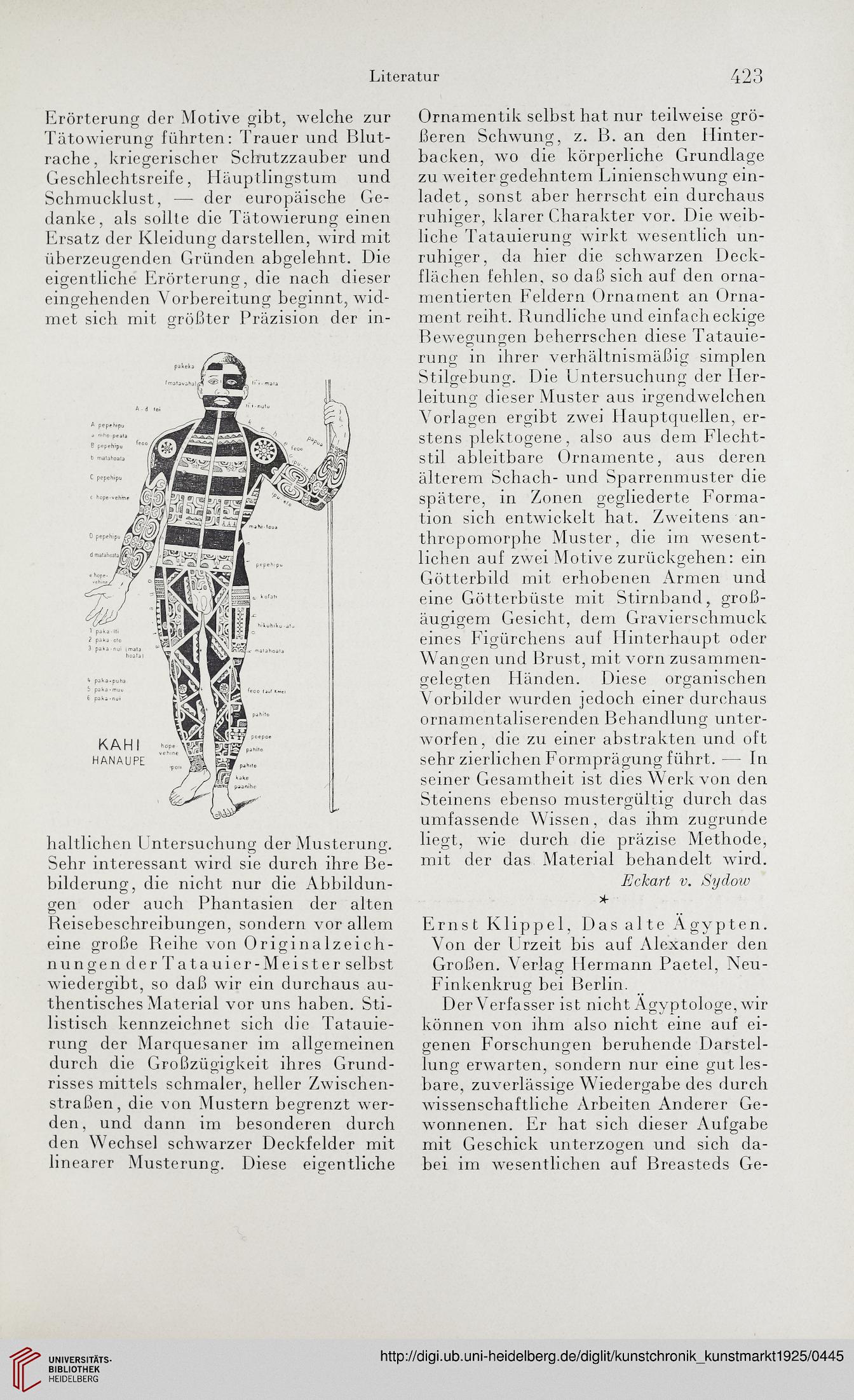Literatur
423
Erörterung der Motive gibt, welche zur
Tätowierung führten: Trauer und Blut-
rache , kriegerischer Schutzzauber und
Geschlechtsreife, Häuptlingstum und
Schmucklust, — der europäische Ge-
danke, als sollte die Tätowierung einen
Ersatz der Kleidung darstellen, wird mit
überzeugenden Gründen abgelehnt. Die
eigentliche Erörterung, die nach dieser
eingehenden Vorbereitung beginnt, wid-
met sich mit größter Präzision der in-
haltlichen Untersuchung der Musterung.
Sehr interessant wird sie durch ihre Be-
bilderung, die nicht nur die Abbildun-
gen oder auch Phantasien der alten
Beisebeschreibungen, sondern vor allem
eine große Beihe von Originalzeich-
nungen derTatauier-Meister selbst
wiedergibt, so daß wir ein durchaus au-
thentisches Material vor uns haben. Sti-
listisch kennzeichnet sich die Tatauie-
rung der Marcjuesaner im allgemeinen
durch die Großzügigkeit ihres Grund-
risses mittels schmaler, heller Zwischen-
straßen, die von Mustern begrenzt wer-
den, und dann im besonderen durch
den Wechsel schwarzer Deckfelder mit
linearer Musterung. Diese eigentliche
Ornamentik selbst hat nur teilweise grö-
ßeren Schwung, z. B. an den Hinter-
backen, wo die körperliche Grundlage
zu weiter gedehntem Linienschwung ein-
ladet, sonst aber herrscht ein durchaus
ruhiger, klarer Charakter vor. Die weib-
liche Tatauierung wirkt wesentlich un-
ruhiger, da hier die schwarzen Deck-
flächen fehlen, so daß sich auf den orna-
mentierten Feldern Ornament an Orna-
ment reiht. Bundliche und einfach eckige
Bewegungen beherrschen diese Tatauie-
rung in ihrer verhältnismäßig simplen
Stilgebung. Die Untersuchung der Her-
leitung dieser Muster aus irgendwelchen
Vorlagen ergibt zwei Hauptquellen, er-
stens plektogene, also aus dem Flecht-
stil ableitbare Ornamente, aus deren
älterem Schach- und Sparrenmuster die
spätere, in Zonen gegliederte Forma-
tion sich entwickelt hat. Zweitens an-
thropomorphe Muster, die im wesent-
lichen auf zwei Motive zurückgehen: ein
Götterbild mit erhobenen x4rmen und
eine Götterbüste mit Stirnband, groß-
äugigem Gesicht, dem Gravierschmuck
eines Figürchens auf Hinterhaupt oder
Wangen und Brust, mit vorn zusammen-
gelegten Händen. Diese organischen
Vorbilder wurden jedoch einer durchaus
ornamentaliserenden Behandlung unter-
worfen, die zu einer abstrakten und oft
sehr zierlichen Formprägung führt. — In
seiner Gesamtheit ist dies Werk von den
Steinens ebenso mustergültig durch das
umfassende Wissen, das ihm zugrunde
liegt, wie durch die präzise Methode,
mit der das Material behandelt wird.
Eckart v. Sydoiv
*
Ernst Klippel, Das alte Ägypten.
Von der Urzeit bis auf Alexander den
Großen. Verlag Hermann Paetel, Neu-
Finkenkrug bei Berlin.
Der Verfasser ist nicht Ägyptologe, wir
können von ihm also nicht eine auf ei-
genen Forschungen beruhende Darstel-
lung erwarten, sondern nur eine gut les-
bare, zuverlässige Wiedergabe des durch
wissenschaftliche Arbeiten Anderer Ge-
wonnenen. Er hat sich dieser Aufgabe
mit Geschick unterzogen und sich da-
bei im wesentlichen auf Breasteds Ge-
423
Erörterung der Motive gibt, welche zur
Tätowierung führten: Trauer und Blut-
rache , kriegerischer Schutzzauber und
Geschlechtsreife, Häuptlingstum und
Schmucklust, — der europäische Ge-
danke, als sollte die Tätowierung einen
Ersatz der Kleidung darstellen, wird mit
überzeugenden Gründen abgelehnt. Die
eigentliche Erörterung, die nach dieser
eingehenden Vorbereitung beginnt, wid-
met sich mit größter Präzision der in-
haltlichen Untersuchung der Musterung.
Sehr interessant wird sie durch ihre Be-
bilderung, die nicht nur die Abbildun-
gen oder auch Phantasien der alten
Beisebeschreibungen, sondern vor allem
eine große Beihe von Originalzeich-
nungen derTatauier-Meister selbst
wiedergibt, so daß wir ein durchaus au-
thentisches Material vor uns haben. Sti-
listisch kennzeichnet sich die Tatauie-
rung der Marcjuesaner im allgemeinen
durch die Großzügigkeit ihres Grund-
risses mittels schmaler, heller Zwischen-
straßen, die von Mustern begrenzt wer-
den, und dann im besonderen durch
den Wechsel schwarzer Deckfelder mit
linearer Musterung. Diese eigentliche
Ornamentik selbst hat nur teilweise grö-
ßeren Schwung, z. B. an den Hinter-
backen, wo die körperliche Grundlage
zu weiter gedehntem Linienschwung ein-
ladet, sonst aber herrscht ein durchaus
ruhiger, klarer Charakter vor. Die weib-
liche Tatauierung wirkt wesentlich un-
ruhiger, da hier die schwarzen Deck-
flächen fehlen, so daß sich auf den orna-
mentierten Feldern Ornament an Orna-
ment reiht. Bundliche und einfach eckige
Bewegungen beherrschen diese Tatauie-
rung in ihrer verhältnismäßig simplen
Stilgebung. Die Untersuchung der Her-
leitung dieser Muster aus irgendwelchen
Vorlagen ergibt zwei Hauptquellen, er-
stens plektogene, also aus dem Flecht-
stil ableitbare Ornamente, aus deren
älterem Schach- und Sparrenmuster die
spätere, in Zonen gegliederte Forma-
tion sich entwickelt hat. Zweitens an-
thropomorphe Muster, die im wesent-
lichen auf zwei Motive zurückgehen: ein
Götterbild mit erhobenen x4rmen und
eine Götterbüste mit Stirnband, groß-
äugigem Gesicht, dem Gravierschmuck
eines Figürchens auf Hinterhaupt oder
Wangen und Brust, mit vorn zusammen-
gelegten Händen. Diese organischen
Vorbilder wurden jedoch einer durchaus
ornamentaliserenden Behandlung unter-
worfen, die zu einer abstrakten und oft
sehr zierlichen Formprägung führt. — In
seiner Gesamtheit ist dies Werk von den
Steinens ebenso mustergültig durch das
umfassende Wissen, das ihm zugrunde
liegt, wie durch die präzise Methode,
mit der das Material behandelt wird.
Eckart v. Sydoiv
*
Ernst Klippel, Das alte Ägypten.
Von der Urzeit bis auf Alexander den
Großen. Verlag Hermann Paetel, Neu-
Finkenkrug bei Berlin.
Der Verfasser ist nicht Ägyptologe, wir
können von ihm also nicht eine auf ei-
genen Forschungen beruhende Darstel-
lung erwarten, sondern nur eine gut les-
bare, zuverlässige Wiedergabe des durch
wissenschaftliche Arbeiten Anderer Ge-
wonnenen. Er hat sich dieser Aufgabe
mit Geschick unterzogen und sich da-
bei im wesentlichen auf Breasteds Ge-