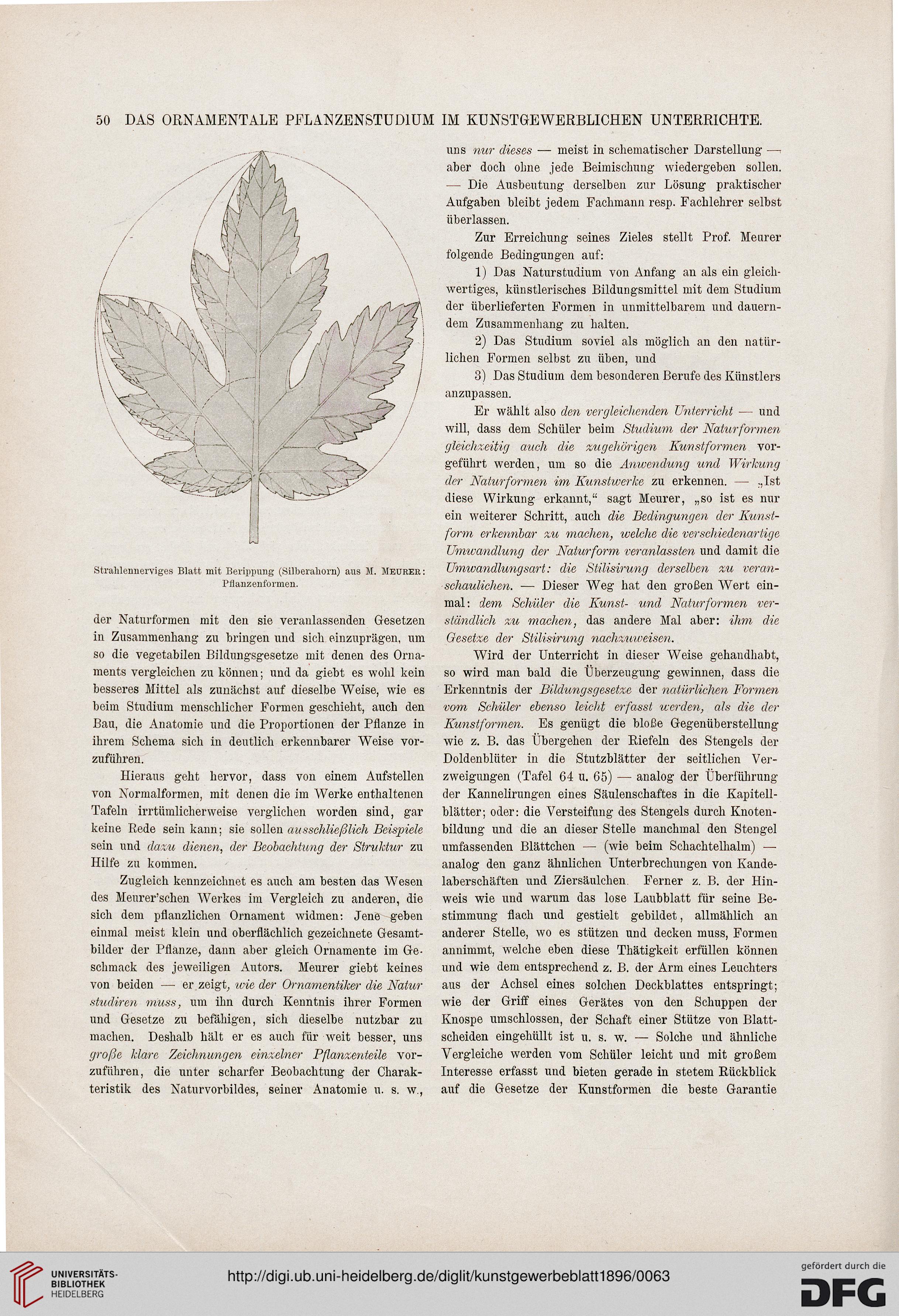50 DAS ORNAMENTALE PFLANZENSTUDIUM IM KUNSTGEWERBLICHEN UNTERRICHTE.
Stralileimerviges Blatt mit Berippung (Silberahorn) aus M. Meurer:
Pflanzeuformeii.
der Naturformen mit den sie veranlassenden Gesetzen
in Zusammenhang zu bringen und sich einzuprägen, um
so die vegetabilen Bildungsgesetze mit denen des Orna-
ments vergleichen zu können; und da giebt es wohl kein
besseres Mittel als zunächst auf dieselbe Weise, wie es
beim Studium menschlicher Formen geschieht, auch den
Bau, die Anatomie und die Proportionen der Pflanze in
ihrem Schema sich in deutlich erkennbarer Weise vor-
zuführen.
Hieraus geht hervor, dass von einem Aufstellen
von Normalformen, mit denen die im Werke enthaltenen
Tafeln irrtümlicherweise verglichen worden sind, gar
keine Bede sein kann; sie sollen ausschließlich Beispiele
sein und dazu dienen, der Beobachtung der Struktur zu
Hilfe zu kommen.
Zugleich kennzeichnet es auch am besten das Wesen
des Meurer'schen Werkes im Vergleich zu anderen, die
sich dem pflanzlichen Ornament widmen: Jene geben
einmal meist klein und oberflächlich gezeichnete Gesamt-
bilder der Pflanze, dann aber gleich Ornamente im Ge-
schmack des jeweiligen Autors. Meurer giebt keines
von beiden — er zeigt, -wie der Ornamentiker die Natur
studiren muss, um ihn durch Kenntnis ihrer Formen
und Gesetze zu befähigen, sich dieselbe nutzbar zu
machen. Deshalb hält er es auch für weit besser, uns
große klare Zeichnungen einzelner Pflanzenteile vor-
zuführen, die unter scharfer Beobachtung der Charak-
teristik des Naturvorbildes, seiner Anatomie u. s. w.,
uns nur dieses — meist in schematischer Darstellung —
aber doch ohne jede Beimischung wiedergeben sollen.
— Die Ausbeutung derselben zur Lösung praktischer
Aufgaben bleibt jedem Fachmann resp. Fachlehrer selbst
überlassen.
Zur Erreichung seines Zieles stellt Prof. Meurer
folgende Bedingungen auf:
1) Das Naturstudium von Anfang an als ein gleich-
wertiges, künstlerisches Bildungsmittel mit dem Studium
der überlieferten Formen in unmittelbarem und dauern-
dem Zusammenhang zu halten.
2) Das Studium soviel als möglich an den natür-
lichen Formen selbst zu üben, und
3) Das Studium dem besonderen Berufe des Künstlers
anzupassen.
Er wählt also den vergleichenden Unterricht — und
will, dass dem Schüler beim Studium der Naturformen
gleichzeitig auch die zugehörigen Kunstformen vor-
geführt werden, um so die Anwendung und Wirkung
der Naturformen im Kunstwerke zu erkennen. — „Ist
diese Wirkung erkannt," sagt Meurer, „so ist es nur
ein weiterer Schritt, auch die Bedingungen der Kunst-
form erkennbar zu machen, welche die verschiedenartige
Umwandlung der Naturform veranlassten und damit die
Umwandlungsart: die Stilisirung derselben zu veran-
schaulichm. — Dieser Weg hat den großen Wert ein-
mal: dem Schüler die Kunst- und Naturformen ver-
ständlich zu machen, das andere Mal aber: ihm die
Gesetze der Stilisirung nachzuweisen.
Wird der Unterricht in dieser Weise gehandhabt,
so wird man bald die Überzeugung gewinnen, dass die
Erkenntnis der Bildungsgesetze der natürlichen Formen
vom Schüler ebenso leicht erfasst werden, als die der
Kunstformen. Es genügt die bloße Gegenüberstellung
wie z. B. das Übergehen der Riefeln des Stengels der
Doldenblüter in die Stutzblätter der seitlichen Ver-
zweigungen (Tafel 64 u. 65) — analog der Überführung
der Kannelirungen eines Säulenschaftes in die Kapitell-
blätter; oder: die Versteifung des Stengels durch Knoten-
bildung und die an dieser Stelle manchmal den Stengel
umfassenden Blättchen — (wie beim Schachtelhalm) —
analog den ganz ähnlichen Unterbrechungen von Kande-
laberschäften und Ziersäulchen. Ferner z. B. der Hin-
weis wie und warum das lose Laubblatt für seine Be-
stimmung flach und gestielt gebildet, allmählich an
anderer Stelle, wo es stützen und decken muss, Formen
annimmt, welche eben diese Thätigkeit erfüllen können
und wie dem entsprechend z. B. der Arm eines Leuchters
aus der Achsel eines solchen Deckblattes entspringt;
wie der Griff eines Gerätes von den Schuppen der
Knospe umschlossen, der Schaft einer Stütze von Blatt-
scheiden eingehüllt ist u. s. w. — Solche und ähnliche
Vergleiche werden vom Schüler leicht und mit großem
Interesse erfasst und bieten gerade in stetem Bückblick
auf die Gesetze der Kunstformen die beste Garantie
Stralileimerviges Blatt mit Berippung (Silberahorn) aus M. Meurer:
Pflanzeuformeii.
der Naturformen mit den sie veranlassenden Gesetzen
in Zusammenhang zu bringen und sich einzuprägen, um
so die vegetabilen Bildungsgesetze mit denen des Orna-
ments vergleichen zu können; und da giebt es wohl kein
besseres Mittel als zunächst auf dieselbe Weise, wie es
beim Studium menschlicher Formen geschieht, auch den
Bau, die Anatomie und die Proportionen der Pflanze in
ihrem Schema sich in deutlich erkennbarer Weise vor-
zuführen.
Hieraus geht hervor, dass von einem Aufstellen
von Normalformen, mit denen die im Werke enthaltenen
Tafeln irrtümlicherweise verglichen worden sind, gar
keine Bede sein kann; sie sollen ausschließlich Beispiele
sein und dazu dienen, der Beobachtung der Struktur zu
Hilfe zu kommen.
Zugleich kennzeichnet es auch am besten das Wesen
des Meurer'schen Werkes im Vergleich zu anderen, die
sich dem pflanzlichen Ornament widmen: Jene geben
einmal meist klein und oberflächlich gezeichnete Gesamt-
bilder der Pflanze, dann aber gleich Ornamente im Ge-
schmack des jeweiligen Autors. Meurer giebt keines
von beiden — er zeigt, -wie der Ornamentiker die Natur
studiren muss, um ihn durch Kenntnis ihrer Formen
und Gesetze zu befähigen, sich dieselbe nutzbar zu
machen. Deshalb hält er es auch für weit besser, uns
große klare Zeichnungen einzelner Pflanzenteile vor-
zuführen, die unter scharfer Beobachtung der Charak-
teristik des Naturvorbildes, seiner Anatomie u. s. w.,
uns nur dieses — meist in schematischer Darstellung —
aber doch ohne jede Beimischung wiedergeben sollen.
— Die Ausbeutung derselben zur Lösung praktischer
Aufgaben bleibt jedem Fachmann resp. Fachlehrer selbst
überlassen.
Zur Erreichung seines Zieles stellt Prof. Meurer
folgende Bedingungen auf:
1) Das Naturstudium von Anfang an als ein gleich-
wertiges, künstlerisches Bildungsmittel mit dem Studium
der überlieferten Formen in unmittelbarem und dauern-
dem Zusammenhang zu halten.
2) Das Studium soviel als möglich an den natür-
lichen Formen selbst zu üben, und
3) Das Studium dem besonderen Berufe des Künstlers
anzupassen.
Er wählt also den vergleichenden Unterricht — und
will, dass dem Schüler beim Studium der Naturformen
gleichzeitig auch die zugehörigen Kunstformen vor-
geführt werden, um so die Anwendung und Wirkung
der Naturformen im Kunstwerke zu erkennen. — „Ist
diese Wirkung erkannt," sagt Meurer, „so ist es nur
ein weiterer Schritt, auch die Bedingungen der Kunst-
form erkennbar zu machen, welche die verschiedenartige
Umwandlung der Naturform veranlassten und damit die
Umwandlungsart: die Stilisirung derselben zu veran-
schaulichm. — Dieser Weg hat den großen Wert ein-
mal: dem Schüler die Kunst- und Naturformen ver-
ständlich zu machen, das andere Mal aber: ihm die
Gesetze der Stilisirung nachzuweisen.
Wird der Unterricht in dieser Weise gehandhabt,
so wird man bald die Überzeugung gewinnen, dass die
Erkenntnis der Bildungsgesetze der natürlichen Formen
vom Schüler ebenso leicht erfasst werden, als die der
Kunstformen. Es genügt die bloße Gegenüberstellung
wie z. B. das Übergehen der Riefeln des Stengels der
Doldenblüter in die Stutzblätter der seitlichen Ver-
zweigungen (Tafel 64 u. 65) — analog der Überführung
der Kannelirungen eines Säulenschaftes in die Kapitell-
blätter; oder: die Versteifung des Stengels durch Knoten-
bildung und die an dieser Stelle manchmal den Stengel
umfassenden Blättchen — (wie beim Schachtelhalm) —
analog den ganz ähnlichen Unterbrechungen von Kande-
laberschäften und Ziersäulchen. Ferner z. B. der Hin-
weis wie und warum das lose Laubblatt für seine Be-
stimmung flach und gestielt gebildet, allmählich an
anderer Stelle, wo es stützen und decken muss, Formen
annimmt, welche eben diese Thätigkeit erfüllen können
und wie dem entsprechend z. B. der Arm eines Leuchters
aus der Achsel eines solchen Deckblattes entspringt;
wie der Griff eines Gerätes von den Schuppen der
Knospe umschlossen, der Schaft einer Stütze von Blatt-
scheiden eingehüllt ist u. s. w. — Solche und ähnliche
Vergleiche werden vom Schüler leicht und mit großem
Interesse erfasst und bieten gerade in stetem Bückblick
auf die Gesetze der Kunstformen die beste Garantie