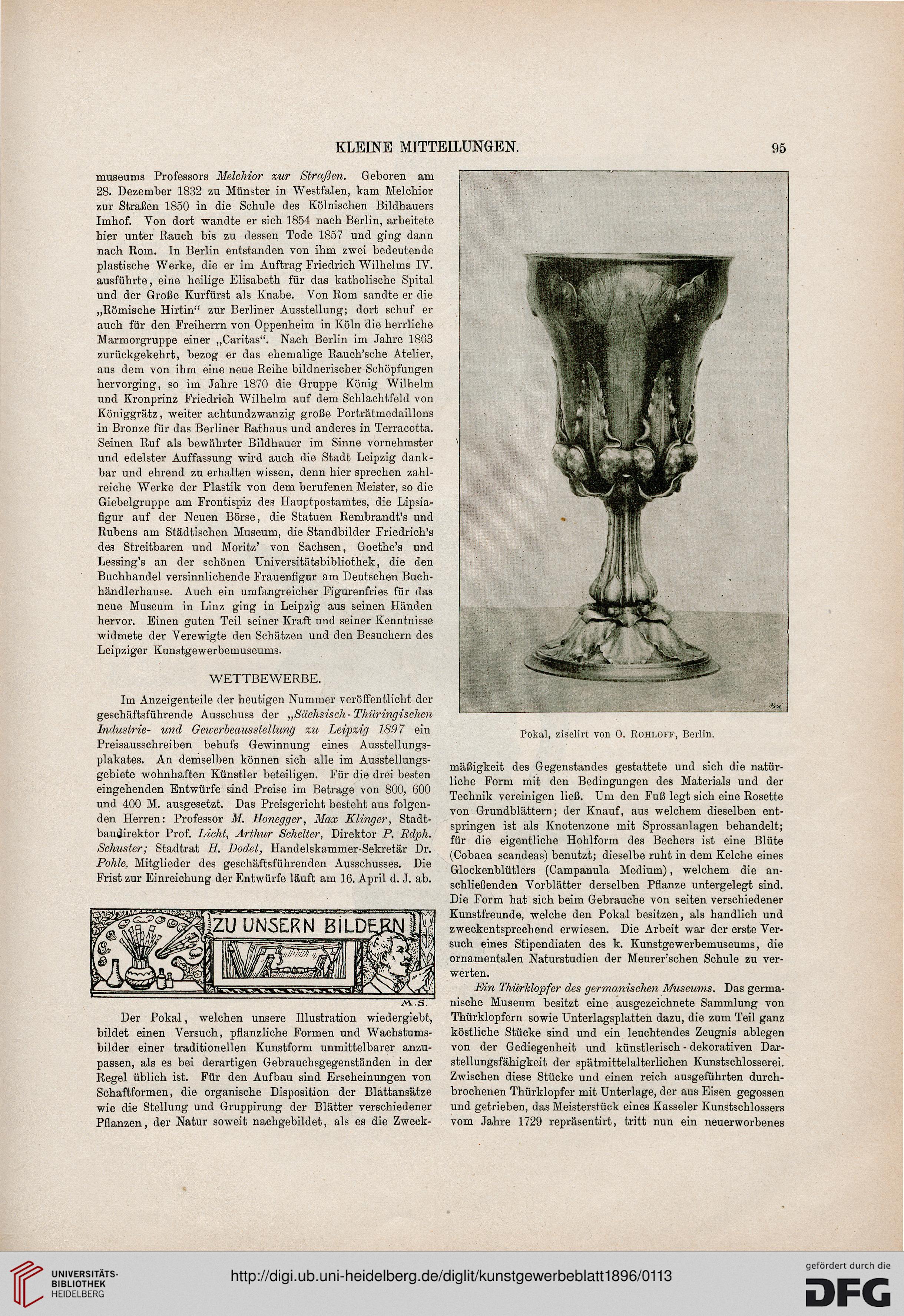KLEINE MITTEILUNGEN.
95
museums Professors Melchior zur Straßen. Geboren am
28. Dezember 1832 zu Münster in Westfalen, kam Melchior
zur Straßen 1850 in die Schule des Kölnischen Bildhauers
Imhof. Von dort wandte er sich 1854 nach Berlin, arbeitete
hier unter Rauch bis zu dessen Tode 1857 und ging dann
nach Rom. In Berlin entstanden von ihm zwei bedeutende
plastische Werke, die er im Auftrag Friedrich Wilhelms IV.
ausführte, eine heilige Elisabeth für das katholische Spital
und der Große Kurfürst als Knabe. Von Rom sandte er die
„Römische Hirtin" zur Berliner Ausstellung; dort schuf er
auch für den Freiherrn von Oppenheim in Köln die herrliche
Marmorgruppe einer „Caritas". Nach Berlin im Jahre 1863
zurückgekehrt, bezog er das ehemalige Rauch'sche Atelier,
aus dem von ihm eine neue Reihe bildnerischer Schöpfungen
hervorging, so im Ja,hre 1870 die Gruppe König Wilhelm
und Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Schlachtfeld von
Königgrätz, weiter achtundzwanzig große Porträtmedaillons
in Bronze für das Berliner Rathaus und anderes in Terracotta.
Seinen Ruf als bewährter Bildhauer im Sinne vornehmster
und edelster Auffassung wird auch die Stadt Leipzig dank-
bar und ehrend zu erhalten wissen, denn hier sprechen zahl-
reiche Werke der Plastik von dem berufenen Meister, so die
Giebelgruppe am Frontispiz des Hauptpostamtes, die Lipsia-
figur auf der Neuen Börse, die Statuen Rembrandt's und
Rubens am Städtischen Museum, die Standbilder Friedrich's
des Streitbaren und Moritz' von Sachsen, Goethe's und
Lessing's an der schönen Universitätsbibliothek, die den
Buchhandel versinnlichende Frauenflgur am Deutschen Buch-
händlerhause. Auch ein umfangreicher Figurenfries für das
neue Museum in Linz ging in Leipzig aus seinen Händen
hervor. Einen guten Teil seiner Kraft und seiner Kenntnisse
widmete der Verewigte den Schätzen und den Besuchern des
Leipziger Kunstgewerbemuseums.
WETTBEWERBE.
Im Anzeigenteile der heutigen Nummer veröffentlicht der
geschäftsführende Ausschuss der „Sächsisch-Thüringischen
Industrie- und Gciverbeaus Stellung zu Leipzig 1897 ein
Preisausschreiben behufs Gewinnung eines Ausstellungs-
plakates. An demselben können sich alle im Ausstellungs-
gebiete wohnhaften Künstler beteiligen. Für die drei besten
eingehenden Entwürfe sind Preise im Betrage von 800, 600
und 400 M. ausgesetzt. Das Preisgericht besteht aus folgen-
den Herren: Professor M. Honegger, Max Klinger, Stadt-
baudirektor Prof. Licht, Arthur Scheiter, Direktor P. lldph.
Schuster; Stadtrat IL Dodcl, Handelskammer-Sekretär Dr.
Pohle, Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses. Die
Frist zur Einreichung der Entwürfe läuft am 16. April d. J. ab.
Der Pokal, welchen unsere Illustration wiedergiebt,
bildet einen Versuch, pflanzliche Formen und Wachstums-
bilder einer traditionellen Kunstform unmittelbarer anzu-
passen, als es bei derartigen Gebrauchsgegenständen in der
Regel üblich ist. Für den Aufbau sind Erscheinungen von
Schaftformen, die organische Disposition der Blattansätze
wie die Stellung und Gruppirung der Blätter verschiedener
Pflanzen, der Natur soweit nachgebildet, als es die Zweck-
Pokal, ziselirt von O. Rohloff, Berlin.
mäßigkeit des Gegenstandes gestattete und sich die natür-
liche Form mit den Bedingungen des Materials und der
Technik vereinigen ließ. Um den Fuß legt sich eine Rosette
von Grundblättern; der Knauf, aus welchem dieselben ent-
springen ist als Knotenzone mit Sprossanlagen behandelt;
für die eigentliche Hohlform des Bechers ist eine Blüte
(Cobaea scandeas) benutzt; dieselbe ruht in dem Kelche eines
Glockenblütlers (Campanula Medium), welchem die an-
schließenden Vorblätter derselben Pflanze untergelegt sind.
Die Form hat sich beim Gebrauche von Seiten verschiedener
Kunstfreunde, welche den Pokal besitzen, als handlich und
zweckentsprechend erwiesen. Die Arbeit war der erste Ver-
such eines Stipendiaten des k. Kunstgewerbemuseums, die
ornamentalen Naturstudien der Meurer'schen Schule zu ver-
werten.
Ein Thürklopfer des germanischen Museums. Das germa-
nische Museum besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von
Thürklopfern sowie Unterlagsplatten dazu, die zum Teil ganz
köstliche Stücke sind und ein leuchtendes Zeugnis ablegen
von der Gediegenheit und künstlerisch - dekorativen Dar-
stellungsfähigkeit der spätmittelalterlichen Kunstschlosserei.
Zwischen diese Stücke und einen reich ausgeführten durch-
brochenen Thürklopfer mit Unterlage, der aus Eisen gegossen
und getrieben, das Meisterstück eines Kasseler Kunstschlossers
vom Jahre 1729 repräsentirt, tritt nun ein neuerworbenes
95
museums Professors Melchior zur Straßen. Geboren am
28. Dezember 1832 zu Münster in Westfalen, kam Melchior
zur Straßen 1850 in die Schule des Kölnischen Bildhauers
Imhof. Von dort wandte er sich 1854 nach Berlin, arbeitete
hier unter Rauch bis zu dessen Tode 1857 und ging dann
nach Rom. In Berlin entstanden von ihm zwei bedeutende
plastische Werke, die er im Auftrag Friedrich Wilhelms IV.
ausführte, eine heilige Elisabeth für das katholische Spital
und der Große Kurfürst als Knabe. Von Rom sandte er die
„Römische Hirtin" zur Berliner Ausstellung; dort schuf er
auch für den Freiherrn von Oppenheim in Köln die herrliche
Marmorgruppe einer „Caritas". Nach Berlin im Jahre 1863
zurückgekehrt, bezog er das ehemalige Rauch'sche Atelier,
aus dem von ihm eine neue Reihe bildnerischer Schöpfungen
hervorging, so im Ja,hre 1870 die Gruppe König Wilhelm
und Kronprinz Friedrich Wilhelm auf dem Schlachtfeld von
Königgrätz, weiter achtundzwanzig große Porträtmedaillons
in Bronze für das Berliner Rathaus und anderes in Terracotta.
Seinen Ruf als bewährter Bildhauer im Sinne vornehmster
und edelster Auffassung wird auch die Stadt Leipzig dank-
bar und ehrend zu erhalten wissen, denn hier sprechen zahl-
reiche Werke der Plastik von dem berufenen Meister, so die
Giebelgruppe am Frontispiz des Hauptpostamtes, die Lipsia-
figur auf der Neuen Börse, die Statuen Rembrandt's und
Rubens am Städtischen Museum, die Standbilder Friedrich's
des Streitbaren und Moritz' von Sachsen, Goethe's und
Lessing's an der schönen Universitätsbibliothek, die den
Buchhandel versinnlichende Frauenflgur am Deutschen Buch-
händlerhause. Auch ein umfangreicher Figurenfries für das
neue Museum in Linz ging in Leipzig aus seinen Händen
hervor. Einen guten Teil seiner Kraft und seiner Kenntnisse
widmete der Verewigte den Schätzen und den Besuchern des
Leipziger Kunstgewerbemuseums.
WETTBEWERBE.
Im Anzeigenteile der heutigen Nummer veröffentlicht der
geschäftsführende Ausschuss der „Sächsisch-Thüringischen
Industrie- und Gciverbeaus Stellung zu Leipzig 1897 ein
Preisausschreiben behufs Gewinnung eines Ausstellungs-
plakates. An demselben können sich alle im Ausstellungs-
gebiete wohnhaften Künstler beteiligen. Für die drei besten
eingehenden Entwürfe sind Preise im Betrage von 800, 600
und 400 M. ausgesetzt. Das Preisgericht besteht aus folgen-
den Herren: Professor M. Honegger, Max Klinger, Stadt-
baudirektor Prof. Licht, Arthur Scheiter, Direktor P. lldph.
Schuster; Stadtrat IL Dodcl, Handelskammer-Sekretär Dr.
Pohle, Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses. Die
Frist zur Einreichung der Entwürfe läuft am 16. April d. J. ab.
Der Pokal, welchen unsere Illustration wiedergiebt,
bildet einen Versuch, pflanzliche Formen und Wachstums-
bilder einer traditionellen Kunstform unmittelbarer anzu-
passen, als es bei derartigen Gebrauchsgegenständen in der
Regel üblich ist. Für den Aufbau sind Erscheinungen von
Schaftformen, die organische Disposition der Blattansätze
wie die Stellung und Gruppirung der Blätter verschiedener
Pflanzen, der Natur soweit nachgebildet, als es die Zweck-
Pokal, ziselirt von O. Rohloff, Berlin.
mäßigkeit des Gegenstandes gestattete und sich die natür-
liche Form mit den Bedingungen des Materials und der
Technik vereinigen ließ. Um den Fuß legt sich eine Rosette
von Grundblättern; der Knauf, aus welchem dieselben ent-
springen ist als Knotenzone mit Sprossanlagen behandelt;
für die eigentliche Hohlform des Bechers ist eine Blüte
(Cobaea scandeas) benutzt; dieselbe ruht in dem Kelche eines
Glockenblütlers (Campanula Medium), welchem die an-
schließenden Vorblätter derselben Pflanze untergelegt sind.
Die Form hat sich beim Gebrauche von Seiten verschiedener
Kunstfreunde, welche den Pokal besitzen, als handlich und
zweckentsprechend erwiesen. Die Arbeit war der erste Ver-
such eines Stipendiaten des k. Kunstgewerbemuseums, die
ornamentalen Naturstudien der Meurer'schen Schule zu ver-
werten.
Ein Thürklopfer des germanischen Museums. Das germa-
nische Museum besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von
Thürklopfern sowie Unterlagsplatten dazu, die zum Teil ganz
köstliche Stücke sind und ein leuchtendes Zeugnis ablegen
von der Gediegenheit und künstlerisch - dekorativen Dar-
stellungsfähigkeit der spätmittelalterlichen Kunstschlosserei.
Zwischen diese Stücke und einen reich ausgeführten durch-
brochenen Thürklopfer mit Unterlage, der aus Eisen gegossen
und getrieben, das Meisterstück eines Kasseler Kunstschlossers
vom Jahre 1729 repräsentirt, tritt nun ein neuerworbenes