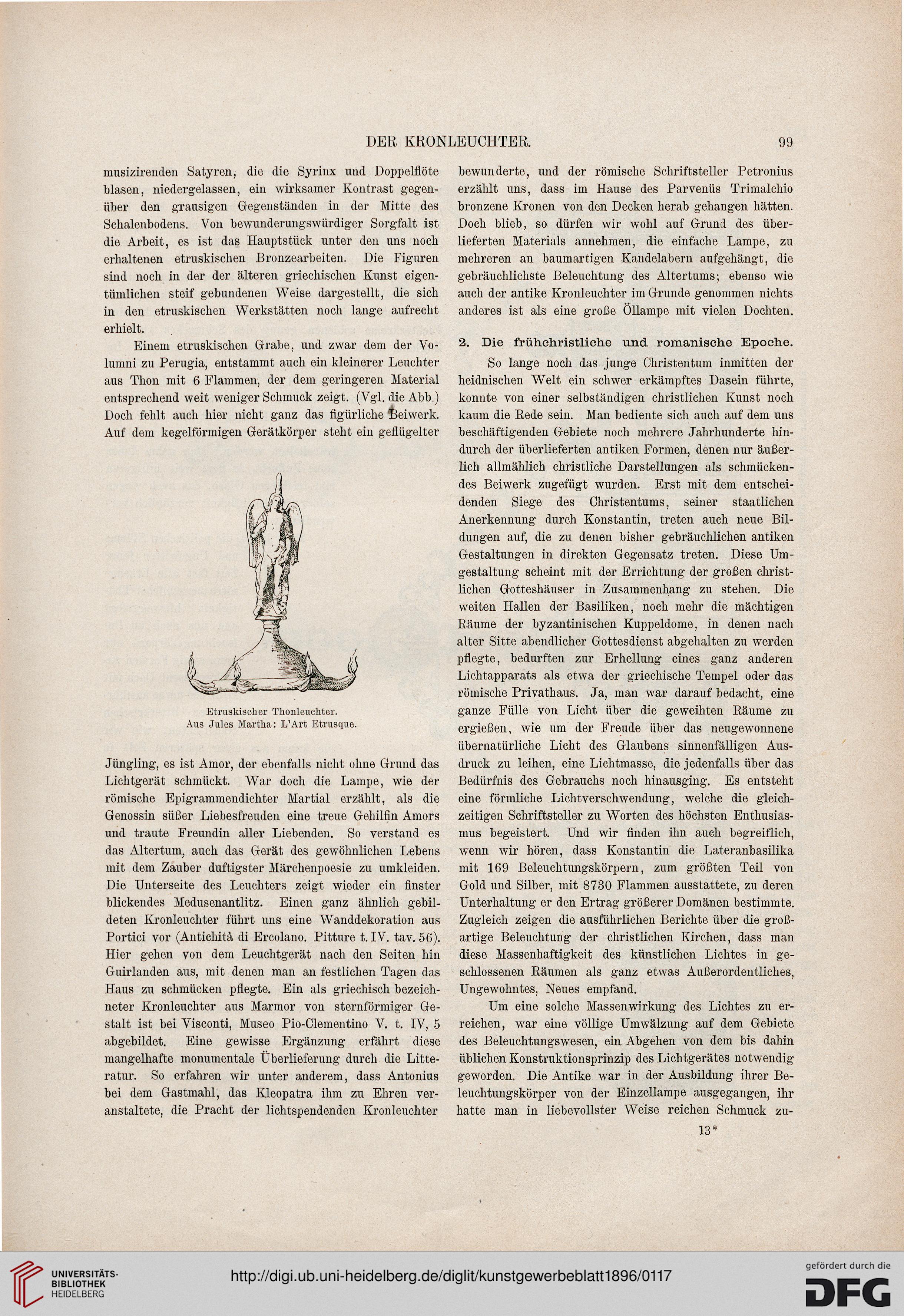DER KRONLEUCHTER.
99
musizirenden Satyren, die die Syrinx und Doppelflöte
blasen, niedergelassen, ein wirksamer Kontrast gegen-
über den grausigen Gegenständen in der Mitte des
Schalenbodens. Von bewunderungswürdiger Sorgfalt ist
die Arbeit, es ist das Hauptstück unter den uns noch
erhaltenen etruskischen Bronzearbeiten. Die Figuren
sind noch in der der älteren griechischen Kunst eigen-
tümlichen steif gebundenen Weise dargestellt, die sich
in den etruskischen Werkstätten noch lange aufrecht
erhielt.
Einem etruskischen Grabe, und zwar dem der Vo-
lunini zu Perugia, entstammt auch ein kleinerer Leuchter
aus Thon mit 6 Flammen, der dem geringeren Material
entsprechend weit weniger Schmuck zeigt. (Vgl. die Abb.)
Doch fehlt auch hier nicht ganz das figürliche Beiwerk.
Auf dem kegelförmigen Gerätkörper steht ein geflügelter
Etruskisulier Thonleuchter.
Aus Jules Martha: L'Art Etrusque.
Jüngling, es ist Amor, der ebenfalls nicht ohne Grund das
Lichtgerät schmückt. War doch die Lampe, wie der
römische Epigrammendichter Martial erzählt, als die
Genossin süßer Liebesfreudeu eine treue Gehilfin Amors
und traute Freundin aller Liebenden. So verstand es
das Altertum, auch das Gerät des gewöhnlichen Lebens
mit dem Zauber duftigster Märchenpoesie zu umkleiden.
Die Unterseite des Leuchters zeigt wieder ein finster
blickendes Medusenantlitz. Einen ganz ähnlich gebil-
deten Kronleuchter führt uns eine Wanddekoration aus
Portici vor (Antichitä di Ercolano. Pitture t. IV. tav. 56).
Hier gehen von dem Leuchtgerät nach den Seiten hin
Guirlanden aus, mit denen man an festlichen Tagen das
Haus zu schmücken pflegte. Ein als griechisch bezeich-
neter Kronleuchter aus Marmor von sternförmiger Ge-
stalt ist bei Visconti, Museo Pio-Clementino V. t. IV, 5
abgebildet. Eine gewisse Ergänzung erfährt diese
mangelhafte monumentale Überlieferung durch die Litte-
ratur. So erfahren wir unter anderem, dass Antonius
bei dem Gastmahl, das Kleopatra ihm zu Ehren ver-
anstaltete, die Pracht der lichtspendenden Kronleuchter
bewunderte, und der römische Schriftsteller Petronius
erzählt uns, dass im Hause des Parvenüs Trimalchio
bronzene Kronen von den Decken herab gehangen hätten.
Doch blieb, so dürfen wir wohl auf Grund des über-
lieferten Materials annehmen, die einfache Lampe, zu
mehreren an baumartigen Kandelabern aufgehängt, die
gebräuchlichste Beleuchtung des Altertums; ebenso wie
auch der antike Kronleuchter im Grunde genommen nichts
anderes ist als eine große Öllampe mit vielen Dochten.
2. Die frühchristliche und romanische Epoche.
So lange noch das junge Christentum inmitten der
heidnischen Welt ein schwer erkämpftes Dasein führte,
konnte von einer selbständigen christlichen Kunst noch
kaum die Kede sein. Man bediente sich auch auf dem uns
beschäftigenden Gebiete noch mehrere Jahrhunderte hin-
durch der überlieferten antiken Formen, denen nur äußer-
lich allmählich christliche Darstellungen als schmücken-
des Beiwerk zugefügt wurden. Erst mit dem entschei-
denden Siege des Christentums, seiner staatlichen
Anerkennung durch Konstantin, treten auch neue Bil-
dungen auf, die zu denen bisher gebräuchlichen antiken
Gestaltungen in direkten Gegensatz treten. Diese Um-
gestaltung scheint mit der Errichtung der großen christ-
lichen Gotteshäuser in Zusammenhang zu stehen. Die
weiten Hallen der Basiliken, noch mehr die mächtigen
Räume der byzantinischen Kuppeldome, in denen nach
alter Sitte abendlicher Gottesdienst abgehalten zu werden
pflegte, bedurften zur Erhellung eines ganz anderen
Lichtapparats als etwa der griechische Tempel oder das
römische Privathaus. Ja, man war darauf bedacht, eine
ganze Fülle von Licht über die geweihten Eäume zu
ergießen, wie um der Freude über das neugewonnene
übernatürliche Licht des Glaubens sinnenfälligen Aus-
druck zu leihen, eine Lichtmasse, die jedenfalls über das
Bedürfnis des Gebrauchs noch hinausging. Es entstellt
eine förmliche Lichtverschwendung, welche die gleich-
zeitigen Schriftsteller zu Worten des höchsten Enthusias-
mus begeistert. Und wir finden ihn auch begreiflich,
wenn wir hören, dass Konstantin die Lateranbasilika
mit 169 Beleuchtungskörpern, zum größten Teil von
Gold und Silber, mit 8730 Flammen ausstattete, zu deren
Unterhaltung er den Ertrag größerer Domänen bestimmte.
Zugleich zeigen die ausführlichen Berichte über die groß-
artige Beleuchtung der christlichen Kirchen, dass man
diese Massenhaftigkeit des künstlichen Lichtes in ge-
schlossenen Räumen als ganz etwas Außerordentliches,
Ungewohntes, Neues empfand.
Um eine solche Massenwirkung des Lichtes zu er-
reichen, war eine völlige Umwälzung auf dem Gebiete
des Beleuchtungswesen, ein Abgehen von dem bis dahin
üblichen Konstraktionsprinzip des Lichtgerätes notwendig
geworden. Die Antike war in der Ausbildung ihrer Be-
leuchtungskörper von der Einzellampe ausgegangen, ihr
hatte man in liebevollster Weise reichen Schmuck zu-
13*
99
musizirenden Satyren, die die Syrinx und Doppelflöte
blasen, niedergelassen, ein wirksamer Kontrast gegen-
über den grausigen Gegenständen in der Mitte des
Schalenbodens. Von bewunderungswürdiger Sorgfalt ist
die Arbeit, es ist das Hauptstück unter den uns noch
erhaltenen etruskischen Bronzearbeiten. Die Figuren
sind noch in der der älteren griechischen Kunst eigen-
tümlichen steif gebundenen Weise dargestellt, die sich
in den etruskischen Werkstätten noch lange aufrecht
erhielt.
Einem etruskischen Grabe, und zwar dem der Vo-
lunini zu Perugia, entstammt auch ein kleinerer Leuchter
aus Thon mit 6 Flammen, der dem geringeren Material
entsprechend weit weniger Schmuck zeigt. (Vgl. die Abb.)
Doch fehlt auch hier nicht ganz das figürliche Beiwerk.
Auf dem kegelförmigen Gerätkörper steht ein geflügelter
Etruskisulier Thonleuchter.
Aus Jules Martha: L'Art Etrusque.
Jüngling, es ist Amor, der ebenfalls nicht ohne Grund das
Lichtgerät schmückt. War doch die Lampe, wie der
römische Epigrammendichter Martial erzählt, als die
Genossin süßer Liebesfreudeu eine treue Gehilfin Amors
und traute Freundin aller Liebenden. So verstand es
das Altertum, auch das Gerät des gewöhnlichen Lebens
mit dem Zauber duftigster Märchenpoesie zu umkleiden.
Die Unterseite des Leuchters zeigt wieder ein finster
blickendes Medusenantlitz. Einen ganz ähnlich gebil-
deten Kronleuchter führt uns eine Wanddekoration aus
Portici vor (Antichitä di Ercolano. Pitture t. IV. tav. 56).
Hier gehen von dem Leuchtgerät nach den Seiten hin
Guirlanden aus, mit denen man an festlichen Tagen das
Haus zu schmücken pflegte. Ein als griechisch bezeich-
neter Kronleuchter aus Marmor von sternförmiger Ge-
stalt ist bei Visconti, Museo Pio-Clementino V. t. IV, 5
abgebildet. Eine gewisse Ergänzung erfährt diese
mangelhafte monumentale Überlieferung durch die Litte-
ratur. So erfahren wir unter anderem, dass Antonius
bei dem Gastmahl, das Kleopatra ihm zu Ehren ver-
anstaltete, die Pracht der lichtspendenden Kronleuchter
bewunderte, und der römische Schriftsteller Petronius
erzählt uns, dass im Hause des Parvenüs Trimalchio
bronzene Kronen von den Decken herab gehangen hätten.
Doch blieb, so dürfen wir wohl auf Grund des über-
lieferten Materials annehmen, die einfache Lampe, zu
mehreren an baumartigen Kandelabern aufgehängt, die
gebräuchlichste Beleuchtung des Altertums; ebenso wie
auch der antike Kronleuchter im Grunde genommen nichts
anderes ist als eine große Öllampe mit vielen Dochten.
2. Die frühchristliche und romanische Epoche.
So lange noch das junge Christentum inmitten der
heidnischen Welt ein schwer erkämpftes Dasein führte,
konnte von einer selbständigen christlichen Kunst noch
kaum die Kede sein. Man bediente sich auch auf dem uns
beschäftigenden Gebiete noch mehrere Jahrhunderte hin-
durch der überlieferten antiken Formen, denen nur äußer-
lich allmählich christliche Darstellungen als schmücken-
des Beiwerk zugefügt wurden. Erst mit dem entschei-
denden Siege des Christentums, seiner staatlichen
Anerkennung durch Konstantin, treten auch neue Bil-
dungen auf, die zu denen bisher gebräuchlichen antiken
Gestaltungen in direkten Gegensatz treten. Diese Um-
gestaltung scheint mit der Errichtung der großen christ-
lichen Gotteshäuser in Zusammenhang zu stehen. Die
weiten Hallen der Basiliken, noch mehr die mächtigen
Räume der byzantinischen Kuppeldome, in denen nach
alter Sitte abendlicher Gottesdienst abgehalten zu werden
pflegte, bedurften zur Erhellung eines ganz anderen
Lichtapparats als etwa der griechische Tempel oder das
römische Privathaus. Ja, man war darauf bedacht, eine
ganze Fülle von Licht über die geweihten Eäume zu
ergießen, wie um der Freude über das neugewonnene
übernatürliche Licht des Glaubens sinnenfälligen Aus-
druck zu leihen, eine Lichtmasse, die jedenfalls über das
Bedürfnis des Gebrauchs noch hinausging. Es entstellt
eine förmliche Lichtverschwendung, welche die gleich-
zeitigen Schriftsteller zu Worten des höchsten Enthusias-
mus begeistert. Und wir finden ihn auch begreiflich,
wenn wir hören, dass Konstantin die Lateranbasilika
mit 169 Beleuchtungskörpern, zum größten Teil von
Gold und Silber, mit 8730 Flammen ausstattete, zu deren
Unterhaltung er den Ertrag größerer Domänen bestimmte.
Zugleich zeigen die ausführlichen Berichte über die groß-
artige Beleuchtung der christlichen Kirchen, dass man
diese Massenhaftigkeit des künstlichen Lichtes in ge-
schlossenen Räumen als ganz etwas Außerordentliches,
Ungewohntes, Neues empfand.
Um eine solche Massenwirkung des Lichtes zu er-
reichen, war eine völlige Umwälzung auf dem Gebiete
des Beleuchtungswesen, ein Abgehen von dem bis dahin
üblichen Konstraktionsprinzip des Lichtgerätes notwendig
geworden. Die Antike war in der Ausbildung ihrer Be-
leuchtungskörper von der Einzellampe ausgegangen, ihr
hatte man in liebevollster Weise reichen Schmuck zu-
13*